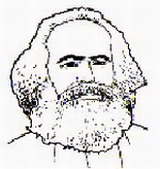Zeitschrift für Sozialismus und Frieden 5/06
Herausgeber: Verein zur Förderung demokratischer Publizistik (e.V.)
Spendenempfehlung: 1,60 €
Mai / Juni 2006
Inhalt
- Redaktionsnotiz
- Nachrichten und Berichte
- Ulrich Sander: „Endlich das Grundgesetz einhalten!“
- SOL-Hamburg u.a.: Auf zum XX. Internationalen Jugendcamp gegen Faschismus und Imperialismus in Dänemark, 28. Juli bis 6. August 2006 bei Kopenhagen
- Otto Bruckner, Helmut Fellner u.a.: Liebe FreundInnen, KollegInnen, GenossInnen,
- ZK der KPD: Solidarität mit Tobias Pflüger!
- Zur politischen Ökonomie des Sozialismus
- Die kommunistische Bewegung in Österreich
- Resonanz
Redaktionsnotiz |
Am 3. Juni 06 hat sich unser Herausgeberverein zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen. Thema: Die DKP nach ihrem Programmparteitag. Wir haben das neue DKP-Programm von unterschiedlichen Seiten aus beleuchtet und analysiert und uns Gedanken gemacht, was die Annahme dieses Programms für die Partei bedeutet. Es gab Referate von Fritz Dittmar, Frank Flegel, Kurt Gossweiler, Hermann Jacobs, Michael Opperskalski, Andrea Schön und Arne Taube sowie einen schriftlichen Beitrag von Wolfgang Herrmann. Die Referate und die lebhafte Diskussion werden wir in Form eines Sonderheftes veröffentlichen.
Das erste unserer beiden Publikationsprojekte, das Lehrbuch politische Ökonomie, wird im Sommer in der Rohfassung fertig werden, Feinheiten und Korrekturen werden voraussichtlich noch die Zeit bis zum Herbst in Anspruch nehmen, aber wir können realistisch davon ausgehen, dass wir das Buch Anfang nächsten Jahres ausliefern können.
Auch in anderen Ländern werden Anstrengungen unternommen, Klarheit über die politische Ökonomie des Sozialismus zu erlangen. Wir freuen uns, eine interessante Arbeit von Ervin Rosznyai und einen anschließenden Briefwechsel mit Kurt Gossweiler hier abdrucken zu können. Eine wichtige Zusammenfassung der Entwicklung der kommunistischen Bewegung in Österreich findet ihr im vorliegenden Heft, ebenso eine ausführliche Kritik am Sonderheft von Hermann Jacobs „Über den Sozialismus und die DKP“ – und zu Beginn haben wir einige vermischte Meldungen. Die enthaltenen Solidaritätsaufrufe legen wir Euch besonders ans Herz.
Und nun nichts Neues: Zeitungmachen kostet Geld. Wir existieren nur von den Spendengeldern unserer Leserinnen und Leser. Ihr müsst uns unterstützen, sonst leben wir nicht lange.
Spendenkonto Offensiv:
Inland: Konto Frank Flegel
Nr.:30 90 180 146
bei Sparkasse Hannover,
BLZ 250 501 80
Ausland: Konto Frank Flegel,
Internat. Kontonummer.(IBAN): DE10 2505 0180 0021 8272 49,
Bankidentifikation (BIC): SPKHDE2HXXX; Kennwort Offensiv
Redaktion Offensiv, Hannover
Nachrichten und Berichte |
Ulrich Sander:
„Endlich das Grundgesetz einhalten!“
Rede beim Auftakt des Ostermarsches 2006 am 15. April in Duisburg. Ulrich Sander ist Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA)
Wir sind im Krieg. Und wir stehen vor neuen Kriegen. Der höchste General sagt, „der Einsatz“, er meint den Krieg, „bestimmt den Alltag der Bundeswehr.“ (Generalinspekteur W. Schneiderhan in „Y“, Magazin der Bundeswehr, April 2006) Deutschland und die EU wollen den Iran nicht den USA als Beute überlassen. Sie wollen am Krieg um das dortige Öl im eigenen Kapitalinteresse teilnehmen. Das sind die Gründe des Konflikts – und nicht jene, die uns Tag für Tag genannt werden. Weil der Iran nach Atomwaffen strebt, müssen wir gegen Iran Atom-waffen einsetzen. Derartiger Wahnsinn wird uns von der us-amerikanischen und der französischen Regierung eingehämmert – und die deutsche Kanzlerin findet kein Wort der Kritik, sondern trieft vor Verständnis.
Deutschland war und ist im Krieg – mit rund 7.000 Soldaten auf dem Balkan und in Afgha-nistan. Ständig sind 35.000 Soldaten abmarschbereit.
Wir werden mit Lügen überschüttet, um die Kriege zu begründen. Das allgemein anerkannte „Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus“ wurde zu „Nie wieder Auschwitz“ verkürzt, wobei übersehen wird, dass Krieg die Voraussetzung für Auschwitz war. In Belgrad und Bagdad mussten dann je ein neuer Hitler beseitigt werden, um die Zugangswege zu den Ölreserven zu sichern – und das Öl selbst. In Teheran wartet der nächste Hitler, der beseitigt werden muss. Auch dort gibt es viel Öl. In Afghanistan sollten die Menschenrechte geschützt und die Terroristen bekämpft werden. Doch Terroristen und Staatsterroristen agieren weltweit und verstärkt. Statt Menschenrechten floriert die Heroinproduktion am Hindukusch. Die Bundes-wehr schützt eine mittelaltzerliche, grausame Rechtsordnung in Afghanistan, die den Religionswechsel mit Todesstrafe belegt, - und die Verlegung neuer Pipelines der Ölindustrie.
Und im Kongo soll nun mit Militär eine Wahl organisiert werden. Wann wird Lukaschenko zum neuen Hitler erklärt, auf dass in Minsk mit Hilfe der Bundeswehr eine ordentliche Wahl stattfindet? Worum geht es wirklich im Kongo, in Afrika? Es müsse der Immigrationsdruck auf Europa abgewehrt werden, es müsse das Land mittels einer demokratischen Regierung stabilisiert werden und dies im entwicklungspolitischen Interesse (Jung lt. FR, 5.4.06). Das heißt: Krieg gegen Flüchtlinge, Krieg im Sinne einer Stabilität, die dem Westen den Zugriff auf die Rohstoffe des Kongo sichert. Es handelt sich um einen klassischen Kolonialkrieg mit dem eine genehme Regierung eingesetzt, das Land ausgebeutet und die Bevölkerung unter erbärm-lichen Bedingungen im Land gehalten wird.
„Da muss die Bundeswehr ran“, fordert der neue Kriegsminister Franz Josef Jung am 5. April 2006 in dicker Überschrift in der Frankfurter Rundschau. Für die Zukunft, so sagt Kriegsminister Jung, brauchen wir eine „Anpassung der verfassungsrechtlichen an die tatsäch-liche Lage“. Das bedeutet: die tatsächliche Lage, die Kriege der Deutschen von heute sind verfassungswidrig. Das haben wir von der Friedensbewegung immer gesagt.
Der seit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien größte Verfassungsbruch steht unmittelbar bevor. 7.000 Soldaten sollen erstmals gegen den Feind im Innern eingesetzt werden. Die Fußball-weltmeisterschaft in unserem Land wird genutzt, um einen Präzedenzfall zu schaffen für die langersehnte Wiederherstellung des Kampfauftrages nach dem alten kaiserlichen Motto: „Ruhe und Ordnung“ schaffen gegen mögliche soziale Unruhen – und sei es mit Panzern. „Gegen Demokraten helfen nur Soldaten“, hieß es einst. (…)
Auf die Frage der Süddeutschen Zeitung (4.2.04), ob er die Steigerung des Rüstungsetats bezahlen könne, sagte Minister Struck: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen dafür. Die Agenda 2010 wird ihre Früchte tragen und auch dem Haushalt mehr Spielraum verschaffen. Die ungeschmälerte Rüstung und der Abbau des Sozialstaats durch die „Agenda 2010“ und Hartz IV bedeuten zusammen genommen nicht nur Verarmung für Hunderttausende Menschen in Deutschland, sondern auch erhöhte Kriegsgefahr.
Es kann keine Rede davon sein, dass wir mit der neuen Regierung der Abschaffung der Wehrpflicht näher gekommen sind. Entscheidend sind die Anforderungen des Militärs. Sie be-nötigen die Wehrpflicht, um der Bundeswehr das geeignete Menschenmaterial zu beschaffen, das schnell auch zum Kanonenfutter werden kann. Aus Wehrpflichtigen werden Zeitsoldaten; schnell hat man sich verpflichtet, wenn sonst die Arbeitslosigkeit droht. Und schnell sieht man sich im Auslandseinsatz. Allein aus Afghanistan haben bereits 18 Soldaten ihren Heimweg im Zinksarg angetreten, nicht gerechnet die unbekannte Zahl der Opfer im Kommando Spezialkräfte, über die wir nichts erfahren dürfen.
Weithin unbemerkt von der Öffentlichkeit hat eine große Abstimmungskoalition im alten Deutschen Bundestag beschlossen, alle ehemaligen Bundeswehrangehörigen bis zum 60. Lebensjahr zu Reservisten zu erklären. Auf sie soll zurückgegriffen werden im „Einsatz“ – und zwar nicht nur wegen ihrer militärischen Fähigkeiten, sondern auch wegen ihrer beruflichen Qualifikation. Der Offizier hat „polizeiähnliche“ Fähigkeiten zu erlangen, stellte der Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan in „Informationen für die Truppe“ fest, und der Polizist hat soldatische Fähigkeiten zu haben, möchte man angesichts der Studien des „Zentrums für Transformation der Bundeswehr“ hinzufügen – und handwerkliche und wissenschaftliche und ökonomische. Und all dies für Einsätze – sowohl im Innern als auch in aller Welt.
Verteidigung am Hindukusch und in Hindelang nennt das die neue Regierung. Zwischen ständig 50.000 und im Notfall 250.000 Soldaten und Reservisten sowie Wehrpflichtige will die CDU als neue Heimatschutztruppe in Deutschland bereit halten, um das zu bekämpfen, was jetzt mit „Großschadensfälle“ umschrieben wird. Erstmals sollen 7.000 Soldaten bei der Fußball-weltmeisterschaft im Einsatz sein, um den Feind im Innern zu bekämpfen. Und das können sowohl Demonstranten als auch Streikende sein. In Bundeswehrstudien werden denn auch „Globalisierungskritiker“ bei den „Terroristen“ einsortiert. (Informationen für die Truppe, Nr. 3/02)
Wenn der Kriegsminister die Anpassung der Verfassung an die kriegerischen Tatsachen ver-langt, so fordern wir die Verteidigung der Verfassung. Sie verbietet Bundeswehreinsätze außerhalb der Landesverteidigung und der Bündnisverteidigung. Sie verbietet Einsätze im Innern. Sie verbietet Angriffskriege und die Vorbereitung dazu.
Dies ist das Jahr 45 seit dem ersten Ostermarsch an Rhein und Ruhr. Der Ostermarsch war zuerst ein Marsch gegen Atomwaffen. Daran müssen wir heute wieder erinnern. Bald darauf nannte sich die westdeutsche Friedensbewegung „Kampagne für Demokratie und Abrüstung“. Das wäre auch heute ein Moto. Wir brauchen Abrüstung und Demokratie.
Wann wird endlich das Grundgesetz eingehalten?
Nach dem Grundgesetz sollten wir frei sein von Krieg, weshalb der Angriffskrieg (Artikel 26 GG und 87a GG) verboten ist, seine Vorbereitung unter Strafe steht. Wir sollen frei sein von Not, weshalb der Sozialstaat vorgeschrieben ist und das Eigentum dem Sozialen verpflichtet ist (Artikel 14/15 GG). Wir sollen frei sein von Faschismus, weshalb das Verbot der NS und des Militarismus, das nach 1945 nachhaltig ausgesprochen wurde, weiter gilt (Artikel 139 GG).
Heute leben wir wieder in Zeiten wachsender Kriegsgefahr. Wie seit vielen Jahren nicht mehr, ist auch der Kampf gegen Atomwaffen besonders dringend notwendig. Wir wollen atomare Ab-rüstung – im Nahen Osten und weltweit. Wer gegen Atomwaffen ist, soll mit ihrer Abschaffung in Deutschland beginnen.
Statt die Fußballweltmeisterschaft im Juni/Juli an Rhein und Ruhr zur militärischen Auf-marschübung zu machen, wie es die Bundesregierung vor hat, gilt es, für Frieden und Völker-verständigung, gegen Nationalismus und die Nazi-Fan-Szene zu wirken.
Wir rufen dazu auf, keine weiteren Grundgesetzverstöße der Militaristen zuzulassen. Schluss mit den Auslandseinsätzen und Absage an Bundeswehreinsätze in Innern, die nach eindeutiger Verfassungslage verboten sind. Die ungeheuerlichen Pläne, entgegen der Verfassung und entgegen dem Verfassungsgerichtsurteil auch über unserem dicht besiedelten NRW angeblich terrorverdächtige Zivilflugzeuge abzuschießen, müssen auf den Widerstand aller Vernünftigen stoßen-
Nach dem 45. Jahrestag des Ostermarsches steht im Herbst der 60. Jahrestag der Gründung unseres Landes NRW bevor. Wir treten ein für die Verwirklichung der NRW-Landesverfassung, die das Recht auf Arbeit vorsieht und die Demokratisierung der Wirtschaftsmacht verlangt. Die Landesverfassung ist eine Absage an den Neoliberalismus. Wir treten ein für die Forderung: Endlich das Grundgesetz einhalten. Endlich den Frieden herstellen.
Ich wünsche frohe, friedliche Ostern – und einen stark beachteten Ostermarsch.
Ulrich Sander, Bundessprecher VVN-BdA
SOL-Hamburg u.a.:
Auf zum XX. Internationalen Jugendcamp gegen Faschismus und Imperialismus in Dänemark, 28. Juli bis 6. August 2006 bei Kopenhagen
Seit 1977 treffen sich antiimperialistische, antifaschistische und kommunistische Jugendliche verschiedener Länder auf einem gemeinsamen Camp, um ihre Erfahrungen auszutauschen und eine internationale Jugendbewegung aufzubauen. Das 20. Camp findet im Sommer 2006 in Dänemark (Kopenhagen) statt. Ihre Teilnahme haben bereits Jugendliche und Jugend-organisationen aus Brasilien, Burkina Faso, Dominkanische Republik, Elfenbeinküste, Ecuador, Frankreich, Kolumbien, Norwegen, Spanien, Irak, Tunesien der Türkei angekündigt. Auch hier in Deutschland wird mobilisiert. Kommt zum XX. internationalen Jugendcamp gegen Faschis-mus und Imperialismus.
Das Camp steht auf antiimperialistischer Grundlage: der Imperialismus ist das höchste Stadium des Kapitalismus. Der Imperialismus steht für eine Klassengesellschaft, er steht für die Ausbeutung der Arbeiterklasse durch die Kapitalistenklasse. Er steht für Kriege zur Profit-maximierung. Er steht aber auch für die Diskriminierung, für den Rassismus. Der Imperialismus ist faulender Kapitalismus. Diese Fäule bringt den Faschismus hervor. Der Faschismus ist eine Spielart des Imperialismus. Wir Antiimperialistinnen und Antiimperialisten kämpfen nicht nur gegen die Erscheinungen des Systems wie z.B. Sozialkahlschlag etc. Nein, wir packen den Imperialismus an der Wurzel. Und das heißt, dass der Imperialismus als solches bekämpft und beseitigt werden muss. Dazu gibt es keine Alternative. Um den Imperialismus auf der Welt zu zerschlagen, ist es notwendig sich auch international zu vereinen, um geschlossen gegen ihn vorgehen zu können. Dazu ist es auch notwendig, sich auf die Seite gerechter Befreiungskriege wie der Intifada in Palästina, in Afghanistan, im Irak etc. zu stellen. Jeder, der auf anti-imperialistisch, antifaschistischer Grundlage steht, ist willkommen!
Kommt alle zum Camp. Bringt Eure Erfahrungen mit ein und unterstützt den Aufbau einer aniimperialistischen, antifaschistischen Bewegung. Dieses Camp kann auch ein Beitrag für die Einheit der AntiimperialistInnen in Deutschland sein. Auf dem Camp wird es Plenumsdebatten, Workshops zu Themen wie dem Irakkrieg, Rassismus und Unterdrückung, Faschismus, Paläs-tina, Jugendbewegung und Sozialismus etc. geben. Es sind auch Ausflüge, Partys und eine Demonstration geplant.
Das Camp findet in und um ein Schullandheim statt. Es wird Simultanübersetzungen ins Englische geben.
Der Aufenthalt und die Verpflegung wird 67 Euro kosten. Die Anreise organisieren wir. Nehmt Kontakt zu uns auf und informiert Euch über das Camp! Beteiligt Euch an der Vorbereitung und Mobilisierung. Verteilt Infoblätter, klebt Plakate!
Unterzeichner:, SOL-Hamburg, Roter Oktober, Young Struggle
Infos und Anmeldungen über: www.jugend-camp.info.
Otto Bruckner, Helmut Fellner u.a.:
Liebe FreundInnen, KollegInnen, GenossInnen,
wir haben als Ottakringer Arbeiter- und Arbeiterinnenbildungsverein ein neues Lokal gemietet. Es befindet sich im 16. Bezirk Ecke Huttengasse/Rankgasse (Postadresse: 1160 Wien; Rankgasse 2/5). Es ist wunderschön, in hervorragender Lage und für alle unsere Aktivitäten bestens geeignet.
Das Lokal soll nicht nur dem Ottakringer Arbeiter- und Arbeiterinnenbildungsverein, der Kommunistischen Initiative [KI], der Kommunistische Jugend [KJÖ], den Ottakringer Kommu-nistInnen und PensionistInnen als Versammlungs- und Veranstaltungsort dienen, sondern wir haben auch vor, dort Sozial-, Miets- und Arbeitsrechtsberatungen und ev. Sprachkurse für MigrantInnen durchzuführen.
Wie ihr euch vorstellen könnt, kostet so ein Lokal - vor allem bis sich gewisse Unterstützungen möglicherweise auch Förderungen einstellen - Geld, die Kaution wurde bisher von einem Genossen vorfinanziert.
Wir ersuchen euch also nach euren Möglichkeiten zunächst eine Spende auf untenstehendes Konto einzuzahlen. Einige Freundinnen und GenossInnen haben bereits Daueraufträge auf das untenstehende Konto abgeschlossen, damit ist uns am meisten geholfen, da wir daraus die laufenden Kosten bestreiten können. Jede Summe ist nützlich und jede Summe nützt unseren politischen Tätigkeiten und Plänen. JedeR sollte nach seinen persönlichen Möglichkeiten unterstützen! Alle UnterstützerInnen bekommen von uns selbstverständlich Einblick in die Verwendung der Gelder! Wir danken im vorhinein für euer Entgegenkommen und hoffen auf eure Unterstützung.
KONTO bitte bei obiger Adresse erfahren, da von der BRD aus Auslandsüberweisung!
Mit kommunistischen Grüßen, Otto Bruckner, Gerhard Bruny, Gerhard Dusek, Helmuth Fellner
ZK der KPD:
Solidarität mit Tobias Pflüger!
Am 16. Mai hat das Europäische Parlament mit den Stimmen einer großen Koalition aus Konservativen, Liberalen, Sozialdemokraten, Grünen und Faschisten die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Tobias Pflüger beschlossen.
Tobias Pflüger ist seit Jahren ein bekannter Aktivist der Friedensbewegung in Deutschland. Er ist auch Vorstandsmitglied der Informationsstelle Militarisierung (IMI) und ist als Parteiloser auf der Liste der Linkspartei (PDS) in das Europaparlament gewählt worden. Was hat Tobias Pflüger „verbrochen“? Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen ihn wegen Beleidigung und Körperverletzung im Rahmen der Demonstrationen und Proteste gegen die Münchener Kriegskonferenz der NATO im Februar dieses Jahres. In Wirklichkeit hatte Tobias Pflüger bei Polizisten gegen die brutale Festnahme eines Demonstranten protestiert und unter Zeigen seines Abgeordnetenausweises verlangt, diesen zu sehen. Das war ihm von der Polizei verweigert worden. Schon 1999, 2003, 2004 und 2005 hatte die Staatsanwaltschaft München gegen Tobias Pflüger ermittelt – ohne Erfolg. Die Ermittlungen mussten eingestellt werden, Verfahren endeten mit Freispruch.
Es ist das erste Mal, dass das Europäische Parlament die Aufhebung der Immunität eines Abgeordneten aus politischen Gründen beschlossen hat.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München und die Aufhebung der Immunität Tobias Pflügers sind ein unerhörter Akt der Repression. Sie sind ein bezeichnendes Beispiel dafür, dass grundlegende demokratische Rechte und Freiheiten immer weiter abgebaut werden, während zugleich die Militarisierung und die imperialistische Kriegspolitik verschärft werden. Mit Tobias Pflüger soll auch die gesamte Friedensbewegung, alle diejenigen, die für den Frieden und gegen den imperialistischen Krieg kämpfen, kriminalisiert werden.
Die KPD (und natürlich auch wir, Red. Offensiv) ist mit Tobias Pflüger solidarisch. Wir rufen dazu auf, den Fall Tobias Pflüger bekannt zu machen und sich mit ihm solidarisch zu erklären. Der Kampf gegen den imperialistischen Krieg ist untrennbar mit dem Kampf für die Ver-teidigung der demokratischen Rechte verbunden.
Solidaritätserklärungen können online abgegeben werden unter www.thomas-mitsch.de
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD),
23. Mai 2006
Zur politischen Ökonomie des Sozialismus |
Red. Offensiv:
Redaktionelle Vorbemerkung
Wir bringen hier den Artikel von Ervin Rosznyai „Was ist Sozialismus“ über ökonomische Fragen und die Einschätzung der bisherigen Erfahrungen, zuerst erschienen in den „Weißenseer Blättern“ Ausgabe 3/1997, dem folgt ein Brief Kurt Gossweilers an den Autor als Antwort und – freundschaftliche – Kritik. Ervin Rosznyai gestattete uns, anschließend seine Replik auf diesen Brief zu bringen. Wir danken allen Beteiligten für die freundliche Unterstützung!
Red. Offensiv
Ervin Rosznyai:
Was ist der Sozialismus und warum trennt ihn eine Übergangszeit vom Kapitalismus?
Es handelt sich im folgenden um die Zusammenstellung von Grundgedanken des Autors, die er in zwei Aufsätzen entwickelt hat. Sie verhalten sich zueinander wie theoretische Grundlegung und praktische Exemplifikation im historischen Rückblick auf die Geschichte, in der das sozialistische Lager in Europa den Übergang zum Sozialismus nicht zuende zu führen vermochte. Die WBl haben beide Aufsätze als Teil I und Teil II miteinander verbunden und dabei lediglich Wiederholungen ausgelassen. - Red.WBl
I. Teil
Acht Thesen
Engels schreibt, daß das Ziel des Sozialismus darin besteht, "die Gesellschaft umzuformen, mit Abschaffung aller Klassenunterschiede" - was bei den Produktivkräften ein "auch im Vergleich mit unserem sehr hohes Niveau" voraussetzt, da die Abschaffung der Klassen nur unter dieser Bedingung einen "echten und dauerhaften Fortschritt" mit sich bringen kann, "ohne daß dies einen Stillstand oder gar einen Rückgang verursachen würde"[1] Die Klassen können nicht willkürlich jederzeit abgeschafft werden, wie sich dies die von einem utopischen Ver-braucherkommunismus Träumenden vorgestellt hatten. Der Bestand der Klassen ist unab-wendbar, so lange er eine objektive Basis der Produktion hat, so lange die Produktivkräfte nicht eine ihrer Vergesellschaftung entsprechende Eigentumsform erlangen - ein solches System von Produktionsverhältnissen, in dem die Erzeuger ihre Produkte nicht als einander entfremdete Eigentümer oder Verfügungsberechtigte am Markt austauschen (mit Geld als Vermittler), sondern als Gleiche über die Gesamtheit der Produktionsmittel als einheitliches Volksvermögen verfügen und ihre Arbeit der Gesellschaft direkt, ohne Umweg über den Markt zur Verfügung stellen.[2] In einer Marktwirtschaft erfahren die Produzenten nur nachträglich, nach Abschluß ihrer Arbeit, ob diese überhaupt benötigt wurde - ob es also eine zahlungsfähige Nachfrage gibt; im Sozialismus hingegen wird die Arbeit nach vorangehender Bewertung der vorhandenen Quellen und der Bedürfnisse getätigt, und unter Bedürfnissen werden die echten materiellen und kulturellen Ansprüche des Volkes verstanden, nicht die von den Marktverhältnissen abhängige zahlungskräftige Nachfrage. Der Sozialismus wird in jenem Maße zur Realität, in dem er das instinktbedingte Walten der Marktwirtschaft durch eine vom ganzen Volke kontrollierte und dem Nutzen des ganzen Volkes dienende bewußte Regelung verdrängt - eben darin besteht der Inhalt der Übergangsperiode, des zum Sozialismus führenden Überganges. Die Übergangszeit ist von einem Kampf zwischen der an den Kapitalismus gebundenen marktwirtschaftlichen Spontaneität und einer zum Sozialismus hinführenden Planmäßigkeit gekennzeichnet, der entweder mit einer Wiederherstellung des Kapitalismus oder der Verwirklichung des Sozialismus endet.
Von der Güterverteilung her gesehen ist der Sozialismus jene Gesellschaftsform, in der jeder nach seinen Fähigkeiten arbeitet und nach Abzug der für die gemeinschaftlichen Fonds benötigten Arbeitsmenge aus dem produzierten Fond für persönlichen Verbrauch seinen Anteil nach dem Maß der geleisteten Arbeit bekommt. Dies ist noch kein Kommunismus - also eine durch Überfluß und durch eine vom Bedarf bestimmte Verteilung gekennzeichnete Gesellschaft -, sondern nur deren Unterstufe. Aber die Verteilung wird hier - ebenso wie die Produktion - schon voll und ganz vom Plan, von einer bewußten Voraussicht und Berechnung geregelt; es gibt keinen Markt, keine Waren- und Geldverhältnisse, keine Klassen. "Eine Gesellschaft, in der der Unterschied zwischen Arbeitern und Bauern weiterbesteht, kann weder als kommunistische noch als sozialistische Gesellschaft bezeichnet werden" - sagte Lenin.[3] Wenn wir all dies berücksichtigen, kann der Sozialismus so definiert werden: eine über dem Kapitalismus stehende, auf einer für vollen Überfluß allerdings noch nicht ausreichenden Produktivität beruhende, mit wissenschaftlicher Planung geleitete klassenlose Formation, in der die Produktion mit modernster Technik in einer von Waren- und Geldverhältnissen freien, einheitlichen, gesamtgesellschaftlichen Eigentumsform vor sich geht, der gesamte gesell-schaftliche Lebensverlauf von den arbeitenden Massen kontrolliert wird und die Verteilung von der Leistung der Einzelnen bestimmt wird.
Der hier beschriebene Zustand ist bislang noch nie und nirgends verwirklicht worden. Die ersten sozialistisch gelenkten Staaten der Geschichte haben die formelle (rechtliche) Vergesell-schaftung des Eigentums (die Verstaatlichung und die Vergenossenschaftlichung) durchgeführt; dieser Schritt reicht jedoch allein zur Schaffung einer gemeinschaftlichen Gesellschaft, zur Abschaffung der wirtschaftlichen Trennung der Produktionseinheiten voneinander nicht aus. Diese Trennung behält die Waren- und Geldverhältnisse bei und verhindert, daß die Arbeit des Einzelnen und der Produktionseinheiten voll und ganz ohne marktwirtschaftliche Vermittlung als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit zur Geltung kommen kann.
Was verstehen wir dabei unter dem Begriff eines "wirtschaftlichen Getrenntseins"? Zum Teil dies, daß die Produktionseinheiten verschiedenen Eigentümern gehören und ihr Produkt-austausch dadurch ein Warenaustausch ist. In der Übergangsperiode bleibt der Unterschied zwischen staatlichem und genossenschaftlichem Eigentum auch nach der formellen Ver-gesellschaftung des Eigentums bestehen: rechtlich gesehen, gehört das eine dem ganzen Volke, das andere jedoch jeweils einer bestimmten Gruppe, und zwischen den beiden Sektoren entstehen wegen der unterschiedlichen Eigentümer marktwirtschaftliche Beziehungen. Dies ist klar. Das Problem besteht darin, daß der staatliche Sektor im Besitz eines einzigen Eigentümers ist, die dazugehörigen wirtschaftlichen Einheiten jedoch weit davon entfernt sind, solch eine innerlich zusammengehörige Einheit darzustellen, wie es die Untereinheiten einer Fabrik sind. Warum bestehen auch hier weiterhin Waren- und Geldverhältnisse? Ist es nicht so, daß das Geld in diesem Sektor keine andere Funktion hätte, als ein rein technisches Hilfsmittel zu sein - bei der Errechnung der Selbstkosten oder bei zwischenbetrieblichen Verrechnungen? Nehmen wir einmal das als Arbeitslohn ausgezahlte Geld: es erscheint kaum als rein technischer Behelf, vielmehr als Ausdruck eines bestimmten Produktionsverhältnisses, als dessen versachlichte Form. Die Frage besteht gerade darin, warum die individuelle Arbeitskraft auch in einem sozialistisch ausgerichteten Staat nur mit Vermittlung seitens des Marktes - mit Lohn und anderen Vergütungen als Gegenwert - einen gesellschaftlichen Charakter annimmt und zu einem Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit wird. Warum wird er nicht von selbst und direkt dazu? Warum verhält sich der Besitzer der Arbeitskraft als Privatperson zum neuen gemeinschaftlichen Eigentum, das formell (juristisch, verfassungsrechtlich) ihm gehört?
Untersuchen wir einmal die Ursachen dieser Erscheinung, die im Kapitalismus wurzelt, sowie die sich daraus in der Übergangszeit ergebenden Folgen.
1. These
Obwohl der Wettbewerb das Kapital zur Anwendung arbeitssparender technischer Mittel und Technologien anreizt, wirkt diesem entgegen, daß die Profitrate eine sinkende Tendenz zeigt, die sich daraus ergibt, daß der technische Fortschritt das relative Gewicht der menschlichen Arbeit (der Quelle des Mehrwerts) gegenüber dem investierten Gesamtkapital verringert. Es ist deswegen prinzipiell unmöglich, daß das Kapital die Automatisierung auf den gesamten Produktionsvorgang ausweitet: einerseits würde es dadurch selber die Erzeugung eines Mehrwerts - also seine eigene Existenz - annullieren, andererseits würde es - vom Umsatz her betrachtet - gleichzeitig eine Warenfülle erzeugen und die Kaufkraft abbauen. Die heutige Gesamtheit der kapitalistischen Produktion weist eine widersprüchliche Verschmelzung der automatisierten, halbautomatisierten und überhaupt nicht automatisierten Betriebe auf,[4] und wenn sich auch die Proportionen dieser drei Ebenen ändern, kann das Kapital keine von ihnen entbehren. Einerseits ist es dadurch im Kapitalismus unmöglich, ein solches Niveau der Automatisierung - und gemeinhin der Mechanisierung - zu verwirklichen, das jegliche schwere, ungesunde, gefährliche, schmutzige, eintönige, ermüdende Arbeit ausschließt und jedem einen schöpferischen Charakter seiner Arbeit ermöglicht. Das Gegenteil trifft ein: die der Senkung der Lohnkosten dienende, gewinnorientierte technische Vervollkommnung bringt eine massenhafte Entwertung des technischen Könnens mit sich (obwohl sie die höhere Ausbildung einer dünnen Personenschicht erfordert) und gleicht mit den von ihr geschaffenen neuen Arbeitsplätzen den Abbau der dadurch überflüssig gewordenen nicht aus. Die billige, ungeschulte Arbeit, die nie unter eine "natürliche" Rate sinkende und perspektivisch ständig steigende Arbeitslosigkeit ist eine der Bedingungen der "normalen" kapitalistischen Entwicklung. Also kann die Über-gangsperiode auch in den höchstentwickelten kapitalistischen Ländern keine solchen Produktionskräfte erben, die die großen Massen der Werktätigen vom zwangsmäßigen Charakter ihrer Arbeit befreien könnten.
2. These
Obwohl im Kapitalismus gewisse moderne Formen der Organisation der Arbeit den alten Gegensatz zwischen Lenkung und Durchführung etwas lockern, fixiert die Beziehung zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter als gesellschaftlicher Gegensatz jenen technischen Zwiespalt zwischen Lenkung und Durchführung, der von jeder Kooperation verlangt wird, unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Form. Die institutionalisierte Form dieses gesellschaftlichen Gegen-satzes ist das kapitalistische Fabriksystem, das hierarchisch aufgebaute Unternehmen. In der handwerklichen Periode des Kapitalismus organisierten die direkten Produzenten ihre Arbeit noch selber und waren dem Händler, der ihre Erzeugnisse auf den Markt brachte und sie mit Rohmaterial und Artikeln für ihre Lebenserhaltung versorgte, nur formell (juristisch) untergeordnet, nicht jedoch von der Natur ihrer Arbeit her: In günstigen Fällen konnte es sogar vorkommen, daß sie ihr Lohnarbeiterdasein aufgaben und ihre Selbständigkeit wiedererlangten. Mit der Einführung der mechanisierten Massenproduktion gab es dies nicht mehr - nicht einmal als abstrakte Möglichkeit. Die unmittelbaren Produzenten sind dem Kapital nunmehr als Durchführer von Teilvorgängen, als einfache Bestandteile des Maschinensystems untergeordnet: die Organisation und Kontrolle ihrer Arbeit - eine geistige Tätigkeit - wird von ihren per-sönlichen Fähigkeiten getrennt und zu einer ausschließlichen Befähigung des Kapitals, zur Aufgabe eines besonderen, entfremdeten Apparates. Die sozialistischen Revolutionen erben diese Organisationsform und können eine Zeitlang der darin verkörperten disziplinierenden Kraft auch nicht entsagen - sie können nun mal nicht ohne jene Hierarchie auskommen, die gleichzeitig Folge und Grund des Zwangscharakters der Arbeit ist. Daraus folgt auch gleich, daß sozialistische Revolutionen unbedingt die ganze Wegstrecke von der Vergesellschaftung der Eigentumsformen (vom Rechtsakt der Verstaatlichung und Vergenossenschaftlichung) bis zur die Hierarchie abbauenden Produzentenselbstverwaltung zurücklegen müssen - jener Selbstverwaltung, mit deren Verwirklichung die Massen auf eine von ihnen in Versuchen er-stellte und erprobte Weise ihre Rechte als Eigentümer selbst ausüben. Unerläßliche Voraussetzung der Vollendung dieses Vorgangs ist eine wesentlich geringere physische und nervliche Belastung der Produzierenden sowie Verlängerung ihrer Freizeit durch Automatisierung, die eine qualitativ neue Stufe der Produktivität zustande bringt.
3. These
Die höchstentwickelte Gesellschaftsform des Privateigentums - der Kapitalismus - ließ auf die Menschheit die Urwaldgesetze der Konkurrenz los, impfte ihr die "jeder ist des anderen Menschen Wolf"-Einstellung und das damit einhergehende Benehmen ein. Dies gilt nicht nur für die Besitzerklassen, sondern mehr oder weniger auch für die einen täglichen Kampf ums Überleben führenden Massen. "...Zur massenhaften Erzeugung dieses kommunistischen Bewußtseins"... ist ..."eine massenhafte Veränderung der Menschen nötig..., die nur in einer praktischen Bewegung, in einer Revolution vor sich gehen kann;" schrieben Marx und Engels, so daß "...also die Revolution nicht nur nötig ist, weil die herrschende Klasse auf keine andere Weise gestürzt werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden."[5] Der Dreck der Vergangenheit - das ist das Verhalten des Einzelnen zur Gemeinschaft als Privatmensch, das auch in der Übergangsperiode immer wieder neu entsteht, und zwar dadurch, daß die Produktionskräfte nicht ausreichen, allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft eine vielseitige Deckung aller ihrer Bedürfnisse zu bieten, und daß die relative Kargheit der Verbrauchsgüter einen Konkurrenzkampf der Einzelpersonen anheizt. Daher sowie aus den oben schon zitierten Umständen kommt es, daß die Individuen, obzwar sie rechtlich Eigentümer der Produktionsmittel sind, in der Praxis - mit Ausnahme einer kleinen Spitzengruppe - auch während des Übergangs dieser eigenen Gemeinschaft noch lange als Außenseiter gegenüberstehen, also als Besitzlose gegenüber Eigentümern, und in der Regel nur unter wirtschaftlichem Zwang ("materieller Anreiz") bereit sind, für eine Entlohnung oder eine andere materielle Begünstigung ihre Arbeitskraft als Teil der gesellschaftlichen Arbeitskraft einzusetzen. Die Arbeitskraft kommt also auch in der Über-gangsepoche durch marktwirtschaftliche Vermittlung, als Gegenstand von Verkauf, Kauf und ausgehandeltem Preis mit den Produktionsmitteln zusammen; - anders ausgedrückt verliert sie also ihren Warencharakter auch dann nicht, trotz des Umstands, daß ihre Verkäufer und Käufer sich nur formell voneinander unterscheiden - so eben, wie das Individuum von einer Ge-meinschaft, der es auch selbst angehört. Lohn, Gehalt oder andere ähnliche Einkommensformen widerspiegeln das privat-persönliche Verhältnis der Einzelnen zu ihrer eigenen Gesellschaft und funktionieren zu gleicher Zeit sowohl als Rechtsanspruch auf Vereinnahmung einer bestimmten Menge von Verbrauchsgütern als auch als Mittel eines Zwanges, da ja die Einzelpersonen nur auf diesem Wege zu diesen Gütern gelangen können. Es braucht eine tiefe Umgestaltung des Bewußtseins der Mehrheit, um dahin zu gelangen, daß sie ohne äußeren Zwang - freiwillig - arbeitet, weil ja die Arbeit für sie noch nicht zu einem vorrangigen Lebensbedürfnis geworden ist, ja, nicht geworden sein konnte (so wie beispielsweise bei einem Künstler oder einem anderem schöpferisch beschäftigten Menschen).
4. These
Im Kapitalismus, wo die Arbeitskraft zur Ware wird, wird die gesamte Arbeitskapazität der Gesellschaft durch das Wertgesetz zwischen den einzelnen Beschäftigungszweigen verteilt, und welche Arbeit der eine oder andere vollbringt, hängt - wenn er überhaupt beschäftigt ist - in entscheidender Weise nicht von seinen persönlichen Vorlieben und Talenten ab, sondern von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt; es ist wahrlich ein Zufall, wenn die für den Lebensunterhalt geleistete bezahlte Arbeit zugleich als persönliche Berufung erfüllt werden kann und mit der "Selbstverwirklichung" der Persönlichkeit zusammentrifft. Die Arbeitermacht des Übergangszeitalters erbt diesen blinden Automatismus vom kapitalistischen System. Die revolutionäre Arbeitermacht kämpft von Anfang an gegen dieses schädliche Erbe, sie ist bemüht, die Entfremdung der Menschen von ihrer eigenen Arbeit zu mindern und in der Masse der Werktätigen ein Eigentümer-Verhältnis zu den verstaatlichten Produktionsmitteln zu erwecken. Sie beauftragt gesellschaftliche Organe mit einer demokratischen Kontrolle der innerbetrieblichen Hierarchie, sorgt für die gesundheitliche und soziale Versorgung der Werktätigen, für Zugang von jugendlichen Arbeitern und Bauern zur Hochschulbildung, usw. Ihre Bestrebungen können jedoch immer nur in dem Maße Wirklichkeit werden, in dem dies die objektiven Verhältnisse zulassen (also das allgemeine Niveau der Produktivkräfte und der Kultur, die Struktur der Gesellschaft und ihre internationale Lage) - beziehungsweise, soweit dies durch landesinternen Klassenkampf erzwungen wird. So ist es zum Beispiel eine Frage des Kampfes, ob die innerbetrieblichen Partei- und Gewerkschaftsorganisationen wirklich fähig sind, die Hierarchie unter Kontrolle zu halten, oder ob sie durch eigene Bürokratisierung mit ihr verschmelzen und zu einem bloßen Zierrat werden. Die Arbeitermacht hat also keinesfalls einen nach Belieben erweiterbaren Spielraum: sie kann zwar auf der Basis des Gemeineigentums die Spontaneität des Marktes planmäßig eingrenzen, doch kann sie weder das Gesetz der Wert-bildung außer Kraft setzen noch die planmäßige Verteilung der Quellen von internen Zwängen und äußeren Einflüssen befreien - zum Beispiel von der Notwendigkeit einer beschleunigten Akkumulation und Bewaffnung, wenn ein Krieg droht. Dadurch wirken bei der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeitskraft auch weiterhin solche Faktoren mit, die - als den persönlichen Fähigkeiten uninteressiert gegenüberstehende, unpersönliche äußere Kräfte - den Arbeiter seiner Arbeit entfremden, wodurch sie den Charakter der Arbeitskraft als Ware festschreiben und nur durch den Aufbau der materiellen Grundlage des Sozialismus verdrängt werden können.
5. These
Das Verhältnis als Privatperson gegenüber der Gemeinschaft wirkt unter den Werktätigen am stärksten in der Bauernschaft - Eigentümer-Instinkte sind von der bäuerlichen Existenz nun mal nicht zu trennen. Deswegen spaltet sich die sozialistische Eigentumsformation der Epoche des Übergangs in einen staatlichen und einen genossenschaftlichen Sektor, die verschiedene Besitzer haben und miteinander in einem Warenaustausch-Verhältnis stehen. Wegen dieser Warenaustausch-Kontakte und den warenmäßigen Aspekten der Arbeitskraft - letzten Endes wegen der begrenzten Produktivkräfte - nimmt der größte Teil der Konsumgüter gleichfalls Warencharakter an und gelangt zum Konsumenten über den Markt. Der Markt ist Kampfplatz von Konkurrenten. Im Kapitalismus verläuft der Marktwettbewerb, der Konkurrenzkampf einerseits zwischen den Eigentümern der Produktionsmittel um Maximalisierung des Profits, andererseits zwischen den „Arbeitnehmern“ um das tägliche Brot (beziehungsweise um einen größeren Anteil an zur Verteilung gelangenden Verbrauchsgütern). In der Übergangsperiode jedoch, wo die Betriebe nicht mehr einen marktwirtschaftlichen Kampf auf Leben und Tod bestehen müssen und ihre Arbeiter und Angestellten von der Arbeitslosigkeit und gemeinhin von der gnadenlosen disziplinierenden Maschinerie des Kapitals frei geworden sind, streiten die Konkurrenten "nur mehr" über die Anpassung der Verteilungsverhältnisse an ihre eigenen Sonderanliegen und um die dazu benötigten gesellschaftlichen Positionen. So lange die per-sönlichen Einkünfte nicht kapitalisiert werden können, besteht das Ziel in der maximalen Anhebung des Verbrauches: "bemühe dich, so wenig wie möglich in den gemeinsamen Topf hineinzuwerfen und so viel wie nur möglich von dort herauszuholen". Die Konkurrenz fördert also nicht die "allgemeine Strebsamkeit" (Marx), sondern wirkt bloß zerstörerisch, verhindert durch das Wiederaufleben der bürgerlichen (bourgeoisen) Denkweise und Moral das Zusammenwachsen der Gemeinschaft, wird zum Nährboden des Bürokratismus in der Lenkung, der gesellschaftlichen Ungleichheit und der Hierarchie.
6. These
In einem kapitalistischen Betrieb gleichen die persönlichen wirtschaftlichen Interessen der im Auftrag des Eigentümers tätigen Chefmanager jenen des Eigentümers, auch wenn sie selbst nicht Eigentümer sind; die Höhe ihres Einkommens wird von ihrem Erfolg bei der Maximierung des Profits bestimmt, der wiederum von der zahlenmäßigen Bewertung durch den Markt abhängt. Darum werden sie - auch wenn sie in ihren Entscheidungen noch so großen Spielraum haben - immer die Interessen des Kapitals zur Geltung bringen (daß sie selbst nicht die Eigentümer sind, macht sie bei weitem nicht zu "Arbeitern"). Bei den staatlichen Betrieben der Übergangszeit besteht eine solche unmittelbare Übereinstimmung der Interessen der mit der Geschäftsführung Beauftragten und des Eigentümers nicht. Eigentümer ist der Staat, der dazu berufen ist, nicht die Interessen eines Einzelbetriebes, sondern im Prinzip jene der gesamten Gemeinschaft zu vertreten; mit diesen jedoch sind die Interessen der einzelnen Unternehmen oder der lokalen Chefs nicht in unmittelbarem und unbedingtem Einklang. Das an die Stelle der Profitinteressen getretene neue System der Anspornung, das die Planerfüllung belohnt, bildet ein eigenartiges Terrain für den Zusammenstoß verschiedener Interessen. Wie sehr auch ein Plan ins Detail geht, - alle Aspekte der Produktion kann er nie umfassen: Er ist immer allgemeiner als die konkreten Vorgänge und bietet dadurch notwendigerweise dem Betrieb und seinen Leitern einen gewissen Spielraum bei seiner Verwirklichung. Wenn die Letzteren - die Beauftragten des Staates - sich als voneinander abgesonderte Privatpersonen verhalten, dann bekommen sie ein Interesse daran, den Plan mit möglichst großem persönlichen Nutzen und dabei mit möglichst wenig Mühe und persönlichen Einsatz zu erfüllen. Zu diesem Zweck können sie die "Informationslücke" zwischen der Betriebsebene und dem höheren Lenkungsniveau (das den Plan vorschreibt) nützen; durch Verheimlichung vorhandener Kapazitäten können sie ihre Verpflichtungen herunterhandeln und die dem Betrieb oder ihnen selbst zugebilligten Zu-wendungen hochtreiben; sie können Produktionsangaben manipulieren, den technischen Fortschritt zurückhalten usw. Dadurch nimmt die relative Unabhängigkeit der Unternehmen und ihrer Manager vom Eigentümer, die im Kapitalismus bloß technischen Charakter trägt, in der Übergangsperiode einen wirtschaftlichen Charakter an - im Maße des ge-genüber der Gemein-schaft und dem Staate ausgeübten privatpersönlichen Verhältnisses - und erwirkt im formell einheitlichen staatlichen Eigentum eine Aufteilung, eine wirtschaftliche Abtrennung.
7. These
Im Maße der Separation treten die staatlichen Unternehmen auch in warenwirtschaftliche Kontakte miteinander, obwohl ja ihre Käufe und Verkäufe - anders als beim Güterumsatz zwischen der staatlichen Industrie und der genossenschaftlichen Landwirtschaft - formell nicht mit einem Besitzerwandel einhergehen. Gänzlich kommen nicht einmal die Produktionsmittel von den Eigenheiten der Ware los. Sogar die Beziehungen zwischen Betrieb und Staat - also dem Eigentümer - sind nicht frei von Zügen des Warenumsatzes: wenn die Erfüllung und Übererfüllung des Plans mit Begünstigungen einhergeht und ohne solche Anreize unterbleiben würde, dann ist dies so, als ob die Unternehmen oder deren Leiter gewisse Mengen von Fertig-erzeugnissen und auch Produktionsgütern dem Staate für Geld übergeben würden. Natürlich sind die Wareneigenschaften der Produktionsmittel wesentlich relativer und auch blasser als jene der Verbrauchsgüter, sie sind aber keinesfalls frei davon: wenn es keinen Wettbewerb um die Verteilung der Verbrauchsgüter gäbe, brauchte man die Herstellung der entsprechenden Menge von Produktionsmitteln nicht mit Geldzuwendungen zu stimulieren.[6]
8. These
Die sich als Privatpersonen verhaltenden Unternehmensleiter hatten ein Interesse daran, sich von einer Kontrolle durch übergeordnete Organe, ganz besonders aber durch die eigenen Unterge-benen frei zu halten. Solch ein Interesse ist Nährboden für Korruption, Interessenverflechtungen, Lobbywesen und Willkür, es begünstigt also jene gefährliche Situation, in der die Werktätigen ihrem Unternehmen gegenüber gleichgültig werden und durch ihre Passivität im Gemeinleben ihren Vorgesetzten die Möglichkeit bieten, ohne Arbeit zu Einkommen zu gelangen und Mehr-produkt anzueignen - über unverdiente Prämien, Privilegien und solche Vorteile, die sich aus einem Verhalten gemäß dem Prinzip "eine Hand wäscht die andere" ergeben. Je gleichgültiger der Arbeiter ist, um so mehr fördert er seine Ausbeutung durch in der Hierarchie über ihn Stehende - was er jedoch dadurch ausgleicht, daß er versucht, das auf eigene Art auf Kosten des Gemeineigentums, zu kompensieren. Wenn diese Haltung Oberhand nimmt, dann wird das gemeinschaftliche Eigentums durch Korruption und Bürokratismus zum Freiwild, dann werden kapitalistische Merkmale der Produktion zu neuem Leben erweckt, die Wirtschaft zur Flaute verurteilt und schließlich das System zu Fall gebracht.
Das Gesagte kann so zusammengefaßt werden, daß vom Kapitalismus - genauer gesagt, vom Zustandekommen der Arbeitermacht - eine mehr oder weniger lange Übergangsperiode zum Sozialismus führt, - ein Übergang, der dem Zeitalter des Sozialismus und des Kommunismus (die jeweils die untere, bzw. Oberstufe darstellen) vorangeht und als geschichtlicher Vorgang der sozialistischen Revolution bezeichnet werden kann. Diese Übergangsperiode kann auch ein höchstentwickeltes kapitalistisches Land nicht überspringen, wenn es den Weg zum Sozialismus beschreitet. (...)
Den Grundwiderspruch des Kapitalismus - die Wurzel und Summe seiner wesentlichsten Be-sonderheiten - sah Engels im Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. Wir sind der Ansicht, daß auch der Übergang seinen eigenen Grundwiderspruch hat, und zwar Folgenden: die Produktivkräfte, die mit ihren Ausmaßen schon die nationalen Grenzen sprengen, verlangen gemeinschaftliche Aneignung, die ihrer Vergesellschaftung entspricht (weil sie im Rahmen des Kapitalismus nicht mehr funktionieren können, ohne daß es immer ver-heerendere Krisen, Kriege, globale Katastrophen gibt), sie sind jedoch noch nicht auf einem solch hohen Entwicklungsstand angelangt (und können ihn im Kapitalismus auch nicht erreichen), bei dem die den bürgerlichen Staat verdrängende sozialistische Staatsmacht mit einem Schlage den Warencharakter der Arbeitskraft, den Markt, die Spontaneität des Wertgesetzes außer Kraft setzen könnte; deshalb stoßen die im Entstehen begriffenen sozi-alistischen Verhältnisse immer wieder auf neu entstehende Tendenzen zur privaten Aneignung, und deswegen entscheidet letztlich der Kampf der beiden antagonistischen Kräfte, ob sich die Gesellschaft in Richtung des Sozialismus oder zum Kapitalismus bewegt.
Die Verwirklichung des Sozialismus setzt voraus, daß infolge der Revolution der Produktiv-kräfte und der Ausweitung der Formen der Selbstverwaltung die Mitglieder der Gesellschaft freiwillig eine ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeitsleistung vollbringen - sich also aus Privatpersonen zu Gesellschafts-Individuen entwickeln. So lange das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft von Privatinteressen dominiert ist, ist es unvermeidlich, daß sich auch die Unternehmen gegenseitig (und auch zum Staate) auf solche Art verhalten - es gibt, mit anderen Worten, einen Fortbestand der wirtschaftlichen Trennung. Diese wird auch im Warencharakter der Arbeit reproduziert - darin also, daß die Arbeit nicht einen unmittelbaren gemeinschaftlichen Charakter annimmt, - und dies macht es unvermeidlich, daß marktwirtschaftliche Beziehungen erhalten bleiben und mit ihnen die Anwendung des Wertgesetzes bei der Aufteilung der gesellschaftlichen Arbeitszeit; dies wiederum gebiert Tag für Tag von neuem kleinbürgerliche Elemente und die Möglichkeit des Wiederauflebens der Bourgeoisie, der Restauration des Kapitalismus. Es wäre leicht, zu sagen, daß man vor der Entstehung des vollen Bestandes der Vorbedingungen einen Übergang zum Sozialismus gar nicht versuchen dürfte; es ist jedoch gerade die Übergangsperiode, die den vollen Kreis der Vorbedingungen schaffen muß - in einem vom Kapitalismus ererbten Umfeld. Wegen des Kampfes zwischen der ihrer Wurzeln noch nicht entledigten kapitalistischen Elemente und der neuen sozialistischen Lebensformen kann der Übergang zu zweierlei Endergebnissen führen, ist also ungewiß - und dies um so mehr, je näher das den Weg der Revolution beschreitende Land zur Peripherie steht, je stärker es international isoliert ist.[7]
2. Teil:
Zur historischen Auswirkung der Differenz zwischen dem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus und dem Sozialismus als Übergangsform zum Kommunismus
So, wie der Kapitalismus erst dann auf eigene Beine kam, als er über das von der ihm vorangegangenen Gesellschaftsform ererbte Handwerkertum hinauswuchs und eine auf dem Einsatz von Maschinen begründete Großindustrie errichtete, muß auch der Sozialismus eine für ihn geeignete technische Produktionsbasis erschaffen, deren Produktivität jene des Kapitalismus übertrifft. Nur auf solch einer Grundlage kann man die wesentlichen Anforderungen des Sozialismus erfüllen und die Bedürfnisse eines jeden Mitglieds der Gesellschaft durchschnittlich besser befriedigen, als dies in führenden kapitalistischen Ländern geschah. Doch trotzdem wird die Verteilung im Sozialismus immer noch nicht unmittelbar von den Bedürfnissen bestimmt, sondern von der Leistung: nach Abzug der gesellschaftlichen Rücklagen bekommt die Person die gleiche Menge vergegenständlichter Arbeit als Verbrauchsgüter zurück wie jene, die er persönlich in lebendiger Arbeit geleistet hat (er arbeitet und leistet nach seinen Fähigkeiten und bekommt gemäß seiner Leistung). Der Austausch gleicher abstrakter Arbeit ähnelt hier formell dem Warenaustausch. In Wirklichkeit jedoch ist es schon etwas anderes: mit der Entstehung des von der Selbstverwaltung der Produzenten geregelten, planmäßig gelenkten einheitlichen gesamtgesellschaftlichen Eigentums erlöschen die Waren- und Geldrelationen, und die Arbeit der Einzelpersonen wird ohne Vermittlung durch den Markt direkt zu einer gesellschaftlichen Leistung.[8]
Da solch eine Umwälzung selbst in den höchstentwickelten kapitalistischen Ländern nicht von einem Tage auf den anderen vollbracht werden kann, muß es einen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus geben. Im Jahre 1847 charakterisierte Engels in seiner Arbeit "Grundsätze der Kommunismus" den Übergang zum Sozialismus als stufenweises Fortschreiten.Nach seiner Meinung ist es ebenso unmöglich, das Privateigentum mit einem Schlage abzuschaffen, wie man auch die bestehenden Produktivkräfte nicht auf einmal soweit vervielfältigen könnte, wie es zur Herstellung der Gemeinschaft nötig sei. Die aller Wahrscheinlichkeit nach eintretende Revolution des Proletariats werde also nur allmählich die jetzige Gesellschaft umgestalten und erst dann das Privateigentum abschaffen können, wenn die dazu nötige Masse von Produktionsmitteln geschaffen sei. Das zur Macht gelangte Proletariat beginnt - sobald es eine demokratische Verfassung erschaffen hat - das Privateigentum einzuschränken: es wird mit pro-gressiven und Erbschaftssteuern belegt und schrittweise enteignet (zum Teil durch Konkurrenz seitens der staatlichen Industrie, zum Teil mit Entschädigungen), die Besitztümer von Rebellen und Emigranten werden beschlagnahmt und eingezogen, usw.. "Alle diese Maßregeln können natürlich nicht mit einem Male durchgeführt werden. Aber die eine wird immer die andre nach sich ziehen. Ist einmal der erste radikale Angriff gegen das Privateigentum geschehen, so wird das Proletariat sich gezwungen sehen, immer weiter zu gehen, immer mehr alles Kapital, allen Ackerbau, alle Industrie, allen Transport, allen Austausch in den Händen des Staates zu konzentrieren. Dahin arbeiten alle diese Maßregeln; und sie werden genau in demselben Verhältnis ausführbar werden und ihre zentralisierenden Konsequenzen entwickeln, in welchen die Produktivkräfte des Landes durch die Arbeit des Proletariats vervielfältigt werden. Endlich, wenn alles Kapital, alle Produktion und aller Austausch in den Händen der Nation zusammengedrängt sind, ist das Privateigentum von selbst weggefallen, das Geld überflüssig geworden und die Produktion so weit vermehrt und die Menschen so weit verändert, daß auch die letzten Verkehrsformen der alten Gesellschaft fallen können.“[9]
Diese Gedankengänge kehren auch im bald danach erschienenen gemeinsamen Werk von Marx und Engels - im "Manifest der Kommunistischen Partei" - wieder: "Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staates, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren und die Masse der Produktivkräfte möglichst rasch zu vermehren. - Es kann dies natürlich zunächst nur geschehen vermittelst despotischer Eingriffe in das Eigentumrechts und die bürgerlichen Produktionsverhältnisse"[10] - mit solchen Maß-nahmen, wie die Enteignung von Grund und Boden, stark progressive Steuern usw. (Unter den Maßnahmen erwähnt das "Manifest" auch "öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder" und neben der Beseitigung der damaligen Form ihrer Fabrikarbeit auch die Verknüpfung von Erziehung mit materieller Produktion.)[11] Die Notwendigkeit eines schritt-weisen Übergangs ist übrigens im einige Jahre früher erschienenen gemeinsamen Buch der beiden Autoren, in der "Deutschen Ideologie" am klarsten begründet. Demnach ist die Ent-faltung der Produktivkräfte deswegen eine unabdingbare Voraussetzung der Aufhebung der Entfremdung (also dessen, daß die Menschen von ihren eigenen Verhältnissen als über ihnen stehenden fremden Mächten nicht beherrscht werden), weil ohne dies "nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße sich herstellen müßte".[12]
Das Gemeinsame in den zitierten Texten ist der Gedanke, daß das Privateigentum Schritt für Schritt zurückgedrängt werden muß, daß es nicht auf einmal abgeschaffen werden kann. Zwecks dieser Einengung empfehlen Marx und Engels solche Schritte, die im Allgemeinen nicht über radikale bürgerliche Forderungen hinausgehen. (Das Eigentum von Aufständischen und Emigranten wurde auch von der französischen Revolution konfisziert; Nationalisierung von Grund und Boden wurde - da ja die Bodenrente die Produktionskosten anhebt - auch von Ricardo und John Stuart Mill empfohlen; für eine Verbindung von Schulbildung und pro-duktiver Arbeit hat sich auch die fortschrittliche bürgerliche Pädagogik eingesetzt; Abschaffung des Erbrechts und eine stark progressive Besteuerung wurde auch vom plebejischen Flügel des Bürgertums verlangt). Ein schrittweises Vorgehen bedeutet in diesen Texten, daß unter einer Arbeiterherrschaft die Einengung des Privateigentums und Vervielfältigung der Produktivkräfte zwei Seiten des gleichen Vorgangs darstellen, denn nur so kann sich die den Reichtum in großen Mengen produzierende Gesellschaft vom Konkurrenzkampf zwischen ihren Mitgliedern freimachen und zu einer Organisation der in ihrem Wesen umgewandelten, kollektivistisch empfindenden Menschen werden - zu einer Gemeinschaft im wahren Sinne des Wortes. Bis die Produktivkräfte solch ein Niveau erreicht haben, wird sich das Wesen des Privateigentums, auch wenn es aufgehoben ist, irgendwie zurückschleichen, - sowohl in die Wirtschaft als auch in die Gemüter, und "die ganze alte Scheiße" stellt sich her. In ihren späteren Werken haben Marx und Engels ein so detailliertes Programm für diesen Übergang nicht entworfen, aber ab 1871 haben sie um so tiefer den politischen Inhalt der Übergangszeit erfaßt. In Verallgemeinerung der Er-fahrungen der Pariser Kommune entwickelten sie als Grundstein ihrer Theorie von Staat und Revolution die Notwendigkeit einer neuartigen Staatsmacht, die mit ihren, die gemein-schaftlichen Funktionen für einen Arbeiter-Arbeitslohn erfüllenden, wählbaren und jederzeit absetzbaren Verwaltungsbeamten und Richtern unter Kontrolle des Volkes steht, auf kommu-nalen Selbstverwaltungen basiert und die nationale Produktion nach einem gemeinsamen Plan steuert. Sie haben auch vorausgesetzt, daß der Übergang eine ganze Epoche in Anspruch nehmen wird, daß die Arbeiterklasse, bis sie ihre eigene Befreiung und damit eine höhere Gesellschaftsform erringt, "lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen hat, durch welche die Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden".[13]
Das frühe Modell des Übergangs, das in den "Grundprinzipien der Kommunismus" und im "Kommunistischen Manifest" dargelegt ist, nimmt offensichtlich keine Kenntnis von irgend-welcher äußerer Einmischung - seine Verfasser gingen ja davon aus, daß die sozialistische Revolution in allen am höchsten entwickelten kapitalistischen Ländern gleichzeitig siegen würde, sie würde also von keiner äußeren Gefahr bedroht. Daher kommt es, daß in diesem Modell die neue Produktionsweise die alte und das gemeinschaftliche Eigentum das Private gewissermaßen durch natürliches Wachstum verdrängen würden, - noch dazu mit einer Entschädigung oder etwa in einem geschäftlichen Wettbewerb, also eben nach den Spielregeln des Kapitals. Die Wirklichkeit hat sich demgegenüber als viel stürmischer erweisen, obwohl sie in vielen Beziehungen - ob nun direkt oder von der Kehrseite her - die Voraussagen von Marx und Engels bestätigt hat.
Die erste Sowjetregierung plante ursprünglich keine völlige und sofortige Enteignung der Bourgeoisie. Sie verstaatlichte nur die Schlüsselsektoren der Wirtschaft und verfügte eine Arbeiterkontrolle der Produktion, nicht zuletzt zu dem Zweck, daß die Werktätigen die Ver-waltung in der Praxis erlernen sollten, bevor sie die Unternehmungen schrittweise in Besitz nehmen würden. Diese Vorstellung wurde von der Sabotage der Kapitalistenklasse, vom Bürgerkrieg, der Intervention, der Not zunichte gemacht; an ihre Stelle trat der Kriegs-kommunismus (das staatliche Monopol des Getreidehandels, die Verstaatlichung der Mittel- und Kleinbetriebe). Als jedoch der Bürgerkrieg sich dem Ende zuneigte, zeigte der wachsende Widerstand des Bauerntums ziemlich bald, daß das Privateigentum nicht vorzeitig abgeschafft werden kann. Vom notgedrungen eingeführten, aber auch durch falsche theoretische Begründungen untermauerten Kriegskommunismus mußte man den Übergang zur neuen Ökonomischen Politik (NEP) bewerkstelligen, die den privaten Handel und das Funktionieren des Privatkapitals gestattete. Mit Hilfe der NEP gelang es, die von Bürgerkrieg zerrüttete Industrie und Landwirtschaft wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Danach begann die Sowjetmacht unverzüglich eine Vermehrung der Produktivkräfte; sie war jedoch - in der Zange des äußeren Drucks und der inneren Schwäche - gezwungen, das Tempo bis ans Letzte zu steigern, was einerseits mit großen materiellen Verlusten einherging, andererseits heftige, manchmal fast bis zum Bürgerkrieg entartende Klassenkämpfe hervorrief. Die Umstände waren keinesfalls mild, und ihrer konnte man nur so Herr werden, daß man von ihnen selbst diktierte Methoden einsetzte (wobei es im Vergleich mit dieser Wirklichkeit nur ein Lächeln erwecken kann, daß die stark progressive Besteuerung und die Abschaffung des Erbrechts von Marx und Engels im Jahre 1847 als "despotische Einmischung" in die bürgerlichen Verhältnisse bezeichnet wurden). Der Wettlauf mit der Zeit, die gnadenlosen objektiven Bedürfnisse der bewaffneten Verteidigung der Revolution und die dadurch benötigte Zentralisierung der Ressourcen bieten die Erklärung dafür, daß der im Modell von Marx und Engels als einheitlich dargestellte Doppelvorgang auseinanderfiel, die Liquidierung des Privateigentums noch vor der Abschaffung des Elends und vor dem Ausbau einer dem Sozialismus entsprechenden Produktivbasis samt dazugehöriger Technik stattfand. Die Wirklichkeit wich also von den früheren theoretischen Überlegungen ab. Es gab jedoch nur eine einzige Alternative zum so erwählten Weg. Die Restauration des Kapitalismus; mit anderen Worten: es bestand, aus dem Blickpunkt der Revolution gesehen, gar keine Alternative.
Unter solchen Bedingungen, die von der ungleichmäßigen Entwicklung des Kapitalismus und von einer Revolution bestimmt werden, welche von einem oder mehreren "schwachen Gliedern" in einer starken feindlichen Umgebung zustande gebracht werden muß, gliedert sich der Übergang notwendigerweise in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt umfaßt die "ursprüngliche Akkumulation" und die Überführung der wesentlichsten Produktionsmittel in staatliches oder genossenschaftliches Eigentum (Errichtung des Fundaments)[14], die Zielsetzung des zweiten Abschnittes jedoch ist der eigentliche Sozialismus, also die Verdrängung der marktwirtschaftlichen Spontaneität durch Planwirtschaft und das Zustandekommen - als Abschluß der Revolution - eines einheitlichen Volkseigentums, einer Selbstverwaltung der Werktätigen, einer klassenlosen (obzwar noch nicht kommunistischen) Gesellschaft. Diesen Vorgang kann man sich generell so vorstellen, daß in der Übergangswirtschaft eine durch die wissenschaftlich-technische Revolution (WTR) ausgereifte Spitzentechnik überwiegt, wodurch sich die Waagschale im Zuge der quantitativen Anhäufung der modernen Produktionsmittel in die Richtung der höchstproduktiven Anlagen und Methoden neigt. Genau so läßt sich die Veränderung auch in Bezug auf die Produktionsverhältnisse beschreiben: im Zuge der täglichen Tätigkeit der Selbstverwaltungen der Werktätigen setzt sich in der Gesellschaft eine gemeinschaftliche Grundhaltung durch und wird ganz alltäglich; die von Privatinteressen diktierte Absonderung wird zurückgedrängt. Das zweite Stadium der Gesellschaft des Über-gangs ist nicht scharf vom Sozialismus (der Unterstufe des Kommunismus) getrennt, sondern geht allmählich in diesen über, so wie sich auch dieser wiederum fortlaufend der Oberstufe nähert - beziehungsweise näher kommen kann, da die Gefahr einer Umkehr nur auf der Oberstufe und mit dem Wegfall einer feindlichen Umgebung endgültig gebannt sein kann.[15]
Es ist ein grober Fehler, wenn die beiden Stufen des Überganges zum Sozialismus nicht auseinandergehalten werden, wenn die Errichtung der Fundamente des Sozialismus mit seiner Vollendung, das staatliche und genossenschaftliche Eigentum an den wesentlichsten Produktionsmitteln mit dem Sozialismus selbst gleichgestellt wird. Solange nämlich weder das Niveau der Produktivkräfte noch der Bewußtseinszustand der Massen die Einführung eines einheitlichen, dem ganzen Volke gehörenden gesamtgesellschaftlichen Eigentums erlauben, durchkreuzen die noch vorhandenen Waren- und Geldverhältnisse - die sich mit der Grundsteinlegung auf gewissen Gebieten sogar noch ausweiten - das sozialistische Prinzip der Verteilung gemäß geleisteter Arbeit und gebären von Neuem privateigentümerische Bestrebungen, Möglichkeiten einer verdeckten Aneignung des Mehrwerts, - Keime einer Restau-ration. Diese eigenartige Aneignung und Expropriation beruht nicht auf einem Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern auf den von Personen in der Machthierarchie und in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung eingenommenen Positionen, sowie auf wirtschaftlichen Mißverhältnissen (auf dem relativen Mangel an Produkten und Leistungen) und wird durch Kanäle einer Umverteilung bewerkstelligt - entweder gesetzwidrig (Korruption, Diebstahl), oder auch legal (Verflechtungen, Lobbies, Zuwendungen, Privilegien); ihr Maß hängt vom Kräfteverhältnis der Produzenten und der Expropriierenden ab, ihre Verteilung von den Kräfteverhältnissen der es sich Aneignenden. Deswegen muß man in der Übergangsperiode neben der ihrer Herrschaft beraubten Bourgeoisie auch mit einer knospenden neuen Bourgeoisie rechnen, die von der eigenen Produktionsweise der neuen Formation, von ihren eigenen Waren- und Geldverhältnissen hochgezüchtet wird (zum Teil aus den Oberschichten von Arbeitern und Bauern, die jetzt die politische Basis der Macht bilden). Diese Periode unterscheidet sich qualitativ vom Sozialismus durch jene Besonderheit, daß sie doppelgesichtig ist, daß hier noch ein "wer wird Oberhand nehmen?" wirksam ist. Ob schließlich die sozialistische oder kapitalistische Entwicklungsrichtung siegt, wird vom Klassenkampf bestimmt.
Die Übergangsformation ist also auch nach der Errichtung ihres Fundaments ein Kampffeld zweier antagonistischer wirtschaftlicher Grundeinstellungen, die jeweils den Interessen des Proletariats bzw. der Bourgeoisie entsprechen und wo entweder der Plan über den Markt Oberhand gewinnt und ihn schließlich hinausdrängt, - oder eben anders herum. (So wie der Markt in gewissen Grenzen in den Dienst des Plans gestellt werden kann, so kann auch der Plan zum Mittel der Durchsetzung der Privatinteressen von Einzelpersonen, Gruppen, Lobbies werden). Die Entwicklung umfaßt alternative Möglichkeiten, sie kann entweder voranschreiten - zum Sozialismus - oder auch rückläufig werden: zur Restauration des Kapitalismus. Die sozialistische Ausrichtung - die Logik des Plans - wird von der Tatsache begünstigt, daß mit der Umwälzung der Eigentumsverhältnisse die Revolution im Volke gewaltige Kräfte freisetzt und Bedingungen für eine konzentrierte, planmäßige Nutzung der Ressourcen schafft; diese Möglichkeit hat sich im beispiellosen Elan und der Geschichte machenden Errungenschaften der Anfangsperioden der bisherigen Übergangsformationen bewiesen. Die kapitalistische Ausrich-tung - die Logik des Wertgesetzes - wird durch den Umstand begünstigt, daß mit dem Warencharakter der Arbeitskraft auch die wirtschaftliche Trennung der Wirtschaftseinheiten neu entsteht, aus der die kapitalistischen Merkmale der Produktionsverhältnisse von Neuem geboren werden können; diese Entwicklungsmöglichkeit hat sich als Bürokratisierung der Planwirtschaft und danach im Reformismus erwiesen, der eine Öffnung zur Marktwirtschaft erreichen will.
Die Zwiespältigkeit der Möglichkeiten kann, aus politischem Blickwinkel gesehen, als Labilität der Arbeitermacht bezeichnet werden. Eine beliebige andere politische Macht kann als gefestigt betrachtet werden, sobald sie ihren Staatsapparat, also die zum Schutz der inneren Ordnung bestimmten Macht- und Verwaltungsorgane ausgebaut hat; für die Arbeitermacht reicht dies nicht aus, ihre Festigkeit setzt eine ganz besondere Beziehung zwischen den Massen und den Staatsorganen voraus. Solange solche Organe existieren - und bis zum Absterben der Klassenunterschiede müssen sie unabdinglich bestehen bleiben -, werden sie auch Sonder-interessen haben, die je nach den Umständen auch auf Kosten der Massen zur Geltung gebracht werden können. Darum sprach Lenin davon, daß die Arbeiterklasse gegen ihren eigenen Staat geschützt werden muß.[16] Die beste Möglichkeit für so einen Schutz bietet eine Mobilisierung der Massen zur Selbstverteidigung, zur Kontrolle des Staatsapparats, der Lenkung der Wirt-schaft, des gesamten gesellschaftlichen Lebens, zum Abbau der wechselseitigen Entfremdung von Staat und Gesellschaft. Hier dreht es sich nicht um jene bürgerlich-demokratische Forderung nach Stärkung der "Zivilgesellschaft" gegenüber dem Staate, durch die deren Trennung voneinander anerkannt wird, sondern um die sozialistische Forderung nach einer Vergesellschaftung des Staates, um den Kurs in Richtung einer Selbstverwaltung, die in der Übergangszeit gerade das Gegenteil, den Abbau der obigen Trennung anstrebt. Die Festigkeit der Arbeitermacht hängt davon ab, ob es solch eine Massenbewegung gibt, die eine Streichung aller Privilegien, eine volle Offenlegung aller Einkommen, Zuwendungen, Repräsenta-tionskosten sichern kann, sowie die sinnvolle, wirtschaftliche Organisation der Arbeit, eine Verteilung gemäß erbrachter Leistung, einen wirksamen Kampf gegen Lobbies und Maffiaclans, gegen Schwagerwirtschaft, Bürokratismus, Korruption, Diebstahl und Verschwendung, für gerechte Regelung sozialer Angelegenheiten, für eine echte Selbstverwaltung am Wohnort - mit einem Wort all das, was man als reelle Vergesellschaftung oder, solange der Staat nicht abgestorben ist, als sozialistische Form der Demokratie bezeichnet.[17] Dies ist ganz offen-sichtlich nicht ein einmaliger Akt, sondern ein Vorgang, eine ständige, systematische Tätigkeit. Es reicht nicht, die Arbeitermacht einmal zu erobern: die Massen müssen sie selbst Tag für Tag immer wieder von neuem erringen, zu ihrer allgemeinen Interessenvertretung, ihrem Kampfwerkzeug machen. Andere Arten von Staaten - mögen sie auch ihre Entstehung und Festigung einem Kampf der Volksmassen verdanken - entfremden sich nach ihrer Festigung schon von ihrer Wesensart her von den Massen und agieren als über ihnen stehende Mächte; der sozialistische Staat hingegen kann auf längere Dauer nur als Organ der demokratischen Massenbewegung bestehen. Und wenn er sich den Massen entfremdet, wenn er sich ihrer Kon-trolle entzieht, verurteilt er die Massenbewegung zu Zwecklosigkeit und Verdorrung, er selbst aber hört mit der Zeit unweigerlich auf, ein sozialistisches Gebilde zu sein. In diesem Sinne kann die sozialistische Revolution als permanent bezeichnet werden. Nur diese neue Art von Klassenkampf, diese in marxistischem Sinne beständige, permanente Revolution kann in der Übergangszeit Bürokratismus und bürgerliche Tendenzen im allgemeinen zurückdrängen und die Massen schulen, ihre eigenen objektiven Interessen zu erkennen und zur Geltung zu bringen.
Die Erstellung der Fundamente wurde von der offiziellen Ideologie der einst sozialistischen Länder so definiert, daß die Produktionsverhältnisse schon das sozialistische Niveau erreicht hätten und daß im weiteren nur noch die Produktivkräfte und der Überbau zu dieser Höhe aufschließen müßten. Damit nahm man nicht zur Kenntnis, daß zur Erreichung des Sozialismus auch auf dem Terrain der Produktionsverhältnisse eine neuerliche Wende, eine neue qualitative Umstellung nötig ist, sonst kommt es zu Stockungen in der Wirtschaft - die immer weniger von der Planung mit detaillierten Anweisungen aus einer einzigen Zentrale gesteuert werden kann -, und zur Geltung kommen zwei gegensätzliche, aber zusammengehörende Formen der Spontaneität: von "links" der bürokratische Charakter der Lenkung, von "rechts" die im Verborgenen waltende "verdunkelte" Privataneignung. Das Wesen der benötigten Wende zum Sozialismus besteht in der schrittweisen Heranbildung der Einstellung der Massen als Gemeineigentümer, was nicht einfach eine Veränderung im gesellschaftlichen Bewußtsein, also im Überbau ist, sondern eine neue Art von Produktionsbeziehungen, ein neuartiges Verhältnis der Produzenten zueinander und zu ihren Produktionsmitteln. In früheren Formationen hat das gesellschaftliche Bewußtsein gewisse Produktionsverhältnisse bloß widergespiegelt und verteidigt oder attackiert, nicht aber ihr Wesen bestimmt: die fanatisch religiöse Überzeugung der englischen Puritaner, der aufrechte Glauben der französischen Revolutionäre an die dreieinige Parole der Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit, das gesamte antifeudalistische ideologische Arsenal des Bürgertums war unerläßlich notwendig, um die bürgerliche Ordnung an die Macht zu bringen, bestimmte aber trotzdem nicht die wirtschaftlichen Grundlagen dieser Gesellschaft, das Verhältnis zwischen Kapital und Lohnarbeit. Demgegenüber kann die wirtschaftliche Grundlage des Sozialismus nur dann verwirklicht werden, wenn das kollektive Eigentümerbewußtsein der Massen in den diversen Formen der demokratischen Selbst-verwaltung und Kontrolle, in der ständigen Praxis des gemeinschaftlichen Eigentümerwesens zur materiellen Kraft wird, zum bestimmenden Element der Produktionsverhältnisse. Ohne das kann man nicht von sozialistischen Produktionsverhältnissen reden.
Ein Gemeineigentümer-Bewußtsein der Massen kann sich bloß dann formieren, wenn die sozialistische Demokratie in der Tat praktiziert wird. Zum Wesen der bürgerlichen Demokratie gehört auch ihr rein formeller Charakter. Wenn jedoch die sozialistische Demokratie zur Formsache wird, wenn ihre Institutionen nur auf dem Papier existieren, ihre praktische Tätigkeit jedoch durch den Widerstand der bezahlten Beamtenschaft auf Grund läuft, dann werden sich die Massen nicht dessen bewußt, daß sie ja die Eigentümer sind. Die Erfahrungen zeigen, daß eine revolutionäre Umgestaltung des Bewußtseins eine grundlegende Reform jenes Lenkungs-apparates verlangt, der für die Zwecke der ersten Stufe des Übergangs ausgebaut wurde - mit einer aus geschichtlichen Gründen stark zentralisierten Struktur. Andererseits jedoch kann die Reform auch nicht ohne eine organisierte Unterstützung seitens der Massen durchgesetzt werden: sie setzt die Aktivität der Massen voraus - ebenso, wie die Aktivität der Massen eine Reform voraussetzt. Dies ist wieder mal ein Teufelskreis, der von einer revolutionären Avantgarde durchbrochen werden muß, von einem Vortrupp, der die Massen für die demokratische strukturelle Reform und zur Ausübung ihrer Macht mobilisieren kann. Wenn eine solche Partei nicht vorhanden ist, wird die sozialistisch ausgerichtete Planung von den beiden schon erwähnten Formen der Spontaneität untergraben und zurückgedrängt, und damit beginnt ein Erstarken kapitalistischer Elemente der Produktionsverhältnisse der Übergangszeit - auf Kosten der sozialistischen Elemente. Deshalb kann eine Systemumkehr auch "friedlich" erfolgen: die Formation wechselt ganz einfach in die Richtung, noch bevor die Bourgeoisie sich auch "offiziell" als Inhaberin der Macht deklariert. Die Möglichkeit einer solchen alternativen Entwicklung ergibt sich allein schon aus dem Wesen des Überganges, aus dem immanenten inneren grundlegenden Widerspruch, der sich nur in dieser Formation manifestiert - weder im Kapitalismus noch im Sozialismus, sondern nur im Übergang zum Sozialismus. Die Formation ist in ständiger Bewegung, ihre sozialistischen oder kapitalistischen Elemente gewinnen oder verlieren an Spielraum je nachdem, wie sich der Klassenkampf entwickelt, und sofern ihre quantitativen Änderungen einen kritischen Punkt erreichen, verändert sich sprunghaft die Art der Gesellschaftsordnung.
Obwohl diese Übergangszeit kein Sozialismus ist, kann sie nach ihrer Tendenz doch in jenem Maße als sozialistisch bezeichnet werden, wie sie den folgenden Minimalkriterien entspricht: sie läßt keine politische Wendung zum Kapitalismus aufkommen; indem sie sich auf das staatliche und genossenschaftliche Eigentum stützt, sichert sie der Planwirtschaft einen Vorrang gegen-über der Marktwirtschaft; sie schafft soziale Sicherheit und Möglichkeiten für einen kulturellen Aufstieg breiter arbeitender Massen; sie betreibt eine antiimperialistische Außenpolitik und unterstützt fortschrittliche Bewegungen in der ganzen Welt. Darüber hinaus besitzt der sozialistische Kurs auch noch einige zuverlässige negative Merkmale und Maßstäbe: a) Anhänger von "Reformen" sind gezwungen, diese ihre Forderungen mit marxistisch klingenden Tiraden zu maskieren - so, als ob sie bestrebt wären, bloß eine Wiederherstellung des echten Sinnes der marxistisch-leninistischen Ideen zu erringen und die wahre Art des Sozialismus wieder zur Geltung zu bringen. (Im Maße des Voranschreitens einer Restauration wischen sie den "marxistischen" Farbauftrag von ihren rechtsgerichteten Forderungen wieder weg). - b) Das Maß der sozialistischen Ausrichtung läßt sich daran erkennen, wie sich der Imperialismus dazu verhält: je nach Bewertung der geschichtlichen Aussichten kann dies von blindwütiger Feindseligkeit bis zu einem "wohlgesinnten Verständnis" und Lob oder sogar zu einer enthusiastischen (allerdings nicht sehr freigiebigen) Unterstützung reichen. - c) Der wütende Antikommunismus siegreicher Gegenrevolutionen, der oft auch vor traditionell bürgerlichen Errungenschaftswerten nicht halt macht, beweist von der Kehrseite her, daß die gestürzten Regimes mehr oder weniger sozialistisch ausgerichtet waren - zumindest in dem Maße, in dem sie die oben angeführten Wesenszüge aufweisen konnten.
Wenn sich in einer Übergangsformation die Richtung der Entwicklung umkehrt und die kapitalistischen Elemente zu erstarken beginnen, behält das System eine Zeit lang immer noch minimale Charakterzüge seiner ursprünglich sozialistischen Ausrichtung. Dies läßt sich zum einen dadurch erklären, daß infolge der formellen Vergesellschaftung des Eigentums der von Einzelpersonen angeeignete Mehrwert meistens nur als dem Verbrauch dienendes Einkommen genutzt werden bzw. nur in sehr engen Grenzen zu Kapital werden kann; für größere Investitionen würde es anfänglich sowieso nicht ausreichen. Jene Aneigner, die eine Ausbeutung auf dem Umwege über das staatliche und genossenschaftliche Eigentum betreiben, sind im Allgemeinen daran interessiert, daß das System erhalten bleibt - sie leben ja davon, und eine Wiederherstellung des Kapitalismus würde sie der gesellschaftlichen Grundlagen ihrer Existenz berauben. Sie sind also an der Legitimierung des Systems interessiert, an der Erhaltung seiner Massenbasis, aber auch daran, solche Veränderungen abzuwehren, die ihre Privilegien ge-fährden könnten. Dieses zwiespältige Interesse motiviert sie einerseits, Gegner sowohl von links als auch von rechts zum Schweigen zu bringen (ein "Zweifrontenkampf"), aber auch dazu, als Verbündete solche aufrichtigen Anhänger des Sozialismus zu gewinnen, die sich mit Kritik - schon wegen der ihnen eingeimpften Parteidisziplin - zurückhalten und keine grundlegenden Änderungen anstreben, wodurch dann jenes Minimum der sozialistischen Ausrichtung des Systems erhalten bleiben kann, das ihre privilegierte Situation nicht gefährdet oder dazu gar notwendig ist. Wenn jedoch in Ermangelung eines aktiven Widerstandes die verdeckte Aus-beutung vorangeht und sich ausweitet, so muß unweigerlich ein Zeitpunkt eintreten, wo die quantitative Anhäufung von Vermögen nach einer qualitativen Änderung verlangt, nach einem Spielraum für Kapitalanlagen - und auf eine dementsprechende politische Wende drängt.
Dies ist in der Sowjetunion und in den mit ihr verbündeten Staaten eingetreten. Diese Länder waren so weit gekommen, die Fundamente des Sozialismus zu errichten, die Tendenz ihrer Entwicklung war - im Lichte der oben angeführten Kriterien - überwiegend sozialistisch; und dies wurde auch nach der Kursänderung noch eine Zeit lang beibehalten. Doch schließlich gelang es dem neu entstehenden Bürgertum, mit aktiver imperialistischer Hilfe einen Durchbruch zu erzwingen.
Ervin Rosznyai, Budapest
Kurt Gossweiler:
Brief an Ervin Rozsnyai, Februar 2005
Lieber Genosse Ervin,
eigentlich wollte ich Dir meine Glückwünsche zum neuen Jahr rechtzeitig, wenigstens noch im Januar abschicken, aber aus den verschiedensten Gründen kam ich nicht rechtzeitig dazu, deshalb hole ich dies mit diesem Brief nach. Wie ich vom Genossen Kornagel weiß, kannst Du Glückwünsche, vor allem wirkungsvolle, sowohl im Hinblick auf die Gesundheit wie auch für den Erfolg der politischen Arbeit, dringend gebrauchen; leider verfüge ich aber nicht über die Fähigkeit, meinen Wünschen eine besondere Wirkungskraft mitzugeben.
Ja, entgegen meinen hoffnungsvollen Erwartungen sind wir noch immer nicht am Tiefpunkt der opportunistischen Versumpfung in der kommunistischen Bewegung in Europa angekommen. Ich hatte erwartet, dass der massive Kapitalsangriff und der radikale Sozialabbau dazu führen würden, dass in den Massen in den ehemals sozialistischen Ländern immer mehr die Erkenntnis um sich greifen würde, dass die Welt, in der sie lebten, die bessere Welt war, eine Welt, in der die Politik – mehr oder minder – an ihren Interessen, an den Interessen der Werktätigen, ausgerichtet war, dass sie begreifen würden, was sie preisgegeben haben bzw. was ihnen genommen wurde.
Und in der Tat ist ein solches Bewußtsein ja „unten“ durchaus im Wachsen. Vielleicht gerade deshalb aber wächst bei den versumpften Führungen der Hass auf die sozialistische Ver-gangenheit und werden ihre Angriffe auf sie und ihre Anstrengungen, ihren Hass auch in die Massen zu tragen, immer aggressiver. Sie nutzen ganz bewußt das Dilemma aus, in der sich die marxistisch-leninstischen Kräfte befinden: Angesichts der Übermacht der Kapitalseite ist die Herstellung der Einheit auf der Gegenseite die dringendste Aufgabe, aber um zu einer wirklich kämpfenden Aktionseinheit zu kommen, müssen die opportunistischen Bremser und Ver-hinderer dieser kämpfenden Aktionseinheit beim Namen genannt werden – was diese natürlich, wo es erfolgt, als sektiererisches Spaltertum denunzieren. Wir müssen aber dennoch beides tun – uns als Vorkämpfer der einheitlichen Kampffront beweisen und zugleich klug und gut überlegt aufklären, wer diese Einheitsfront be- und verhindert, und wie, mit welchen Mittel und auf welchen Wegen.
Wie schwierig das in der Praxis ist, sehen wir in Frankreich, und in der Bundesrepublik in der DKP. Ganz untauglich ist für mich der Weg, den die „Kommunistische Plattform“ in der bereits durch und durch sozialdemokratisierten PDS geht. In dieser Partei zu bleiben, um „noch Schlimmeres zu verhüten“, ist die berüchtigte „Kleinere Übel“-Politik in Reinkultur; für mich ist unbegreiflich, wie so kluge Genossinnen, wie Sahra Wagenknecht und Ellen Brombacher nicht begreifen, dass sie von der Führung ganz bewußt als Feigenblatt, d.h. dazu benutzt werden, möglichst viele Kommunisten in der PDS festzuhalten, damit es zu keiner Bildung einer zahlenmäßig gewichtigen kommunistischen Partei in der BRD kommt.
Mit großer Anteilnahme verfolge ich den hartnäckigen und keineswegs aussichtslosen Kampf der Genossen der „Kommunistischen Initiative zur Erneuerung der KPÖ“ in Österreich. Ich nehme an, Du kennst und erhältst ab und zu die „nVs“; die neue Volksstimme.
Kürzlich erhielt ich die Diskette mit Deinem Aufsatz „War es Sozialismus oder etwas anderes?“ Danach geht es dir darum, festzustellen: Was in der Sowjetunion und in den sozialistischen Staaten Europas untergegangen ist, das war noch nicht eine sozialistische Ordnung, sondern eine Gesellschaft, die sich in einem Übergangsstadium zum Sozialismus befand; das war also nicht, wie bisher gemeint, die von Karl Marx als „Erste Phase des Kommunismus“ bezeichnete, sozialistische Stufe der Entwicklung zur klassenlosen, kommunistischen Gesellschaft, sondern eine von Marx und Engels nicht vorausgesehene, zum Sozialismus als der 1. Phase nach der proletarischen Revolution erst hinüberleitenden Übergangsperiode, die sich qualitativ vom Sozialismus unterscheidet.
Du führst aus, dass es falsch wäre, die Reproduktion kapitalistischer Elemente in der Übergangsperiode mit den von Marx genannten „Muttermalen der alten Gesellschaft“ zu erklären bzw. sie als solche Muttermale anzusehen. Diese von Marx und Engels nicht vorhergesehene Übergangsperiode sei deshalb historisch notwendig geworden, weil die pro-letarische Revolution nicht, wie von ihnen erwartet, zuerst in den entwickeltsten kapitalistischen Ländern, sondern im kapitalistisch unterentwickelten Rußland siegte.
Ähnlichen, in der gleichen Richtung liegenden Überlegungen bin ich schon früher begegnet. Und sie haben auf den ersten Blick auch viel für sich. Bevor ich meine Einwände dagegen vorbringe, möchte ich aber sagen, dass ich zu denen gehöre, die keinen bedeutsamen Nutzen einer Diskussion darüber, ob wir das, was wir hatten, als „Übergangsperiode zur 1. Phase“ oder als „erste Phase“ betrachten, zu erkennen vermag. Warum nicht?
1. Marx spricht davon, dass die neue Gesellschaft „in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig“ noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft.
Du hast sehr eindrucksvoll herausgearbeitet, welche Gefährdungen für die Errichtung einer sozialistischen Ordnung die ökonomische Rückständigkeit Rußlands in sich barg.
Du selbst weist aber am Schluß Deines Aufsatzes auch darauf hin, dass auch in den „Zentren“ – in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern - eine – wie Du sagst – Übergangsperiode notwendig sein würde. Damit verlieren aber die Besonderheiten der Bedingungen im rückständigen Rußland ein gut Teil ihres Gewichtes, das Du ihnen im Falle Rußlands als Verursacher des Rückfalls in den Kapitalismus beigelegt hast, denn sie - Warenproduktion, Markt, Geld, Wert - sind eben keine spezifischen Besonderheiten rückständiger Länder mehr, sondern unvermeidliche Muttermale aller Länder, die zum Sozialismus übergehen. Und welche Schwierigkeiten aus den „sittlichen und geistigen Muttermalen“ für den Aufbau der neuen Gesellschaft in den Ländern hervorgehen werden, in denen das Denken und Fühlen in den Kategorien der kapitalistischen Gesellschaft viel tiefer verwurzelt ist, weil es im Gegensatz zu Rußland seit über hundert Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wurde, - das kann jetzt noch gar nicht ermessen werden.
Damit will ich überhaupt nichts gegen die Feststellung sagen, dass es viel schwieriger ist, eine sozialistische Ökonomie in einem kapitalistisch unterentwickelten Lande zu verwirklichen, als in einem kapitalistisch hochentwickelten. Meine Einwände richten sich nur dagegen, aus solchen Schwierigkeiten abzuleiten, nicht den ganzen Abschnitt vom Sieg der sozialistischen Revolution und der Periode der NÖP an bis zum voll entwickelten Sozialismus, also bis an die Schwelle des Überganges zur zweiten Phase, als erste, sozialistische Phase zu betrachten, sondern nur den Abschnitt von – ja, von wann eigentlich, von der Verstaatlichung der entschei-denden Unternehmungen in Industrie, Handel und Verkehr und des Beginns der Kollektivierung in der Landwirtschaft an, oder erst ab der völligen Liquidierung auch des kleinsten Einzel-handels- oder Handwerksbetriebes und der Verwandlung auch des genossenschaftlichen Eigen-tums in gesamtgesellschaftliches Eigentum?
2. Die NÖP in der Sowjetunion wurde von nicht wenigen als eine spezifisch russische, durch die Rückständigkeit des Landes notwendig gewordene Wirtschaftspolitik betrachtet. Stalin war da ganz anderer Ansicht. Ich zitiere dir sicher Wohlbekanntes aus seiner Rede auf dem Juli-Plenum von 1928: „Können die kapitalistischen Länder, zumindest die entwickeltesten von ihnen, beim Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ohne die NÖP auskommen? Ich denke, sie können das nicht. In diesem oder jenem Grade ist die Neue Ökonomische Politik mit ihren Marktbeziehungen und der Ausnutzung der Marktbeziehungen in der Periode der Diktatur des Proletariats für jedes kapitalistische Land absolut unerläßlich. Bei uns gibt es Genossen, die diese These in Abrede stellen. Was bedeutet es aber, diese These in Abrede zu stellen? Das bedeutet erstens, davon auszugehen, daß wir unmittelbar nach Machtantritt des Proletariats bereits über hundertprozentig fertige, den Austausch zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie und Kleinproduktion vermittelnde Verteilungs- und Versorgungsapparate verfügen würden, die es ermöglichen, sofort einen direkten Produktenaustausch ohne Markt, ohne Warenumsatz, ohne Geldwirtschaft herzustellen. Man braucht diese Frage nur zu stellen, um zu begreifen, wie absurd eine solche Annahme wäre. Das bedeutet zweitens davon auszugehen, daß die proletarische Revolution nach der Machtergreifung durch das Proletariat den Weg der Expropriation der mittleren und kleinen Bourgeoisie beschreiten und sich die ungeheuerliche Last aufbürden müsse, den künstlich geschaffenen Millionen neuer Arbeitsloser Arbeit zu beschaffen und für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Man braucht diese Frage nur zu stellen, um zu begreifen, wie unsinnig und töricht eine solche Politik der proletarischen Diktatur wäre. ... Hieraus folgt aber, daß die NÖP in allen Ländern eine unvermeidliche Phase der sozialistischen Revolution bildet.“
Für mich ist das sehr überzeugend. Das bedeutet, dass jedes Land nach der proletarischen Revolution mit den Problemen der Warenproduktion, des Marktes, des Geldes und des Wertes zu tun haben wird, und dass alles, was sich daraus als Folgen entwickelt, auch die Reproduktion kapitalistischer Beziehungen, Folgen der Muttermale der alten Gesellschaft ist. Es besteht des-halb meiner Ansicht nach kein Grund, diese Phase der Entwicklung als eine Übergangsperiode von der ersten, der sozialistischen Phase der neuen kommunistischen Gesellschaft loszutrennen.
Ich denke, wir sind uns darin einig, dass der Untergang der Sowjetunion und ihrer europäischen verbündeten seine Ursache hat in dem Sieg des Revisionismus in der KPdSU und in einigen anderen kommunistischen Parteien. Die große Frage dabei ist: Wer sind die sozialen Träger der Verwandlung der marxistisch-leninistischen Parteien in revisionistische Parteien? Als Marxisten gehen wir – wie Du es ja in Deinem Aufsatz auch tust – davon aus, dass die Überbauerscheinungen ihre Grundlage in der ökonomischen Basis haben. Wir lehnen Erklä-rungen ab, die darauf hinauslaufen, dass „Männer die Geschichte machen.“ Für uns können also nicht ein Chruschtschow und ein Mikojan, ein Andropow und ein Gorbatschow, ein Gomulka und ein Imre Nagy bzw. Kadar die Partei von einem leninistischen auf einen revisionistischen Kurs führen ohne einen bestimmten sozialen Rückhalt. Die größte Schwierigkeit für mich besteht aber darin, die sozialen Schichten zu bestimmen, die diesen Rückhalt bildeten und deren Interessenvertreter die führenden Revisionisten waren.
Beim „alten“ Revisionismus war das ziemlich einfach: Bernstein usw. waren Sprecher der im Imperialismus aufkommenden Arbeiteraristokratie.
In Analogie dazu sagst Du, dass sich in der Übergangsperiode eine neue kapitalistische Klasse zu einer selbständigen politischen Kraft herausgebildet hat, die unter der Maskierung als Kämpfer für die Erneuerung des Sozialismus den Kampf um die Macht begann. Was Ungarn und Polen betrifft, mag das so zutreffen. Allerdings hätte ich da gerne statistische Angaben über die soziale Struktur und deren Wandel im Laufe der Jahre. Aber sowohl für die Sowjetunion – wenigstens in der Chruschtschow- und der frühen Breshnew-Ära - wie auch für die DDR sehe ich die Stützen und Parteigänger der „Liberalisierung“ und „Entdogmatisierung“ des Sozia-lismus – (ich bleibe bei diesem Terminus aus den oben angeführten Gründen) – nicht in kapitalistischen Elementen, sondern in bestimmten Teilen des Partei- und Staatsapparates (eingeschlossen Wirtschaftsleiter, Außenhändler, Diplomaten u.a.), ferner in der Intelligenz, be-sonders unter den Journalisten, bei Ökonomen, Gesellschaftswissenschaftlern und im kulturellen Bereich; wobei ich den Anteil derer, die schon vor dem 20. Parteitag zu derartigen Tendenzen neigten, für sehr gering halte; nach dem 20. Parteitag aber wuchs ihre Zahl mit der Festigung der Macht Chruschtschows progressiv an. Vor allem aber wuchs nach dem 20. Parteitag eine Generation heran, die ganz und gar im Geiste des Revisionismus und des Anti-Stalinismus erzogen war. Die soziale Basis des Revisionismus war vor dem 20. Parteitag keineswegs so stark, dass sie in Partei und Staatsapparat dominierte, weder in der Sowjetunion, noch bei uns, und - nach meiner Kenntnis - nicht einmal in Polen und Ungarn.
Wenn ich mir die Chronologie und die Geographie der Ausdehnung des Revisionismus in der kommunistischen Bewegung vor Augen führe, komme ich nicht umhin, festzustellen, dass seine Verbreitung „unten“ erst dann an Gewicht gewann, als sie von oben her betrieben und die revisionistischen Thesen zur offiziellen Parteilinie erklärt wurden, und ferner, dass dem ein Führungswechsel vorausging, der in der Sowjetunion mitunter staatsstreichartig abgesichert wurde, und der in einigen Bruderländern durch indirekte (Polen) oder direkte (Ungarn) Einwirkung von außen bewirkt bzw. erzwungen wurde. Ich erspare mir in diesem Brief eine lange Liste von Belegen, weil sie in Arbeiten zu finden sind, die ich Dir schon schickte, wie etwa in dem Protokollband der Konferenz vom 20./21. November 1999: „Auferstanden aus Ruinen“ und dem Heft 10/03 von „Offensiv“, „Die Ursprünge des modernen Revisionismus“, und natürlich in der Taubenfuß-Chronik, und beschränke mich auf einige wenige aus den Jahren 1953-56. In den genannten Aufsätzen habe ich auch ausgeführt, welchen berechtigten Wünschen und Sehnsüchten in den Völkern die Revisionisten zu entsprechen vorgaben, um sich eine breite Massenbasis zu sichern: erstens den Wunsch nach Frieden, die Furcht vor dem Atomkrieg, zweitens den Wunsch nach einer Beendigung der Zeit des Mangels, nach gesicherter Versorgung und einer deutlichen Verbesserung des Lebensstandards. Aber weder die Friedens-demagogie noch die Phrasen vom „nahen Erreichen der lichten Höhen des Kommunismus“ waren ausreichend, die Massen und schon gar nicht die Mitglieder der KPdSU und ihres Zentralkomitees zu einer blinden, kritiklosen Gefolgschaft zu verführen oder sie einfach zu lähmen. Dazu musste ein Mittel gesucht und ge- bzw. erfunden werden, das geeignet war, die bisher unerschütterliche Überzeugung aller Sowjetmenschen, aller Kommunisten in der ganzen Welt und darüberhinaus der ehrlichsten und klügsten fortschrittlichen Bürger zu erschüttern und ins Wanken zu bringen, - die Überzeugung, die Georgi Dimitroff im Reichstagsbrandprozess dem vor Wut schäumenden Faschistenhäuptling Göring mit den Worten entgegenrief: „Diese Sowjetunion ist das größte und beste Land der Welt!“
Dieses Mittel war die Verteufelung des Führers dieses besten Landes der Welt und seiner führenden Partei, Stalins. Sie erfolgte auf dem 20. Parteitag der KPdSU, – jetzt also nicht mehr, wie bisher gewohnt, von einem Sowjetfeind aus dem Lager des Imperialismus oder anderer Feinde der Sowjetunion, sondern von Stalins Nachfolger Chruschtschow, - dem jahrzehnte-langen Mitarbeiter und eifrigsten Mitschöpfer des „Personenkults“ um Stalin.
Die Verurteilung Stalins auf dem Forum des höchsten Organs der führenden Partei der kommu-nistischen Weltbewegung durch den Führer eben dieser Partei als „blutgierigen Massenmörder aus purem Streben nach Erhalt seiner persönlichen Macht,“ als des Mannes, der „alle alten Mitkämpfer Lenins und mehr Kommunisten als sogar Hitler“ habe liquidieren lassen – diese wohlgezielten giftigen Lügen haben mehr als alles andere, entschieden mehr auch als die Auswirkungen aus der ökonomischen Basis der sozialistischen Staaten auf ihren Überbau, zur Desorientierung, Verwirrung und Lähmung der Parteimitglieder und der Massen und damit zum Sieg des Revisionismus in der Sowjetunion und in den sozialistischen Ländern Europas und in den meisten kommunistischen Parteien der Welt beigetragen. Du kannst das auch heute noch täglich daran messen, dass selbst jene, die zeitweilig in Gorbatschow den Retter des Sozialismus sahen, inzwischen aber, weil sie Kommunisten geblieben sind, diesen Gorbatschow als Zerstörer der Sowjetunion verfluchen, dennoch den XX. Parteitag und Chruschtschow bejahen – eben weil er Stalin verurteilt hat.
Wie - leider richtig vorausschauend - die andere Seite Chruschtschows Stalin-Verdammung beurteilt hat, habe ich schon oft am Beispiel der Äußerung des US-Außenministers J. F. Dulles vorgeführt, der am 11. Juli 1956 voller Zuversicht in einer Rede sagte, „die Anti-Stalin-Kampagne und ihr Liberalisierungsprogramm“ hätten eine Kettenreaktion ausgelöst, die auf lange Sicht nicht aufzuhalten sei. - Wo der Mann leider Recht behalten hat, muß man ihm recht lassen.
Lieber Ervin, der Brief hat schon längst Überlänge erreicht, aber so kurz als möglich nun noch die oben angekündigten Beispiele, die den qualitativen Unterschied des Sieges des „alten“ Revisionismus in der Sozialdemokratie zu dem des „modernen Revisionismus“ in unserer kommunistischen Bewegung deutlich machen.
Erste Beispiele: Schon wenige Wochen nach Stalins Tod wird von der Moskauer neuen Führung unternommen, in der DDR und in Ungarn einen Führungs- und Kurswechsel durchzusetzen.
Die neue Moskauer Führung, - treibende Kraft ist zunächst Beria -, will mit der Adenauer-Regierung einen Deal auf Kosten der DDR abschließen. Dem steht aber die SED-Führung mit Walter Ulbricht an der Spitze im Wege. Beria möchte deshalb seine Leute – den damaligen Chef der DDR-Staatssicherheit Zaisser und Rudolf Herrnstatt, der während seiner Emigration in der Sowjetunion ebenfalls eng mit dem sowjetischen Sicherheitsdienst zusammengearbeitet und zu diesem noch immer gute Verbindungen hat – an die Spitze von Partei und Staat in der DDR befördern. Dazu wird die DDR-Führung nach Moskau befohlen, um dort eine Anweisung zu einer schroffen Kursänderung entgegenzunehmen. Es wurde der Führung nicht gestattet, die Einführung dieses „neuen Kurses“ mit einer eigenen Begründung der Öffentlichkeit bekannt zu geben, sondern sie wurde gezwungen, dies mit einer vom sowjetischen Hochkommissar Sem-jonow aufgezwungenen Erklärung zu verkünden, die so abgefasst war, dass sie die Partei-führung als unfähig blamierte und diskreditierte und dadurch wesentlich zum Ausbruch der Partei- und Staatskrise und dem bekannten 17. Juni 1953 beitrug. Der wurde ganz im Sinne Berias von Zaisser und Herrnstadt zu Angriffen auf Walter Ulbricht und zu dem Versuch benutzt, sich an seiner Stelle an die Spitze der Partei wählen zu lassen. Dieser von Moskau initiierte Umsturzversuch scheiterte zum einen an Walter Ulbricht und der Mehrheit der Führungsmitglieder der SED, zum anderen daran, dass im Juli 1953 der Schutzherr von Zaisser und Herrnstatt, Beria, in Moskau verhaftet und aus der Führung entfernt wurde – offenbar als Opfer im Rivalitätskampf zweier konkurrierender Führeranwärter für die revisionistisch „erneuerte“ Sowjetunion.
Über das, was in Ungarn geschah, weißt Du besser Bescheid als ich, deshalb nur dies: Im Juni 1953 versuchte die Moskauer Führung nicht nur die Führung in Berlin nach „rechts“ zu rücken, sondern auch bei euch: Auf Verlangen der neuen Führung in Moskau mußte Rakosi sich ebenfalls zu „schweren Fehlern“ bekennen, als Ministerpräsident zurücktreten und sein Amt am 2. Juli an Imre Nagy übergeben, der – ebenfalls auf Moskaus Verlangen - Ende Juni ins Polit-büro aufgenommen worden war. (SFB -„Sender Freies Berlin“- am 15.6.1983: Chruschtschow verlangte im Juni 1953 von Rakosi, Imre Nagy zum Ministerpräsidenten zu ernennen.)
Nicht anders erfolgte der Führungswechsel im Jahre 1956: Chruschtschow und Tito setzten gemeinsam die ungarische Führung mit Rakosi und danach Gerö solange unter Druck, bis sie zurücktraten und endlich dem Kandidaten Chruschtschows, Imre Nagy, den Platz an der Spitze überließen. Erst dadurch wurde der Weg frei gemacht zur Installierung eines revisionistischen Systems nach jugoslawischem Vorbild in Ungarn. In den Grundzügen ähnlich verliefen die Dinge in Polen nach dem plötzlichen Tod von Bierut. Gomulka genoss den besonderen Schutz und die besondere Sympathie Chruschtschows, ohne den er nicht an die Spitze der polnischen Partei gelangt wäre. Eine ganz wichtige Rolle für den Sieg des Revisionismus in der kommunistischen Bewegung spielte unstreitbar die „Ernennung“ Titos durch Chruschtschow zum „makellosen Kommunisten“. Wie es dazu kam – das hat nun ganz bestimmt auch nichts zu tun mit Basis-Überbau- Beziehungen. Die Vorgeschichte des Chruschtschow-Besuches in Belgrad 1955 spielt schon im Jahre 1953; zu ihr gehört auch das Verfahren gegen Beria. Zu den Vorwürfen gegen ihn gehörte auch, er habe über Rankovic (damals stellvertretender Vorsitzender des Bundesexekutivkomitees Jugoslawiens) Beziehungen zu Tito aufnehmen wollen. Du kennst das sicher, aber ich weiß nicht, ob Dir aufgefallen ist, wie unterschiedlich sich Malenkow und Molotow dazu äußerten. Zu diesem Punkt führte Malenkow folgendes aus: „In der vergangenen Woche, kurz vor dem Tag, an dem wir im Präsidium des ZK beschlossen hatten, den Fall Berija zu erörtern, (Beria wurde am 26. Juni 1953 auf der Sitzung des ZK-Präsidiums verhaftet), kam er zu mir und unterbreitete den Vorschlag, über das MWD (Ministerium für innere Angelegenheiten, von Beria geleitet), Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zu Jugoslawien einzuleiten. Ich erklärte ihm, daß diese Frage im ZK erörtert werden müsse. Was ist das für ein Vorschlag? Unter den bei Berija aufgefundenen Materialien befand sich folgendes Dokument: ‚Ich nutze die Gelegenheit, um Ihnen, Genosse Rankovic, einen herzlichen Gruß von Genossen Berija, der sich gut an Sie erinnert, zu übermitteln. Genosse Berija beauftragte mich, Ihnen persönlich streng vertraulich mitzuteilen, daß er und seine Freunde eine gründliche Überprüfung und eine Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen zwischen beiden Staaten als erforderlich betrachten. In diesem Zusammenhang bittet Genosse Berija Sie, Genossen Tito persönlich darüber zu informieren, und falls Sie und Genosse Tito diese Auffassung teilen, so wäre es angebracht, eine vertrauliche Begegnung von besonders dafür bevollmächtigten Personen zu organisieren. Das Treffen könnte in Moskau stattfinden, doch falls Sie aus irgendeinem Grund dies nicht für annehmbar erachten, so könnte es auch in Belgrad abgehalten werden. Genosse Berija sprach die Überzeugung aus, daß außer Ihnen und Genossen Tito niemand von diesem Gespräch erfahren werde.‘
Berija konnte dieses Unternehmen nicht verwirklichen, weil wir die Ereignisse in eine andere Richtung gelenkt haben.“ (Ich habe zitiert aus: Der Fall Berija. Protokoll einer Abrechnung. Das Plenum des ZK der KPdSU Juli 1953. Stenographischer Bericht, Berlin 1993, S. 33-35.)
Mit der von Malenkow erwähnten „anderen Richtung“ ist offenbar der im Juni/Juli 1953 erfolgte Schritt der „Normalisierung“ der Beziehungen durch den Botschafteraustausch gemeint. Mehr als das Zitierte hat Malenkow zu diesem Punkt aus der Anklageliste nicht zu sagen gehabt. Er hat nicht einmal offenbart, wer denn der Schreiber der verlesenen Zeilen war – Beria war es offenbar nicht.
Wie nahm Molotow zu der gleichen Angelegenheit Stellung? Ich zitiere aus der gleichen Quelle, S.82 f. Molotow: „Es ist bekannt, daß unser ZK kürzlich einen Beschluß gefaßt hat, der auf eine Veränderung der offiziellen Beziehungen zur Regierung Jugoslawiens abzielt.. Im Zusammenhang damit wurden die bekannten Maßnahmen eingeleitet, und es wurde beschlossen, mit Jugoslawien Botschafter auszutauschen. Das Präsidium des ZK gelangte zu der Schlußfolgerung, daß die in der letzten Zeit verfolgte Linie in den Beziehungen zu Jugoslawien auf keinen Fall weiter fortgeführt werden dürfen. Da es uns nicht gelungen war, eine bestimmte Aufgabe durch einen Frontalangriff zu lösen, mußte zu anderen Methoden gegriffen werden. Deshalb wurde beschlossen, zu Jugoslawien ebensolche Beziehungen herzustellen wie sie auch zu anderen Staaten bestehen, die dem aggressiven Nordatlantikpakt angehören – Botschafter, offizielle Telegramme, Geschäftstreffen usw. Gänzlich anders wollte Berija dieses Moment ausnutzen. Nach dem von ihm erarbeiteten Plan sollte ein entsprechender Vertreter des MWD in Jugoslawien in Belgrad einen Brief an Rankovic überreichen, in dem im Namen Berijas Ansichten dargelegt wurden, die unserer Partei und der Sowjetmacht fremd sind.“
Molotow gibt dann den Inhalt des Briefes, wie er schon von Malenkow verlesen worden war, wieder, und fügt dem hinzu: „Berija gelang es jedoch nicht, diesen Brief nach Jugoslawien abzuschicken – er wurde mit dem Briefentwurf in der Tasche als Verräter verhaftet. Ist es denn nicht offensichtlich, daß Berija sich mit Rankovic und Tito, die sich wie Feinde der Sowjetunion aufführen, verschwören wollte? Ist es denn nicht klar, daß dieser von Berija in aller Heim-lichkeit vor der Regierung verfaßte Brief noch ein weiterer Versuch ist, dem Sowjetstaat in den Rücken zu fallen und dem imperialistischen Lager einen direkten Dienst zu erweisen? Allein diese Tatsache würde ausreichen, um die Schlußfolgerung zu ziehen: Berija ist ein Agent des gegnerischen Lagers, ein Agent des Klassenfeindes.“
An dieser Stelle vermerkte das Protokoll: „Stimmen: Richtig.“ Diese Stimme kam aber bestimmt nicht von Chruschtschow; denn der hielt zwar eine sehr lange Anklagerede – aber den Anklagepunkt: Brief an Rankovic und Tito sucht man darin vergeblich. Und im abschließenden Beschluß des Plenums zu diesem Punkt heißt es in lapidarer Kürze nur: “In den allerletzten Tagen sind die verbrecherischen Pläne Berijas aufgedeckt worden, über sein Agentennetz persönlichen Kontakt zu Tito und Rankovic in Jugoslawien aufzunehmen.“ (S. 336).
Wenn schon der Brief an Rankovic ein Beweis für Agententum im Dienste des Klassenfeindes war – wie ist dann Chruschtschows Rede bei seiner Ankunft auf dem Flugplatz in Belgrad am 26. Mai 1955 zu bewerten, in der er wider besseres Wissen und ganz wider seinen Auftrag eigenmächtig Tito zu einem grundlos beschuldigten makellosen Kommunisten erklärte und die gegen ihn völlig zu recht erhobenen Vorwürfe zu bösartigen Erfindungen?
„Teurer Genosse Tito! … Wir haben eingehend die Materialien überprüft, auf denen die schweren Anschuldigungen und Beleidigungen beruhten, die damals gegen die Führer Jugos-lawiens erhoben wurden. Die Tatsachen zeigen, dass diese Materialien von Volksfeinden, niederträchtigen Agenten des Imperialismus, fabriziert waren, die sich durch Betrug in unsere Reihen eingeschlichen hatten.“
Der damit gemeinte Berija aber war zwei Jahre zuvor u.a. wegen der Absicht der Kontakt-aufnahme zu Tito verhaftet und zum Tode verurteilt worden! Und der gleiche Chruschtschow, der hier bei Tito als der zu Unrecht verfolgten Unschuld Abbitte leistet, erklärte drei Jahre später auf dem VII. Parteitag der Bulgarischen Partei im Juli 1958, - was ich schon oft zitiert habe, was man aber gar nicht oft genug wiederholen kann, weil es, wie wir beide wissen, leider bislang der kommunistischen Öffentlichkeit immer noch weitgehend unbekannt ist - : „Die Revisionisten versuchen, die revolutionären Parteien von innen zu zersetzen, die Einheit zu unterminieren und Durcheinander und Verwirrung in die marxistisch-leninistische Ideologie zu tragen. Im Jahre 1948 nahm die Konferenz des Informationsbüros eine Resolution über die Lage in der KP Jugoslawiens an, die eine berechtigte Kritik an der Tätigkeit der KP Jugoslawiens in einer Reihe von Fragen enthielt. Diese Resolution war im wesentlichen richtig und entsprach den Interessen der revolutionären Bewegung.“
Warum jetzt so und 1955 anders? Weil Chruschtschow in seiner Aufstiegsphase 1953-1956 jede Gelegenheit – wie auf dem Belgrader Flugplatz - wahrnahm, die kollektiv beschlossenen Texte beiseite zu lassen und das Politbüro und die gesamte Öffentlichkeit durch einen eigenen, nicht nur nicht abgesprochenen, sondern weit über das Abgesprochene hinausgehenden, revisionis-tische Thesen postulierenden Text vor vollendet Tatsachen zu stellen und vor die Alternative, Differenzen in der Führung offenbar zu machen oder seinen Text nachträglich als vereinbart erscheinen zu lassen. Nach der Konterrevolution in Ungarn im Herbst 1956 geriet er aber für längere Zeit unter heftige Kritik und mußte fürchten, abgesetzt zu werden. Er meisterte diese kritische Situation, indem er bedenkenlos die Rolle eines scharfen Kritikers des Revisionismus übernahm.
Alle angeführten Beispiele zeigen deutlich, dass der Revisionismus kein in der kommunistischen Bewegung spontan von unten bis zur überwältigenden Stärke herangewachsenes Gewächs ist, sondern nach Stalins Tod von ein paar der neuen Führungsmitglieder von außen aufgenommen und von oben in die eigene Bewegung hineingedrückt wurde und zunächst – vor dem XX. Parteitag - bei weitem nicht die gewünschte Massenbasis fand. Dazu war die Autorität Stalins und waren seine Lehren noch viel zu sehr im Bewußtsein der Menschen lebendig. Solange gegen beides nicht ein vernichtender Schlag geführt worden war, konnten Tito und seine Freunde in der KPdSU und in anderen kommunistischen Parteien auf keinen durchschlagenden Erfolg hoffen.
Dieser mit der Methode der „Schocktherapie“ der ganzen kommunistischen Weltbewegung verpasste Keulenschlag wurde auf dem XX. Parteitag geführt. Das ging wiederum nicht ohne staatsstreichähnliche Vergewaltigung des Parteitages ab. Beschlossen war bekanntlich, die Fragen des „Personenkultes“ in einer Komission zu beraten und ihre Vorschläge zu einem späteren Zeitpunkt anzuhören und entsprechende Beschlüsse zu fassen. Wie Chruschtschow - sich über diesen Beschluss brutal hinwegsetzend - dem Parteitag nach dessen offiziellem Schluß seine „Geheimrede“ aufzwang, hat Lasar Kaganowitsch in seinen Erinnerungen beschrieben, und ich habe diese Passage in meine „Taubenfußchronik“ aufgenommen (S.18).
Aber selbst dieses in der Geschichte aller Parteien und Bewegungen beispiellose Attentat auf Hirn und Herz der Bewegung reichte noch nicht aus: es bedurfte noch der Ausschaltung der konsequentesten Kämpfer gegen den revisionistischen Kurs der Chruschtschow-Leute - Molotow, Kaganowitsch und anderer - als „Parteifeinde, und eines XXII.. Parteitages, um die personellen, ideellen und organisatorischen Voraussetzungen für einen schließlichen Sieg der revisionistischen über die gesunden, marxistisch-leninistischen Kräfte - sogar nach der Ab-setzung Chruschtschows im Oktober 1964 - zu ermöglichen.
Wobei auf keinen Fall vergessen werden darf, dass dieser Sieg nicht möglich gewesen wäre ohne das konzertierte Zusammenspiel von revisionistischen Führungen in der Sowjetunion, in Jugoslawien, Polen und Ungarn, mit ihren „Freunden“ in den imperialistischen Staaten. Wie beim alten Revisionismus in der Sozialdemokratie ist auch beim „modernen“ Revisionismus dessen stärkster Rückhalt und Kraftquell der Imperialismus.
Umgekehrt erweist sich heute mehr denn je, dass der Revisionismus in der kommunistischen Bewegung die stärkste Sicherung selbst des rabiatesten, räuberischsten Kapitalismus vor wirkungsvollem Massenwiderstand sogar in den Zeiten ist, in denen die objektiven Bedin-gungen dafür so günstig sind wie selten zuvor.
Noch nie war der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und dem privaten Eigentum an den Produktionsmitteln so krass und nach Überwindung durch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel schreiend – und zugleich konnte die Monopolbour-geoisie noch nie so ungehindert auch die letzten öffentlichen Unternehmen privatisieren wie gerade jetzt dank der vom Revisionismus in Europa zur Quantité négligeable ruinierten kommunistischen Bewegung.
Lieber Ervin, ich bin wieder einmal viel zu ausschweifend geworden – entschuldige das bitte, aber Du siehst daran, wie anregend Deine Überlegungen für mich waren.
Ich grüße Dich und Deine Frau ganz herzlich und sende Euch die besten Wünsche für den Rest dieses noch jungen Jahres,
Dein Genosse Kurt Gossweiler,
Berlin, Ferbruar 02
Ervin Rosznyai:
Brief an Kurt Gossweiler, Februar 2005
Lieber Genosse Kurt!
Denke bitte nicht an bloße Höflichkeit, wenn ich Dir von Herzen für Deinen Brief danke, aus welchem aufs Neue Deine wissenschaftliche Gründlichkeit und kameradschaftliche Hilfs-bereitschaft hervorgeht. Ich lese Deine Abhandlungen und Artikel immer mit Freude und gewöhnlich mit größtem Einverständnis. Es ist eine seltene Ausnahme, dass ich anderer Meinung bin als Du.
Aber in der Frage der Übergangsperiode kann ich Deiner Kritik nicht beipflichten, obwohl ich mir darüber im Klaren bin, dass die überwiegende Mehrheit der Marxisten den von Dir vertretenen Standpunkt teilt, jene aber, die meine Ansicht teilen, ich an einer Hand abzählen kann. (Ich bin allerdings stolz darauf, dass ich –nach meiner Kenntnis – Molotow zu ihnen zählen kann.) Gestatte, dass ich die mir wichtigsten Argumente in einigen Punkten zusammenfasse – nur ganz kurz, weil ich zu dem, was ich in meinem von der Sowjetunion handelnden Buch und in meinen auch ins Russische übersetzten Artikeln schrieb, nichts Neues hinzu fügen kann; ich möchte nur meine Grundgedanken nochmals hervorheben. Und vorausschicken möchte ich, dass ich es für entscheidend wichtig halte, die Fragen vom Gesichtspunkt der politischen Praxis aus anzugehen.
1. Die Probleme des Übergangs erörterte ich in Bezug auf die Sowjetunion und die osteuropäischen Volksdemokratien, was nicht bedeutet, dass ich die Probleme als typisch sow-jetische Erscheinungen betrachte. Ich verwies darauf, dass die Übergangsepoche, worunter ich den Zeitabschnitt zwischen Kapitalismus und Sozialismus verstehe, wahrscheinlich überall notwendig wird, aber ich konzentrierte mich auf jene Faktoren, welche diese Epoche in der Sowjetunion und in den Volksdemokratien charakterisierten.
2. Meiner Meinung nach ist es nicht einerlei, ob wir die fragliche Epoche „Anfangsphase des Sozialismus“ nennen – oder „Übergangsepoche“. Es ist dies kein leeres Spiel mit Worten, sondern die Bezeichnung jenes qualitativen Unterschieds, welcher die Übergangszeit zum Sozialismus vom Sozialismus selbst trennt. Das Wesentliche jenes Unterschiedes ist, dass während des Überganges die Warenproduktion, der Markt, das Wertgesetz (fort-)bestehen und sich ihr Wirkungsbereich in einem gewissen Sinne sogar noch erweitert, und zwar gerade durch die Entwicklung der Produktivkräfte und die sozialistischen Verhältnisse: die organisatorische Umgestaltung der Landwirtschaft (zu genossenschaftlichen Großbetrieben) und das Erstarken der Konsumgüter herstellenden Industrie erhöhen natürlich den Warenumsatz. Dies stärkt natürlich die kleinbürgerlichen Tendenzen, den Konkurrenzkampf um den Anteil bei der Aufteilung der Güter, den Karrierismus, die Privatbesitzerneigungen, all das Negative, was wir aus eigener Erfahrung kennen. Parallel dazu brechen durch die staatliche Planwirtschaft, die kulturelle Revolution, die erweiterte soziale Fürsorge die Elemente des Sozialismus hervor, verschärft sich also notwendiger Weise der Klassenkampf zwischen den zwei gegensätzlichen Tendenzen.
3. Die Übergangsepoche kann sich gleichermaßen in Richtung des Sozialismus oder des Kapitalismus entwickeln. In welche Richtung sie sich entwickeln wird, das kann nichts anderes entscheiden als der Klassenkampf. Dies ist der strategische Punkt, an dem Chruschtschow angriff: das Ansehen der Partei missachtend erhob er zum Beschluss, dass es in der Sowjetunion fortan keinen Klassenkampf mehr geben wird, da Stalin den nur erfunden habe, um seine Säuberungen und Repressalien zu rechtfertigen. Chruschtschow „begründete“ also „theoretisch“ das „Aufhören des Klassenkampfes“, man kann auch sagen: das Einstellen des Klassenkampfes durch die KPdSU, damit gab er dem Kampf der gegnerischen Klasse, dem Klassenkampf der kleinbürgerlichen Elemente, der Konterrevolution und allen Tendenzen gegen den Sozialismus freie Bahn.
4. Ich denke, für unsere Theorie ist an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass die klein-bürgerlichen Tendenzen nicht einfach nur „Muttermale“, nicht bloße Überbleibsel der Vergangenheit oder Folgen der kapitalistischen Umgebung sind, sondern dass sie auch direkte Produkte der wirtschaftlichen Struktur der Übergangsperiode sind. Denn diese Struktur erzeugt gleichzeitig sozialistische und kleinbürgerliche Tendenzen, und welcher von beiden der Sieg gehören wird, das ist nicht im Voraus klar, denn es ist die Epoche des „Wer – Wen?“, in der neben den traditionellen Formen des Klassenkampfes auch neuen Formen eine immer größere Rolle spielen.
5. Das alles bedeutet, dass das Zustandekommen sozialistischer Produktionsverhältnisse nicht nur von der Verstaatlichung und der Vergenossenschaftlichung abhängt und auch nicht nur daran gemessen werden kann, wie viel Prozent der Volkswirtschaft der kleine Privatbesitz an Produktionsmitteln ausmacht. Die Verstaatlichung und die Vergenossenschaftlichung schaffen natürlich die Grundlagen des Sozialismus, aber noch nicht ihn selbst: denn sie machen nicht Schluss mit der Reproduktion der bürgerlichen Tendenzen und Elemente, dem Klassenkampf der zwei Elemente, dem „Wer – Wen?“-Zustand. Wenn eine führende Partei der Über-gangsperiode das aus den Augen verliert, dann gewinnt eine Art Technizismus die Oberhand in ihr, welcher die weitere Entwicklung dann fast ausschließlich in der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte sieht und dabei die Fortsetzung der sozialistischen Umgestaltung der Produktionsverhältnisse und den dazu gehörigen unverzichtbaren politischen, ideologischen und wirtschaftlichen Klassenkampf vernachlässigt, was letzten Endes auch die Entwicklung der Produktivkräfte zur Stagnation verurteilt. Deshalb, so denke ich, beschränkt sich die Basis des modernen Revisionismus nicht auf einige eng begrenzte Intellektuellenschichten, sondern ist selbst verborgen in der wirtschaftlichen Struktur der Übergangsepoche und ihren Kräfte-verhältnissen – oder anders gesagt, alles hängt ab von der Durchsetzung der proletarischen Diktatur, also davon, ob sich die schädlichen Tendenzen entfalten können oder ob es gelingt, sie zu unterdrücken.
6. Dass Chruschtschow und seine Anhänger die Oberhand gewannen, hat auch einen gesellschaftlichen Hintergrund – und zwar in der Klassenstruktur der Sowjetunion und in der Umwälzung der inneren Verhältnisse.
a) In den westlichen Gebieten des Sowjetlandes wurde in Folge der Kampfhandlungen und der Nazibesetzung die Arbeiterklasse fast gänzlich vernichtet. Einen Teil der Arbeiterklass östlich des Ural bildeten aber ausgesiedelte einstige NÖP-Leute, Kulaken und/oder deren Ab-kömmlinge
b) Der Anteil der Kolchosmärkte am Einzelhandel wuchs von 15,9 % im Jahr 1939 auf 45,0 % während des Krieges, und mit der Geldanhäufung bildete sich die Schicht der Kolchos-mitgliedermillionäre heraus, die ungesetzlich Kolchosland enteigneten. Nach Schätzungen verfügten sie nach dem Krieg über mehr als 5 Millionen Hektar Ackerland.
c) Nach dem Krieg blieben in vielen Rayons der Ukraine und Weißrusslands die Dörfer fast oder ganz ohne männliche Bevölkerung. Die Anzahl der Kolchosmitglieder verringerte sich auf 70 % der Vorkriegszeit. Die landwirtschaftliche Produktion verminderte sich auf 50 – 60% der Vorkriegsleistung. Im Jahre 1946 gab es eine Dürre und mit ihr eine Hungersnot. In den europäischen Gebieten der Sowjetunion wurden pro Hektar nur 2-4 Doppelzentner Getreide produziert. In Sibirien war die Ernte gut, aber man konnte sie nicht rechtzeitig einbringen und einlagern. Auf diesem Boden unglaublicher Schwierigkeiten gediehen alle möglichen Formen der Schieberei und des Schmarotzertums.
d) Von fünf Millionen Mitgliedern der KPdSU starben drei Millionen den Heldentod an den Fronten. Während des Krieges erhöhte sich zwar die Zahl der Parteimitglieder auf rund sechs Millionen, aber zwei Drittel davon waren Jugendliche ohne ideologische Bildung und ohne politische Erfahrungen. All diese Umstände begünstigten auf außerordentliche Weise das Wiedererwachen bourgeoiser Elemente und Tendenzen – und schließlich den Sieg des Revisionismus über die marxistisch-leninistische Theorie und Praxis.
(Siehe: M. Sz. Dokucsajev: Istorija pomnyit, Moszkva 1998, S. 329; Nyina Andrejewa: Nyepodarennije principi, 1993, S. 274)
Lieber Genosse Kurt, ich glaube, es ist Zeit aufzuhören, habe ich doch Deine Geduld genügend beansprucht. Noch einmal danke ich Dir für Deinen ausführlichen Brief. Ich bin überzeugt davon, dass eine solche Genossendiskussion nur dem Nutzen unserer gemeinsamen Sache dienen wird.
Mit Liebe umarmt Dich Dein Genosse Ervin Rosznyai, Budapest, Februar 02
Die kommunistische Bewegung in Österreich |
Kommunistische Initiative Österreich (KI):
Die kommunistische Bewegung in Österreich, die historische Bedeutung der Kommunis-tischen Internationale und die Bedeutung des proletarischen Inter-nationalismus in der Gegenwart
Beitrag der Kommunistischen Initiative Österreich zum Internationalen Kommu-nistischen Seminar, Brüssel, 5.-7. Mai 2006
1. Bedingungen der Gründung der Kommunistischen Partei in Österreich
Am 7. November 1917 siegte in Russland die sozialistische Oktoberrevolution. Fast genau ein Jahr danach, am 3. November 1918, wurde in Wien die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) gegründet. Nur wenige Tage später, am 12. November desselben Jahres, wurde die Republik Österreich auf bürgerlich-demokratischer Grundlage konstituiert.
Was waren die allgemeinen Rahmenbedingungen, die die Gründung einer kommunistischen Arbeiterorganisation in Österreich begleiteten und beeinflussten? Die österreichische Sozial-demokratie hatte unter ihrem Parteigründer und Vorsitzenden Victor Adler eine ehrenhafte und revolutionäre Geschichte, doch auch in Österreich ist diese spätestens 1914, mit der Unter-stützung der Sozialdemokratischen Partei für den imperialistischen Weltkrieg, eben Vergan-genheit. Wie eine logische Folgerichtigkeit und ein symbolisches Zeichen erscheint es, dass Victor Adler, der allerdings selbst die Wandlung vom revolutionären Internationalismus zum gegenrevolutionären Sozialchauvinismus durchgemacht hat, am Ende des Krieges - und bloß einen Tag vor der oben erwähnten Gründung der ersten österreichischen Republik - verstarb. So markiert der November 1918 einen Wendepunkt in der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung. Diese Zeit offenbarte einerseits endgültig den gegenrevolutionären, revi-sionistischen und reformistischen Charakter der Sozialdemokratie, andererseits wurde dadurch die objektive Notwendigkeit der Gründung einer revolutionären und internationalistischen, einer wahrhaft marxistischen Kampfpartei der Arbeiterklasse offen-sichtlich.
Am Ende des Ersten Weltkrieges, in den Jahren 1917 und 1918, stand das österreichische Proletariat bereits mitten im revolutionären Kampf. Die unerträglichen Lebensbedingungen der Kriegsjahre, der sinnlose Krieg selbst, den die Völker Österreich-Ungarns für die österreichische Bourgeoisie führen mussten, und die Überzeugung, dass eine bessere Welt möglich sei, ini-tiierten auch in Österreich einen revolutionären Prozess. Die Frage war: Würde dieser Prozess in seiner bürgerlich-demokratischen Etappe verbleiben oder würde er konsequent fortgeführt werden zur sozialistischen Revolution? Es ist indessen keine Frage, was die Arbeiter wollten: Sie wollten ein sozialistisches Österreich, das - neben und mit einem sozialistischen Ungarn, einer sozialistischen Tschechoslowakei, einem sozialistischen Staat der Südslawen etc. - die Menschheit befreien würde. So zeigen die Jahre 1917 und 1918 einen revolutionären Aufschwung, der an verschiedenen Begebenheiten festzumachen ist, als Höhepunkte sind der große „Jännerstreik" im Januar 1918 und der Matrosenaufstand von Cattaro/Kotor im Februar 1918 zu nennen. In Wahrheit gab es aber bereits ab 1914 eine Kette von Kampfmaßnahmen, Unruhen und Protesten seitens österreichischer Arbeiter, die sich gegen den imperialistischen Krieg und die durch diesen gesteigerte kapitalistische Unterdrückung und Ausbeutung zur Wehr setzten. Doch geschah dies unkoordiniert, in einzelnen Betrieben, ohne dass es eine feste Organisation sozialistischer Kriegsgegner gegeben hätte, wie sie sich zur selben Zeit etwa in Deutschland um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg bildete. In Österreich-Ungarn gab es hierfür nur in Liberec in Böhmen reale Ansätze, die jedoch erfolglos blieben. In Wien agierte der Sohn des Führers der Sozialdemokratischen Partei, der Sohn Victor Adlers, Friedrich Adler, als Kriegsgegner und trat aus der Sozialdemokratischen Partei aus. Doch Friedrich Adler war eben kein konsequenter Revolutionär, der eine sozialistische Massenbewegung gegen den Krieg und für die soziale Revolution des Proletariats hätte führen können. Sein Protest manifestierte sich schließlich in einer Tat, die des anarchistischen Individualismus würdig gewesen wäre, Lenin nannte es die „Verzweiflungstat eines Kautskyaners": Friedrich Adler erschoss am 21. Oktober 1916 den österreichischen Ministerpräsidenten Stürgkh. Eine sinnlose Tat - und Friedrich Adler sollte auch später, nach seiner Begnadigung und Entlassung aus dem Gefängnis, keine positive Rolle in der Arbeiterbewegung spielen.
Tatsache ist, dass sich die Krise in Österreich-Ungarn um die Jahreswende 1917/1918 bereits zu einer akut revolutionären Situation zuspitzte. Für die österreichische Arbeiterklasse handelte es sich, wie wir heute wissen, um eine historisch bislang einzigartige Situation, die überwiegend die Voraussetzungen für die sozialistische Revolution erfüllte. Allerdings sollte sich hier in tragischer Weise zeigen, welche zentrale Bedingung einer erfolgreichen sozialistischen Revo-lution in Österreich damals eben nicht gegeben war: nämlich die Existenz einer revolutionären marxistischen Kampfpartei der Arbeiterklasse, einer Partei vom Typ der russischen Bol-schewiki. In Österreich lag die faktische Macht im November 1918 bereits in den Händen der Arbeiterklasse, doch die eben gegründete KPÖ konnte sich noch nicht an die Spitze der revolutionären Bewegung setzen, die Sozialdemokratie wollte es nicht. Die Sozialdemokratische Partei erwies sich als gegenrevolutionär und beendete und vollendete im Dienste der öster-reichischen Bourgeoisie die bürgerlich-demokratische Revolution. Die österreichische Sozial-demokratie hat 1918 die österreichische Bourgeoisie vor der sozialistischen Revolution gerettet. Karl Renner führte als sozialdemokratischer Kanzler eine gegenrevolutionäre, aber immerhin - unter dem Druck der revolutionierten Massen - reformistische Regierung, Karl Seitz wurde pro-visorischer Staatspräsident, Otto Bauer unterlegte die sozialdemokratische Politik mit revisi-onistischen Auslegungen des Marxismus und Friedrich Adler setzte sich an die Spitze der österreichischen Rätebewegung, um sie zu hemmen und den Einfluss der Kommunisten zu reduzieren. In der österreichischen Volkswehr wurden die kommunistisch dominierten Kom-panien, insbesondere das gesamte Bataillon 41, die „Rote Garde", durch die Sozialdemokratie isoliert und schließlich aufgelöst, obwohl - oder gerade weil - die KPÖ über 20 Prozent der Stimmen bei den Wahlen zu den Soldatenräten erreichte.
In der Folgezeit wurde die sozialdemokratisch geleitete österreichische Staatsmacht gar mit allen Gewaltmitteln gegen Demonstrationen von Arbeitern, Arbeitslosen und heimkehrenden Soldaten sozialistischer Gesinnung eingesetzt. Ihre blutigsten Verbrechen gegen die öster-reichische Arbeiterklasse beging die Sozialdemokratie am 17. April und am 15. Juni 1919 jeweils in Wien.
Im internationalen Rahmen ist die gegenrevolutionäre Ausrichtung der österreichischen Sozial-demokratie ebenfalls im Jahr 1919 von Bedeutung. Im April und Mai 1919 bestand die Mün-chener Räterepublik in Bayern, von März bis Anfang August 1919 die Räterepublik in Ungarn. Während die junge KPÖ eine Solidaritätskampagne einleitete und unter Führung Leo Roth-ziegels über eintausend Freiwillige zur Verteidigung der ungarischen Räterepublik schickte, zeichnete sich die in Wien an der Regierung befindliche Sozialdemokratie abermals durch konterrevolutionäres Handeln aus. Österreich wäre das Verbindungsglied zwischen München und Budapest gewesen und ein revolutionäres Bündnis in Mitteleuropa hätte dem revolutionären Prozess in Europa abermals zum weiteren Aufschwung und zur Vertiefung verholfen, nicht zu sprechen von den unmittelbaren Überlebenschancen der revolutionären Regierungen in Ungarn und Bayern. Doch die österreichische Sozialdemokratie verweigerte sich dem Hilferuf aus Ungarn und als Béla Kun im Sommer, nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution, nach Österreich fliehen musste, wurde er vorsichtshalber inhaftiert. Hier sieht man in aller Deut-lichkeit die essenzielle Bedeutung des proletarischen Internationalismus, den die junge KPÖ in solidarischer Weise pflegte, wohingegen die Sozialdemokratie ihren Bündnispartner offenbar in der nationalen Bourgeoisie sah … - Alle diese Begebenheiten zeigen die absolute Notwendigkeit der Gründung der KPÖ.
2. Die Kommunistische Internationale und die Bolschewisierung der KPÖ
Als die KPÖ im November 1918 gegründet wurde, konnte noch nicht von einer Partei bolschewistischen Typs, also von einer leninistischen Partei gesprochen werden. Zweifellos nahmen sich die Menschen, die sich in der KPÖ sammelten, die russischen Revolutionäre und die Oktoberrevolution zum Vorbild, schließlich forderten die österreichischen Arbeiter auch, mit der eigenen Bourgeoisie endlich „russisch zu sprechen". Fraglos war die Oktoberrevolution die Initialzündung für den Aufschwung des weltrevolutionären Prozesses und für den nötigen Differenzierungsprozess in der bisherigen Arbeiterbewegung - ein Differenzierungsprozess, der in der russischen Sozialdemokratie bereits 1903 vorweggenommen worden war. So war es auch keine Frage, dass die KPÖ beim ersten Kongress, also beim Gründungskongress der III., der Kommunistischen Internationale in Moskau mit zwei Delegierten, darunter Karl Steinhardt, vertreten war. - In inhaltlicher Hinsicht war die Ausrichtung der KPÖ jedoch noch nicht von vornherein einheitlich bolschewistisch, sondern pluralistisch, was den Parteiaufbau und die Parteiarbeit nicht nur hemmte, sondern zu andauernden Fraktionsauseinandersetzungen und mitunter fatalen Fehlpositionen führte (was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es freilich auch sehr viel Richtiges gab). Unter diesen Voraussetzungen, ohne die richtige Ideologie, Strategie und Struktur, konnte die KPÖ damals nicht zur revolutionären Massenpartei werden. Die Masse der Arbeiter vertraute weiterhin der Sozialdemokratie, während in die KPÖ, ähnlich wie bei der USPD in Deutschland, auch einige rechtsopportunistische Sozialdemokraten ein-traten. Dennoch finden sich bereits 1919 Menschen in der KPÖ, die für deren weitere marxistisch-leninistische Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten bedeutend waren, so zum Beispiel der damals erst siebzehnjährige Friedl Fürnberg, von 1926 bis 1932 zunächst Sekretär der Kommunistischen Jugendinternationale und 1932 bis 1971 ZK-Sekretär der KPÖ.
Maßgeblich beteiligt an der Gründung der KPÖ waren 1918 die so genannten „Linksradikalen", die sich zuvor um Friedrich Adler gruppiert und im Jännerstreik 1918 eine wichtige Rolle gespielt hatten, zu nennen wäre zum Beispiel Franz Koritschoner. Diese Bezeichnung, „Links-radikale", war durchaus zutreffend, denn in der Tat stand gerade die junge KPÖ, eine der ersten damals neu gegründeten kommunistischen Parteien der Welt, für so manche Kinderkrankheiten des Kommunismus, für so manche Fehleinschätzung der Bedingungen und daraus resultierende falsche Strategien, seien sie nun „linksradikal" oder derart, was man heute als „trotzkistisch" be-zeichnet. So musste bereits im Jahr 1920 Lenin selbst die KPÖ davon überzeugen, an den Wahlen teilzunehmen. Lenin schrieb in diesem Jahr über die KPÖ: „In Österreich hat der Kommunismus eine sehr schwere Zeit durchgemacht, die anscheinend noch nicht ganz überwunden ist: Wachstumskrankheiten, die Illusion, dass eine Gruppe, die sich zum Kommu-nismus bekennt, ohne ernstlichen Kampf um den Einfluss unter den Massen zu einer Macht werden könnte, Fehlgriffe in der Wahl von Personen." (LW 30, S. 350)
- In der Tat war die „schwere Zeit" noch nicht vorbei, bis 1924 wurde die KPÖ von heftigen Fraktionskämpfen geprägt, die erst 1927 endgültig überwunden wurden.
Bereits vor dem 3. Parteitag war das Jahr 1919 von Meinungsverschiedenheiten geprägt, im Mittelpunkt der Kritik stand Ernst Bettelheim, der ein vierköpfiges Parteileitungsgremium anführte. Mit Hilfe der Komintern und unter publizistischer Federführung Karl Radeks wurde bis Jahresende 1919 die KPÖ vorerst auf marxistische Positionen und Strategien geführt, damit wurde auch die finanzielle Hilfe aus Moskau für die kleine KPÖ wieder aufgenommen. Inner-halb der Komintern blieb die KPÖ jedoch tendenziell eher in der Nähe „linksradikaler“ Positi-onen, die „putschistische“ Offensivausrichtung gewann bis 1921 wieder die Oberhand. Die auf dem III. Weltkongress der Komintern beschlossene Analyse über die neue Etappe der revolu-tionären Entwicklung – Konsolidierung und Offensive des Kapitals, Defensive der Arbeiter-bewegung – wurde folgerichtig von der KPÖ-Führung nur teilweise mitgetragen. Nachdem 1923 die internen Fraktionskämpfe der KPÖ sogar auf einem erweiterten Plenum des Exekutiv-komitees der Komintern ausgetragen worden war, wurde – nach einer richtungweisenden Stellungnahme der Komintern und ihres Österreich-Beauftragten Neurath – die Parteileitung reorganisiert. Franz Koritschoner und Karl Tomann, die im März 1923 auf dem 6. Parteitag die Mehrheit hinter sich versammeln konnten und zu diesem Zeitpunkt auch die Unterstützung der Komintern hatten, wurden nach der Niederlage bei der Nationalratswahl abgelöst. Johann Koplenig, zuvor Landessekretär der KPÖ Steiermark, wurde vorerst Organisationssekretär, Gottlieb Fiala Reichssekretär. Als sich im darauf folgenden Jahr die verheerenden Fraktions-kämpfe auf dem 7. Parteitag jedoch fortsetzten, wurde einerseits Georgi Dimitroff EKKI-Berater für die KPÖ, andererseits wurde eine neue provisorische Parteileitung eingesetzt, deren Führung Koplenig übernahm. Das „Provisorium Koplenig“ blieb personell über 40 Jahre bestehen, am 19. Parteitag 1965 trat Koplenig als Vorsitzender der KPÖ zurück.
In den folgenden Jahren nach der Bestellung Koplenigs, bis 1927, wurde unter entscheidender Mithilfe der Komintern und insbesondere Dimitroffs die Linie der KPÖ so weit geklärt, dass man von einer einheitlichen marxistisch-leninistischen Partei sprechen konnte. Koplenig selbst war im Weltkrieg in russische Kriegsgefangenschaft geraten, hatte die Revolution erlebt und war der Partei der Bolschewiki beigetreten. Bis zu seiner Rückkehr nach Österreich im Jahr 1920 war er als Propagandist tätig. Wieder in Österreich trat er als überzeugter Bolschewik folgerichtig aus der Sozialdemokratischen Partei, deren Mitglied er seit 1909 gewesen war, aus und in die KPÖ ein. Vor diesem Hintergrund war Koplenig aus Sicht der Komintern ein logischer und verlässlicher Kandidat, wenn es um die Bolschewisierung der KPÖ ging. Die Bolschewisierung der Komintern-Parteien gab der internationalen kommunistischen Bewegung jene einheitliche marxistisch-leninistische Grundlage, die der gemeinsame Kampf der Kommu-nisten unbedingt benötigt. Es ist keine Frage, dass diese Bolschewisierung der kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt nötig und Großteils erfolgreich war. (So war es - um ein weiteres Beispiel neben Österreich zu nennen - äußerst bedeutsam, dass mit 1925 die marxistisch-leninistische Linie der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) unter ihrem neuen Vor-sitzenden Ernst Thälmann, der bereits zuvor Mitglied des EKKI war, geklärt werden konnte. Schließlich war es vor allem der marxistisch-leninistische Charakter der KPD, der es ermöglichte, dass nach 1945 in der Sozialistischen Einheitspartei (SED) die proletarische Ein-heitsfront hergestellt und 1949 unter Führung Wilhelm Piecks, eines erfahrenen Mitstreiters Thälmanns, die Deutsche Demokratische Republik (DDR), der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden, gegründet werden konnte.)
Die Bolschewisierung der KPÖ ermöglichte es ihr, für die kommenden antifaschistischen Kämpfe gerade rechtzeitig gewappnet zu sein. Die KPÖ sollte bis 1945 die Hauptlast des anti-faschistischen Widerstandes in Österreich tragen, sei es in der Illegalität oder später im Rahmen der österreichischen Freiheitsbataillone in der jugoslawischen Partisanenarmee, womit vor allem die Kommunisten jenen Anteil zur eigenen Befreiung Österreichs vom Faschismus leisteten, der in der Moskauer Deklaration der Anti-Hitler-Koalition festgehalten und gefordert war.
Ein weiteres bedeutsames Resultat der endgültigen Festigung der KPÖ als bolschewistische, leninistische Partei, wozu auch die Gründung der theoretischen Organe „Der Kommunist" unter Leitung Arnold Reisbergs 1932 und „Weg und Ziel" 1935 beitrug, war die theoretische Klärung der nationalen Frage in Österreich durch die KPÖ. Alfred Klahr, ein Mitglied des Zentral-komitees, legte 1937 den Grundstein für die Theorie der österreichischen Nation, die sich unab-hängig von der deutschen Nation entwickelt hat, wobei Klahr unmittelbar an die bolsche-wistische Position zur nationalen Frage anknüpfen konnte, deren umfassende Darstellung Josef Stalin 1913 ausgerechnet in Wien erarbeitet und in seinem Werk „Marxismus und nationale Frage" schriftlich festgehalten hatte. Die Einschätzung der KPÖ zur nationalen Frage in Öster-reich war eine bedeutende Grundlage für den antifaschistischen Kampf gegen die deutsche Okkupation und Annexion Österreichs 1938, sie ist Grundlage für die Wiedererstehung eines unabhängigen österreichischen Staates 1945. Dass sich in der kommunistischen Weltbewegung diese von Klahr erarbeitete Ansicht über das Verhältnis Österreichs zu Deutschland durchsetzte, ist einerseits der Tatsache zu verdanken, dass die KPD sich deutlich hinter den Standpunkt der KPÖ stellte, andererseits abermals der Tätigkeit Georgi Dimitroffs in der Komintern, der sämtliche österreichische Problemstellungen ausgezeichnet kannte. Allerdings dauerte es bis 1941, bis auch die KPdSU explizit die Einschätzung der KPÖ unterstützte. Äußerst bedeutsam war die Klärung der nationalen Frage bezüglich Österreichs durch die KPÖ und die Komintern darüber hinaus auch deshalb, weil die österreichische Sozialdemokratie, die die Existenz der österreichischen Nation leugnete und in deren „Linzer Programm" von 1926 nochmals die Anschlussforderung an Deutschland beschlossen wurde, erst 1945 und eher widerwillig ihre Vorstellung über die Österreicher als Teil der deutschen Nation aufgab.
Im Allgemeinen war die Komintern also von immenser Bedeutung für die Herstellung einer einheitlichen marxistisch-leninistischen Kampffront der kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt. Und gerade für die KPÖ war das Eingreifen Dimitroffs wohl ein Akt, der die Partei vor der völligen selbst verschuldeten Bedeutungslosigkeit oder eventuell der Selbstauflösung bewahrte. Daneben hauchte die Komintern nach dem Bankrott der II. Internationale dem proletarischen Internationalismus neues Leben ein. Manche Menschen könnten meinen, dass die Auflösung der Komintern im Jahr 1943 hierzu im Widerspruch steht, womöglich gar eine Abkehr vom Internationalismus gewesen sei. Dem war selbstverständlich nicht so. Mit der Auflösung der Komintern wurde seitens der internationalen kommunistischen Bewegung natür-lich nicht der Internationalismus abgeschafft, sondern gemäß neuer Bedingungen seine Form verändert. Die Komintern hat ihre wichtigen Aufgaben von 1919 bis 1943 erfüllt, ab 1945 konn-ten die Beziehungen der kommunistischen Parteien andere zweckmäßige Formen annehmen.
3. Die kommunistische Bewegung und der Kampf gegen den Faschismus
Als der IV. Weltkongress der Komintern 1922 vor der Gefahr des Faschismus warnte, schloss sich die KPÖ bereits dieser Sichtweise bezüglich der österreichischen Republik an. Die KPÖ definierte 1923 die Gefahr des Faschismus als Hauptproblem und unterbreitete der Sozial-demokratie wiederholt das Angebot der proletarischen Einheitsfront im Widerstand gegen Reaktion und kapitalistische Offensive, was damals noch auf Kritik „linksradikaler" und sektiererischer Gruppen in der KPÖ stieß. Mit der Bolschewisierung der KPÖ unter Johann Koplenig übernahm diese bezüglich der Einschätzung des Faschismus freilich Analyse und Strategie der Komintern. In den folgenden Jahren wurde der Kampf gegen den Faschismus tatsächlich zur Hauptaufgabe der KPÖ, sie mag hierbei den einen oder anderen Fehler begangen haben, seitens der Arbeiterparteien war es jedoch ohne Zweifel die Sozialdemokratie, die den Faschisierungsprozess und die Errichtung der faschistischen Diktatur in Österreich begünstigt hat. Die falsche „radikalreformistische" Strategie und Taktik der österreichischen Sozial-demokratie konnte nicht nur zwingend niemals zur sozialistischen Revolution führen, sie musste vielmehr beinahe zwingend in den Sieg des Faschismus münden. In der Praxis zeigte sich die fatale Rolle der Sozialdemokratie schon im Zuge der Junirevolte 1927, in deren Gefolge die KPÖ und insbesondere ihr Vorsitzender Koplenig durch klare und mutige Positionen an Ansehen unter den sozialdemokratischen Arbeitern gewannen. Als die österreichische Groß-bourgeoisie und der Großgrundbesitz schließlich zur Errichtung der direkten faschistischen Diktatur schritten, bäumten sich revolutionäre Teile der Basis des sozialdemokratischen Schutz-bundes in den Februarkämpfen 1934 nochmals auf. Dieser heroische Kampf fand natürlich die ungeteilte und aktive Unterstützung durch die KPÖ, während die Führung der Sozial-demokratischen Partei abermals versagte und die kämpfenden Arbeiter im Stich ließ. Schuld an der Niederlage der Arbeiter in den Februarkämpfen waren freilich die falsche Organi-sationsstruktur sowie die falsche Strategie und Taktik des Schutzbundes, die nicht umgesetzte Bewaffnung der Arbeiterschaft und die vorauszusehende Handlungsunfähigkeit der sozial-demokratischen Führung - lauter Dinge, vor denen die Kommunisten schon zuvor aus guten Gründen gewarnt hatten. Ein Ergebnis der Februarkämpfe war vor diesem Hintergrund auch, dass sehr viele sozialdemokratische Arbeiter nun begriffen, dass die Politik der Sozial-demokratie ihre Klasseninteressen nicht verteidigen kann, weshalb sie in die KPÖ eintraten. Ausgerechnet unter den schwierigen Bedingungen der Illegalität, in der sich die KPÖ bereits seit dem 26. Mai 1933 befand, wurde die KPÖ auf diese Weise erstmals zu einer Partei mit Masseneinfluss.
Im Gefolge des Sieges des Faschismus in Deutschland und Österreich musste sich der VII. Weltkongress der Komintern 1935 eingehend mit der Analyse des Faschismus einerseits sowie mit der Erarbeitung einer aussichtsreichen antifaschistischen Strategie andererseits beschäftigen. Beides, marxistisch-leninistische Faschismusanalyse und antifaschistische Strategie, legte Georgi Dimitroff in seinem Hauptreferat dar. Im Namen der österreichischen Delegation stimmte Koplenig in seiner Rede auf dem Weltkongress dem Referat Dimitroffs voll und ganz zu und hob nochmals dessen Bedeutung für den Klassenkampf und den antifaschistischen Kampf hervor. Gemäß den Beschlüssen des VII. Weltkongresses bemühte sich die KPÖ in Österreich weiterhin um die Schaffung einer Einheitsfront mit den Revolutionären Sozialisten, die aus der Sozialdemokratischen Partei hervorgegangen waren, wodurch die Basis für eine breite antifaschistische Volksfront geschaffen werden sollte. Schließlich konnte dieser Versuch nur Teilerfolge zu Tage bringen und scheiterte im Wesentlichen am sozialdemokratischen Unwillen. Dadurch lag die Hauptlast des antifaschistischen Kampfes, zumal die Revolutionären Sozialisten nach der deutschen Annexion Österreichs aufgelöst wurden, auch nach der Ersetzung des einen, autochthonen faschistischen Regimes durch ein anderes faschistisches Regime, jenes der deutschen Fremdherrschaft, weiterhin bei den Kommunisten.
Als die Komintern 1936 zum Kampf für die Verteidigung der spanischen Republik aufrief, folgten 1.700 Österreicher diesem Aufruf und beteiligen sich im Rahmen der Internationalen Brigaden am antifaschistischen Freiheitskampf der spanischen Volksfront. Die Aufstellung der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, die sich heuer, im Jahr 2006, zum 70. Mal jährt, ist wohl eines der lebhaftesten Beispiele eines proletarischen Internationalismus der Tat. Unter den österreichischen Kämpfern fanden sich Kommunisten wie auch Sozialdemokraten, einige ehemalige Schutzbund-Kämpfer kamen aus dem sowjetischen Exil nach Spanien. In der österreichischen Arbeiterbewegung agitierte vor allem die KPÖ für die spanische Volksfront, während die Revolutionären Sozialisten und die Exil-Sozialdemokratie vorrangig mit sich selbst beschäftigt blieben. Auch auf zwischenstaatlicher Ebene zeugt der Spanische Bürgerkrieg von gelebter internationaler Solidarität, denn gerade die Hilfe der Sowjetunion für die spanische Volksfront ist keineswegs gering zu schätzen, auch wenn Antikommunisten unterschiedlicher Schattierungen aufgrund unlauterer Motive dies in Abrede stellen wollen.
In Österreich formulierte die KPÖ nun eine neue Hauptaufgabe. Unter den schwierigen Bedingungen des österreichischen Faschismus mussten nun alle Kräfte gegen den drohenden neuen Weltkrieg im Allgemeinen und gegen die Okkupation Österreichs durch das faschistische Deutschland im Speziellen gesammelt werden. In Übereinstimmung mit den Thesen der Kom-intern zur Volksfrontpolitik und unter Anwendung der Arbeiten Alfred Klahrs zur nationalen Frage in Österreich definierte die KPÖ den Kampf gegen den Nationalsozialismus als nationalen Freiheitskampf des österreichischen Volkes. Da jedoch sowohl die an der Macht befindlichen Austrofaschisten als auch die österreichischen Sozialdemokraten die österreichische Nation ablehnten und grundsätzlich eine deutschnationale Ideologie vertraten, stand die KPÖ mit ihrem unerschütterlichen Willen, die Unabhängigkeit Österreichs zu verteidigen, weit gehend alleine da. – Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, dass es auch in Teilen des konservativen Lagers um Ernst Karl Winter Überlegungen gab, die denen von Alfred Klahr ähnlich waren, und dass es auch aus den Kreisen der Monarchisten eine Österreich-patriotische Grundhaltung gab.) – Als es im März 1938 zur Annexion Österreichs durch Deutschland kam, fanden sich sodann folge-richtig prominente Sozialdemokraten wie Karl Renner und Otto Bauer, die diesen Schritt als historischen Fortschritt bewerteten, die Revolutionären Sozialisten befanden gar, es handle sich bei der deutsch-faschistischen Eroberungspolitik um eine grundsätzlich positiv zu bewertende „europäische Integration“. Anders die Kommunisten, das Zentralkomitee der KPÖ richtete im März 1938 einen als historisch anzusehenden Aufruf an das österreichische Volk, in dem es zum Widerstand und nationalen Freiheitskampf aufgefordert wurde. Auch hierbei ereilte die KPÖ wieder internationale Hilfe und Solidarität, das Zentralkomitee der KPD verurteilte die Annexion Österreichs sofort, auch die Sowjetunion protestierte gegen die deutsche Aggression. Seitens der kapitalistischen Staaten verurteilte jedoch ausschließlich Mexiko diesen ver-brecherischen Akt des deutschen Imperialismus faschistischer Prägung.
Dass im Frühjahr 1945 schließlich der deutsche Faschismus in ganz Europa besiegt werden konnte und auch Österreich befreit wurde, war im internationalen Maßstab wesentlich das Verdienst der Roten Armee der Sowjetunion. Ihr ist es unter großen Opfern nicht nur gelungen, die faschistische Vernichtungsmaschinerie im eigenen Land aufzuhalten, sondern zurück-zuschlagen und schließlich zu besiegen. Als im April 1945 die Rote Armee in Wien ein-marschierte, bestand die Hoffnung, man würde nun in Österreich nicht nur die faschistische Form, sondern den imperialistischen Kapitalismus insgesamt überwinden können. Zwei Dinge standen dem im Wege: Einerseits war die wieder gegründete österreichische Sozialdemokratie (SPÖ) nicht über Nacht zur revolutionären Partei geworden - im Gegenteil, nach 1945 wurde seitens der SPÖ jede sozialistische Perspektive endgültig über Bord geworfen; andererseits eröffnete der imperialistische Westblock sofort die Front gegen den Sozialismus und die volksdemokratischen Bewegungen in Osteuropa. Das Hauptanliegen der ehemaligen Ver-bündeten der Sowjetunion in der Anti-Hitler-Koalition wurde nun schlagartig wieder der Anti-kommunismus. In Österreich führte die antikommunistische sozialdemokratisch-bürgerliche Front dazu, dass die KPÖ recht bald aus der Regierung ausschied und den Hetz- und Lügen-kampagnen der bürgerlichen und sozialdemokratischen Regierungen wenig entgegenzusetzen hatte.
Die defensive Seite des Antikommunismus ist diejenige, dass konsequenter Antifaschismus zu Tage gebracht hätte, dass nur der herrschende Monopolkapitalismus die Grundlage, ja der Grund für den Faschismus ist. Somit bedeutet konsequenter Antifaschismus unweigerlich Anti-imperialismus, Antimonopolismus und Antikapitalismus - das war den imperialistischen Sieger-mächten durchaus bewusst und deshalb wich der Antifaschismus bald wieder dem Anti-kommunismus. Die offensive Zielsetzung des Antikommunismus war diejenige, die 1989/90 schließlich erreicht wurde: Durch die Bündelung aller politischen, ökonomischen, ideologischen und militärischen Potenzen des Imperialismus in der NATO und durch die EG wurde ein antisozialistischer Block geschaffen, dessen Hauptaufgabe die Zerstörung des Sozialismus in Europa und die kapitalistische Restaurierung und Reintegration der ehemals sozialistischen Län-der war. Dass die Sowjetunion und die sozialistischen Staaten Europas dem Druck von außen nicht Stand halten konnten, war einer inneren Schwäche geschuldet. Diese inhaltliche Schwäche basierte vor allem und in letzter Instanz unweigerlich auf der Preisgabe des Marxismus-Leninismus durch die Parteiführungen, d.h. auf dem Revisionismus in Teilen der kommu-nistischen Bewegung.
So ist aus der vorläufigen Niederlage des Sozialismus von 1989/90 vor allem eines zu lernen: Ohne feste ideologische Grundlage auf Basis des Marxismus-Leninismus gibt es auch kein erfolgreiches revolutionäres Handeln. Das gilt für die organisierte revolutionäre Arbeiterklasse an der Macht wie für die kommunistische Bewegung auf dem Weg zur Revolution. „Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben", schrieb Lenin. Die heutigen Kommunisten mögen sich diesen Satz gut merken - und die implizite Aufforderung auch umsetzen.
4. Gegenwärtige Probleme und Perspektiven der österreichischen und internationalen kommunistischen Bewegung
In ideologischer Hinsicht besteht die zentrale Aufgabe der heutigen Kommunisten also darin, den Marxismus-Leninismus gegen Entstellungen und revisionistische Einflüsse zu verteidigen. Dies erfolgreich zu tun, bedeutet dreierlei:
1. Die Kommunisten müssen ihre Theorie und Programmatik auf den Grundpositionen des Marxismus-Leninismus aufbauen, das heißt insbesondere auf der marxistischen Staatstheorie, auf Lenins Imperialismustheorie, auf einem leninistischen Parteiverständnis, auf dem solida-rischen und antiimperialistischen Internationalismus der Werktätigen und in der Verteidigung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen.
2. Die Kommunisten müssen sich das Bewusstsein um die historische Rolle und Bedeutung der Sowjetunion und der sozialistischen Staaten Europas erhalten und diese verteidigen.
3. Die Kommunisten müssen den unerbittlichen ideologischen Kampf gegen den Revisionismus führen.
Auf dieser ideologischen Basis und unter diesen Voraussetzungen ist eine erfolgreiche Neuformierung der revolutionären Kräfte möglich. Dieser Prozess wird ein längerfristig anzu-setzender und ein äußerst beschwerlicher sein, doch er ist unvermeidlich, wenn angesichts der Alternativen Sozialismus oder Barbarei die erstere Möglichkeit zur Umsetzung kommen soll. Gelingt eine derartige revolutionäre kommunistische Organisierung der Werktätigen, so wird am Ende dieses Prozesses eine kampfbereite und vor allem kampffähige marxistische Partei der Arbeiterklasse stehen. Gelingt eine derartige Organisierung nicht, so wären alle Voraus-setzungen gegeben, dass das imperialistische Räubersystem nicht nur einfach weiterhin besteht, sondern der Imperialismus würde der Menschheit hinkünftig unweigerlich im neuen Ausmaß verheerende Kriege bescheren, die die Existenz der Menschheit als Spezies auf diesem Planeten infrage zu stellen vermögen.
Die Kommunistische Initiative in Österreich möchte daher einen Beitrag zum Aufbau einer revo-lutionären marxistischen Partei der Arbeiterklasse leisten. Die Kommunistische Initiative ist der Ansicht, dass die KPÖ diesem Anspruch nicht mehr gerecht wird, zumal sie sich diesen Anspruch selbst gar nicht mehr gibt. Gewiss steht es der Kommunistischen Initiative nicht zu, im internationalen Rahmen über die KPÖ zu Gericht zu sitzen – das Urteil über die KPÖ wie über alle anderen linken Parteien wird die zukünftige gesellschaftliche Praxis der Arbeiterklasse sprechen. Nichtsdestotrotz erachtet es die Kommunistische Initiative als ihre solidarische Pflicht den in der KPÖ organisierten Kommunisten gegenüber, Fehler und Fehlentwicklungen in der KPÖ aufzuzeigen.
Doch nicht nur in der KPÖ, sondern seitens vieler kommunistischer oder vormals kommu-nistischer Parteien ist es nach der vorläufigen Niederlage des Sozialismus in Europa nicht geglückt, mit der neuen Situation richtig umzugehen. Die Neuformierung und Neuorientierung bezog sich allzu oft auf eine offen revisionistische Wende in der Programmatik, eines der markantesten Beispiele hierfür ist wohl jenes der deutschen Linkspartei/PDS. Die heutige KPÖ ihrerseits will explizit keine leninistische Partei mehr sein, sie definiert sich neuerdings als pluralistische Partei, womit sie wieder genau jenen ideologischen Verwirrungen Tür und Tor öffnet, die Johann Koplenig von 1924 bis 1927 mühevoll und mit Hilfe der Komintern über-winden konnte. Grundsätzlich, vor 1924 wie heute, ist der Pluralismus freilich das Einfallstor für bürgerliche Ideologien in kommunistische Organisationen, darüber hinaus entpuppt sich der heutige Pluralismus in der KPÖ mehr und mehr als ein Mittel, die Partei nicht nur vom Marxismus, sondern auch von den Marxisten zu „befreien". Was das Eindringen bürgerlicher, unmarxistischer und antimarxistischer Ideologien betrifft, so ist bezüglich Österreich und Deutschland gegenwärtig nicht zuletzt die offen pro-imperialistische „antinationale" Ideologie zu nennen, die selbst imperialistische Angriffskriege rechtfertigt und offen fordert. Ebenso wird teilweise der proletarische Internationalismus durch bürgerlich-kosmopolitische Illusionen ersetzt, der Höhepunkt dieser Entwicklung ist die strukturelle Anerkennung und Verteidigung der Europäischen Union seitens kommunistischer Funktionäre, also die positive Besetzung und Rechtfertigung eines imperialistischen Bündnisses. So wird der in Wahrheit zutiefst antide-mokratische, weil eben imperialistische europäische Integrationsprozess zur historischen Not-wendig- und Gesetzmäßigkeit, die angeblich klassenindifferent zu verstehen sei. Der kapitalistische Integrationsprozess in Europa sei die Überwindung des bürgerlichen Nationalstaates unter bürgerlichen Verhältnissen. Gerade in Österreich erinnert Derartiges geradezu fatal an jene Phrasen Otto Bauers und anderer Sozialdemokraten über den angeblichen „historischen Fortschritt" der deutschen Annexion Österreichs 1938. - In Wahrheit ist der kapitalistische Integrationsprozess - vor dem Hintergrund des fortlaufenden Internatio-nalisierungsprozesses des Kapitalismus und der ungehemmten Neuentfaltung des aggressiven und repressiven Wesens des Imperialismus - ein Prozess der allseitigen Durchdringung und Unterordnung sämtlicher Lebensbereiche und Nationen durch das Monopolkapital. Diese neue Offensive des Kapitalismus in politischer, ökonomischer und vermehrt militärischer Hinsicht bedrückt nicht nur die Lage der arbeitenden Menschen in Stadt und Land, sondern aller nichtmonopolistischen Schichten der Bevölkerung. Daher kann angesichts dieser Offensive die kommunistische Bewegung nur mit antiimperialistischen und antimonopolistischen Strategien erfolgreich sein, an deren Ende eine nachhaltige Neuordnung der gesellschaftlichen Kräfte-verhältnisse zu Ungunsten des Monopolkapitals und zu Gunsten der Werktätigen Erfolg ver-sprechende Ausgangsbedingungen für die sozialistische Revolution schafft.
Doch die Antwort einer Reihe sozialistischer und kommunistischer Parteien, insbesondere jener, die sich in der EU-„Linkspartei“ vereinigen, ist die Neuentdeckung des sozialdemokratischen Reformismus, ist die Neuerfindung eines angeblichen dritten Weges zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Diese Parteien propagieren die bürgerliche Demokratie mit Wahlrecht und Parlamentarismus als jene politische Form, die zum Sozialismus führen soll, womit der proletarische Klassenkampf abermals preisgegeben wird. Auch diese Wendung erinnert fatal an die falschen Konzepte der österreichischen Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit. Es war Karl Liebknecht, der kurz vor seiner Ermordung drauf hingewiesen hat, dass der Weg zum Sozialismus nicht über die so genannte „Demokratie“, sondern vielmehr der Weg zur tat-sächlichen Demokratie bloß über den Sozialismus führt. Und tatsächlich führte der „demo-kratische Weg“ der deutschen und österreichischen Sozialdemokratie bloß geradewegs in den Faschismus.
Auch in der Praxis nehmen die Wendungen dieser in der EU-„Linkspartei“ versammelten Parteien mitunter erstaunliche Qualitäten an. Erst kürzlich haben bis auf zwei Ausnahmen die Abgeordneten der deutschen Linkspartei/PDS im EU-Parlament für eine antisozialistische Resolution gegenüber Kuba gestimmt. Die KPÖ hat zwar keine Abgeordneten im EU-Par-lament, setzt aber dennoch bemerkenswerte Akzente. Als im November vergangenen Jahres auf Einladung der griechischen KKE in Athen eine internationale Konferenz kommunistischer und Arbeiterparteien stattfand, verweigerte die KPÖ ihr Zustimmung zu den Solidaritätserklärungen für Kuba und Venezuela, ja selbst die Protestnote gegen die antikommunistische Initiative des Europarats schien der KPÖ nicht unterstützenswert. Tatsache ist, dass hiermit der proletarische solidarische Internationalismus, den sogar die vorbolschewistische KPÖ bereits pflegte und der das wohl höchste Gut der internationalen kommunistischen Bewegung darstellt, offenbar ent-sorgt wird. Am politischen Stellenwert des proletarischen Internationalismus und der anti-imperialistischen Solidarität kann der Charakter einer Partei sehr gut erkannt werden, im Falle der KPÖ wirft der nicht mehr vorhandene proletarische Internationalismus kein allzu gutes Licht auf die Partei.
Ersetzt wird der proletarische Internationalismus seitens der angesprochenen Parteien durch eine den Gesetzen des EU-Imperialismus entsprechende Struktur, durch die so genannten „Euro-päische Linkspartei“, in der wichtige und erfolgreiche kommunistische Parteien Europas wohl aus besten Gründen nicht teilnehmen.
Und an dieser Stelle sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass diese durch und durch fehlerhaften Positionen und Orientierungen auch in der KPÖ nicht unumstritten sind. Tatsache ist, dass die einzige bei Wahlen erfolgreiche Landesorganisation der KPÖ, nämlich jene der KPÖ Steier-mark, diese Positionen ablehnt: Die KPÖ Steiermark, von der mit Recht behauptet werden kann, dass sie den marxistischen und konsequent antirevisionistischen Teil der KPÖ repräsentiert, bleibt bei ihrer Ablehnung der EU und lehnt auch die Mitgliedschaft der KPÖ in der EU-„Linkspartei" ab. Allerdings ist die KPÖ Steiermark nicht im Bundesvorstand der KPÖ vertreten und erkennt den letzten Bundesparteitag der KPÖ nicht an. Die Kommunistische Initiative ist der Überzeugung, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet die KPÖ Steiermark, die sich das Werkzeug des Marxismus erhalten hat, genau jener und der einzige Teil der KPÖ ist, der in einem Landesparlament vertreten ist und bei den Wahlen in der steirischen Hauptstadt Graz sogar über 20% der Wählerstimmen erreicht hat, während es für den Rest der KPÖ schon ein Erfolg ist, die 1%-Marke zu überspringen. Offensichtlich besteht ein Zusammenhang zwischen marxistischen und antiimperialistischen Positionen und erfolgreicher politischer Arbeit unter und mit den Werktätigen. - Die Kommunistische Initiative teilt und unterstützt diese richtigen und wichtigen Positionen der KPÖ Steiermark, nämlich die Ablehnung der EU als imperia-listisches Bündnis und die Ablehnung der EU-„Linkspartei".
Nach Ansicht der Kommunistischen Initiative besteht die Aufgabe der antirevisionistischen und marxistisch-leninistischen Parteien und Organisationen in Europa und darüber hinaus darin, dem den sozialistischen Zielen zuwiderlaufenden Formierungsversuch einer reformistisch-revisio-nistischen und zum Teil offen antimarxistischen EU-„Linkspartei“ eine klassenbewusste, internationalistische, antiimperialistische und solidarische Kooperation der internationalen kommunistischen Bewegung entgegenzustellen, die in den besten Traditionen der Inter-nationalen Arbeiterassoziation (IAA), der frühen II. Internationale und der Komintern agiert.
Voraussetzung einer schlagkräftigen internationalen kommunistischen Bewegung ist die weltweite Schaffung revolutionärer Arbeiterparteien, die auf dem Boden des Marxismus-Leninismus agieren. In Österreich hat sich die Kommunistische Initiative das Ziel gesetzt, für die Schaffung einer solchen Partei zu arbeiten. Die Kommunistische Initiative wirkt in dieser Hinsicht in Solidarität mit und in Kooperationsbereitschaft gegenüber Marxisten, Kommunisten und revolutionären Sozialisten, die Mitglieder anderer Organisationen oder derzeit unorganisiert sind und die unsere Zielsetzung teilen. Vor allem aber wird es in Österreich darum gehen, die Masse der momentan tendenziell indifferenten, weil von der Sozialdemokratie enttäuschten Arbeiter zu gewinnen. - Eine solche Mobilisierung und Organisierung eines großen Teils der österreichischen Arbeiterklasse ist eine schwierige Aufgabe, an der die kommunistische Bewegung in Österreich seit bald 90 Jahren arbeitet und dabei Erfolge und Misserfolge vor-weisen kann. Die Kommunistische Initiative versteht sich in der besten Tradition der revo-lutionären österreichischen Arbeiterbewegung, der kommunistischen Bewegung, und sie ist bemüht, den Kampf um die Massen und um die kulturelle Hegemonie in der Gesellschaft mit einer klaren marxistisch-leninistischen Ideologie zu verknüpfen. Die marxistisch-leninistische Ideologie ist in der kommunistischen Bewegung während jeder Etappe ihrer Entwicklung unverzichtbar. Die Kommunistische Initiative hält es in dieser Hinsicht mit Johann Koplenig, der einer der besten Söhne und Führer der österreichischen Arbeiterklasse war - am 14. Parteitag der KPÖ im Jahr 1948 fand Koplenig Worte, die für die Kommunistische Initiative auch heute eine Anleitung zum Handeln sind: „In jedem entscheidenden Moment der Entwicklung Österreichs war es unsere Partei, und nur unsere Partei, die den richtigen Weg gewiesen hat, weil sie allein den unentbehrlichen Kompass der Arbeiterbewegung, den Marxismus-Leninismus, besitzt. (…) Die ideologische Stärkung ist … untrennbar verbunden mit dem Kampf zur Gewinnung der Massen und heute, angesichts der Perspektiven verschärfter Klassen-gegensätze, darf man weniger denn je die ideologische Arbeit vergessen, gilt es erst recht, größte Aufmerksamkeit der politischen Erziehungsarbeit zuzuwenden, wachsam darauf zu achten, dass die Ideologie des Klassenfeindes nicht in unsere Reihen dringe. Unsere Ideologie, unsere Theorie des Marxismus-Leninismus ist die beste Waffe der Arbeiterklasse im Kampf für ihre Befreiung. Diese Theorie ist unbesiegbar, denn sie ist die Wahrheit."…
Brüssel, Mai 2006,
für die Kommunistische Initiative (KI) Österreich, Tibor Zenker
Resonanz |
Dipl. oec. Klaus-Dieter Lange:
Offensiv wider der Schmähschrift von Hermann Jacobs zum Programm der DKP
Hermann Jacobs hat, wie er selbst formulierte, im Heft 3/2006 des „offen-siv“, Zeitschrift für Sozialismus und Frieden, den Sozialismusteil des Programmentwurfs der DKP, welcher zwischenzeitlich durch den 17. Parteitag der DKP als Programm beschlossen wurde, einer kritischen Analyse unterzogen. Er meint inhaltliche und methodologische Probleme im neuen Parteiprogramm der DKP erkannt zu haben. Auf Basis welcher Methodologie hat er nur seine Analyse vorgenommen, ich konnte es nicht ausmachen.
Am 20.05.2006 fand in Leipzig eine Gesamtmitgliederversammlung der DKP-Parteigruppen des Landes Sachsen statt. Eingangs erwähnter Artikel von Hermann Jacobs spielte in dieser Mitgliederversammlung zur Umsetzung des neuen Parteiprogramms überhaupt keine Rolle, obwohl diese Zeitschrift in unseren Reihen durchaus gelesen wird. Anderseits kannten die Leser des „offen-siv“ aus einem vorhergehenden Heft unsere kritischen Veränderungsvorschläge zur Qualifizierung des Programmentwurfs im Rahmen der DKP-Programmdiskussion. Aus der Diskussion der erwähnten Mitgliederversammlung vom 20.05.2006 war erkennbar, dass die überwiegende Mehrheit unserer Genossen der Auffassung ist, dass es Zeit wurde, dass wir ein neues Programm haben, welches gegenüber dem Entwurf qualifizierter worden ist, wenn auch nicht vollkommen in den Formulierungen. Es wird uns aber Handlungsanleitung sein und gleichzeitig Anregung, die Diskussion um die widerstreitenden theoretische Positionen innerhalb der Partei fortzuführen, um so nach einer überschaubaren Periode uns dann ein Programm zu geben, in welchem einheitliche Positionen zu den heutigen Disputen verallgemeinert werden können. In keiner Weise stimmte die Mehrheit unserer sächsischen Genossen mit Jacobs überein, dass der Programmentwurf hätte abgelehnt werden müssen! Alle drei Delegierten aus unserem Land hatten demzufolge auf dem 17. Parteitag unserer DKP für das neue Programm gestimmt, wohlwissend dass es ein Kompromisprogramm für einen überschaubaren Zeithorizont darstellt.
Dennoch halte ich es für erforderlich, dass eine Auseinandersetzung mit den Positionen von Hermann Jakobs, wie er sie im „offen-siv“ Heft 3/2006 vertreten hat, geführt werden sollte, zumal er ja selbst schreibt, dass die von ihm aufgeworfenen theoretischen Problemstellungen über den Rahmen des Programms hinausgehen. Ich möchte mit diesem Artikel einen Beitrag leisten in der Auseinandersetzung mit der Jacobs’schen Marxismusauffassung. Für mich hat Jacobs in dem Heft 3/2006 des „offen-siv“ lediglich eine polemisierende Schmähschrift wider der DKP geschrieben, anstatt einen theoretischen Beitrag zu leisten, um einen Konsens zwischen den kommunistischen Gruppierungen und Einzelpersonen zu ermöglichen. Auch die Genossen der DKP aus dem Bundesland Sachsen sind sich darüber einig, dass es den Kommunisten und Kommunistinnen dieser kapitalistischen Bundesrepublik Deutschland gelingen muss, zukünftig den Schulterschluss für gemeinsames Handeln für unser gemeinsames Ziel, die kommunistische Gesellschaftsordnung, zu wagen. Alles andere nutzt nur dem Klassengegner, der Bourgeoisie, im eigenen Land. Diesem materiell mächtigen Gegner soll es doch nicht mehr gelingen, mit korrumpierenden Methoden und Theorien, welche den Klassencharakter dieser unserer heutigen kapitalistischen Gesellschaftsordnung verleugnen, in die Reihen der Arbeiterbewegung einzudringen.
Die DKP hat sich mit ihrem neuen Programm eindeutig für den Kampf um die Errichtung einer neuen kommunistischen Gesellschaftsordnung ausgesprochen. Den Sozialismus siegreich im Klassenkampf mit der international eng verflochtenen Bourgeoisie zu erringen, dafür bedarf es einer Einheitsfront aller Proletarier im Verbund mit den übrigen „abhängig Beschäftigten“ sowie der gegenseitigen internationalen, proletarischen Solidarität.
Was das neue Programm der DKP beispielsweise nicht leistet, ist eine klare Aussage dazu, wem aus der heutigen Arbeiterbewegung die Koordinierungsrolle für die Organisation des Klassenkampfes zufällt. Die DKP sieht sich nicht in dieser Rolle, ist aber zur breitesten Mitwirkung bereit. Die klassenbewusste Führung der Arbeiterklasse ist für den Erfolg des Klassenkampfes aus meinen Erfahrungen unverzichtbar. Dies gehört nicht nur zu den theoretischen Grunderkenntnissen des Marxismus-Leninismus, sondern auch zu den Erfahrungen der Arbeiterbewegung aus den Klassenkämpfen der letzten 200 Jahre. Natürlich muss ein solcher Führungsanspruch nicht programmatisch lediglich festgestellt, sondern ständig neu erarbeitet werden. Dies bedeutet, die Arbeiterklasse selbst muss Vertrauen in die Arbeit einer solchen Partei haben. Es wäre zu einfach, wenn wir Mitglieder der DKP uns auf die Position zurückziehen würden, wir haben noch nicht oder nicht mehr die Massenbasis, deshalb können wir für uns keinen Führungsanspruch postulieren. Bezüglich der Stellung der DKP unter den Parteien, welche aus der Arbeiterbewegung Deutschlands hervorgegangen sind, kann ich Jacobs Worte aus seinem einleitenden Kapitel, verallgemeinert betrachtet, nur unterstützen, denn er formulierte: „Bedenken wir doch, dass die DKP die einzige Partei in Deutschland – darüberhinaus könnte auch stimmen - noch ist, die diese Arbeit zu leisten sich verpflichtet fühlt; bei den anderen erscheint nicht mal mehr dieses, man hat sich ... verabschiedet, ist nur noch Ablehnung, eben unwiderruflich Bruch". Die Ursachen, warum die DKP sich durchgängig in ihrem neuen Programm, insbesondere im Kapitel „Die Kräfte des Widerstands und des Fortschritts“, nicht in der Führungsrolle sieht, liegen tiefer, eben in widerstreitenden theoretischen Positionen. Die Rolle der Arbeiterklasse in der Gesellschaft ist im Programm eindeutig festgestellt, formuliert ist auch das Selbstverständnis unserer DKP als revolutionäre Partei, aber es ist nicht ausgesagt, wer die organisierende Kraft für die als notwendig festgeschriebene Aktionseinheit der Arbeiterklasse und ihrer Bündnispartner ist. Einzelne Aspekte, welche hiermit im Zusammenhang stehen, führe ich an späterer Stelle aus. Die einfachste Begründung, welche mir zu Ohren kam, ist, dass es taktische Gründe dafür gäbe. Die Kämpfe des Jahres in Frankreich haben untermauert, dass koordinierte Führung der Aktionen letztlich erfolgreich für die Arbeiterklasse sein können. Was bleibt ist, dass wir durch weitere theoretische Diskussion und Verallgemeinerung der Erfahrungen der heutigen Klassenkämpfe für die Zukunft eine Position zur Rolle der DKP bei der Koordinierung der Arbeiterklasse einnehmen müssen.
Zu Jacobs für mich nicht erkennbarer Methodologie. Marx, Engels, Lenin haben es uns Kommunisten vorgemacht, wie man unter konsequenter Anwendung der Methode des dialektischen und historischen Materialismus Parteiprogramme von Parteien der Arbeiterbewegung analysieren sollte, um festzustellen, ob man diese Partei zu den wahren Interessenvertretern der Arbeiterklasse zählen kann oder ob sie mit dem Programm ihre Reihen öffnen für den Einzug revisionistischer Theorien. Also ob diese Parteien bürgerliche Theorien in die Arbeiterbewegung eindringen lassen, bewusst oder unbewusst so zur Erhaltung der Macht des Kapitals und wider den Interessen der Arbeiterklasse beitragen. Ich gehe davon aus, dass Herr Jacobs sich selbst zu den Kommunisten rechnet, auf Grund seiner Beteuerungen zum Marxismus. Anmaßend wirken allerdings seine schulmeisterlichen Vorschläge an die DKP, wie diese ihr Programm hätte anders formulieren müssen, um seinen Ansprüchen (Jacobs) an die Politik einer Kommunistische Partei gerecht zu werden. Schulmeisterlich, weil er beispielsweise schreibt „Es hat Diskussionen in der DKP/UZ zur "Grundlage" gegeben, meines Erachtens keine genügenden, und zum Sozialismusteil war sie sogar ausnehmend mangelhaft“ - Zitat aus offen-siv 3/2006. Ja Herr Jacobs, wir wollen als Mitglieder der DKP nicht Ihren Ansprüchen an eine Partei gerecht werden, sondern unseren mehrheitlich in einer breiten, sehr kontrovers geführten Diskussion selbst gesetzten Zielen. Auch wenn wir uns noch über die Rolle der DKP streiten. Diese Position nehme ich zumindestens für meine Person in Anspruch. Vorgenannte Ziele sind nun mit Mehrheitsbeschluss im neuen Programm unserer Partei verankert. Ob unter Verweis auf das neue Programm revisionistische Positionen in der DKP Fuß fassen können, hängt entscheidend einerseits von der zukünftigen Politik des Parteivorstandes bei der Organisation des Klassenkampfes ab und anderseits von der Wachsamkeit aller Mitglieder, jegliche Form des Eindringens von Revisionismus in die Partei abzuwehren.
Selbstverständlich ist es legitim auch für Nichtmitglieder der DKP, welche sich den Interessen der Arbeiterklasse verpflichtet fühlen, dieses Programm aus marxistischer Sicht zu analysieren. Wir aus Leipzig laden sehr häufig marxistische Professoren zu theoretischen Streitgesprächen ein. Aber bitte geführt auf wissenschaftlicher Basis des Marxismus-Leninismus. Mit Verlaub gesagt, bei Jacobs Artikel werden seine theoretischen Ansichten von ihm teilweise dogmatisch in den Raum gestellt und der Versuch unternommen, seine Positionen der DKP aufzudrängen. Zumindestens habe ich den Artikel so empfunden. Noch besser wäre es, die Kritiker würden kommen, soweit ihre Kritik an der DKP ehrlich gemeint ist, unsere Reihen durch Eintritt in unsere Partei zu stärken. Die Apologeten der Bourgeoisie werden ohnehin unaufgefordert sich das Maul über das Programm unserer DKP zerfetzen. Letzteren Verleumdungen wiederum polemisierend und mit der angemessenen Schärfe zu begegnen ist Teil unseres Klassenkampfes. Mit den Feinden der Arbeiterklasse auf der anderen Seite der Barrikaden kann uns nichts, aber auch gar nichts vereinen, denn es ist zwischen uns keine Sozialharmonie erstrebenswert, weil uns der antagonistische Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaftsordnung trennt, der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit.
Den Mitgliedern der DKP selbst ist es durchaus bewusst, wie eingangs erwähnt, dass das neue Programm der DKP einen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen programmatischen Strömungen in der Partei darstellt. Genossin Nina Hager stellte dies auf dem 17. Parteitag der DKP wie folgt dar „Das Euch vorliegende Material ist das Ergebnis eines wichtigen Verständigungsprozesses, in dem wir uns zusammengerauft haben. Darin werden die Gemeinsamkeiten betont. Diese betreffen die gemeinsame weltanschauliche Grundlage, die Einschätzung des Wesens der Gesellschaft, in der wir leben und kämpfen, die Bewertung der Rolle der Arbeiterklasse in den Klassenkämpfen, unser politisches Ziel, d.h. die Notwendigkeit des revolutionären Bruchs mit den bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnissen und die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft als erste Phase der kommunistischen Gesellschaftsformation, die Beurteilung der wesentlichen Rahmenbedingungen der neuen Gesellschaft und vieles andere mehr. ... Darüber hinaus haben wir uns auf dieser Grundlage zu anderen Fragen verständigt, dort Kompromisse gefunden. Der erreichte Konsens ist gewollt, aber zerbrechlich. ... Wir müssen uns heute entscheiden (2. Tagung des 17. PT – Autor), ob wir den Konsens wollen, den das erarbeitete Material darstellt. Wenn wir ihn wollen, dann heißt dies ... ein neues Parteiprogramm zu beschließen. Meines Erachtens müssen wir uns heute entscheiden, weil jede Vertagung Kraft- und Zeitverlust bedeutet.“
Die Mehrheit der Delegierten hat sich entschieden und den Konsens, also das Kompromissprogramm angenommen. Nicht wenige Delegierte betonten, weil sie es als wichtig ansehen, noch mehr Zeit für die Organisation des Klassenkampfes zu verwenden.
In gleicher Rede auf dem 17. Parteitag der DKP stellte Nina Hager aus ihrer Sicht dar, welchen Anforderungen ein Parteiprogramm b.z.w. die Debatte dazu entsprechen sollte, indem sie sagte, „eine Programmdebatte folgt anderen Gesetzen als die fortlaufende Analyse tagespolitischer Ereignisse. Sie erfordert ein hohes Maß an theoretischer Verallgemeinerung. Andererseits müssen theoretische Erkenntnisse programmatisch so gefasst werden, dass sie nicht nur eine Orientierung für das Denken, für die weitere Analyse geben, sondern auch handlungsorientierend wirken. Ein kommunistisches Parteiprogramm ist bekanntlich nach Lenin "eine kurze, klare und genaue Darlegung all dessen, was die Partei anstrebt und wofür sie kämpft". Gerade diese als notwendig erkannte theoretische Verallgemeinerung ist im beschlossenen DKP-Programm noch nicht durchgängig gelungen, auch deshalb nur ein Kompromissprogramm. Für gleiche Erscheinungsformen, welche durch eine Analyse gesellschaftlicher Prozesse erkannt wurden, werden zudem an verschiedenen Programmstellen unterschiedliche Begriffe verwendet, was zu Irritationen führen kann. Gleichermaßen sind noch das Programm aufblähende Wiederholungen unnötigerweise enthalten. Zudem wird auch im Programm nicht durchgängig von Tagesaufgaben der Politik abstrahiert, welche in Arbeitspläne der Parteigremien gehören. Auch dies trägt zur Aufblähung und Unübersichtlichkeit des Programms bei. Das haben wir erkannt!
Wäre es deswegen richtiger gewesen dieses Programm nicht zu beschließen?
Ich bin überzeugt, dass eine derartige Entscheidung des 17. DKP-Parteitages der Partei nichts genützt hätte, sondern eher geschadet, da wie Nina Hager m. E. richtig sagte, es nur Kraft- und Zeitverlust dargestellt hätte. Um widerstreitende Positionen zu Formulierungen der theoretischen Aussagen des Programms innerhalb einer erneuten Programmkommission zu glätten, hätte es einer breit organisierten und kraftzehrenden Debatte bedurft, deren erfolgreicher Abschluss nicht absehbar war. Was wäre am Ende herausgekommen, wieder ein Kompromissprogramm, was sonst bei unterschiedlichen Auffassungen, nun etwas wohlfeiler formuliert, oder gar eine die Partei schwächende Austrittswelle. Letzteres würde doch nur den Apologeten des Kapitals nützen, eine Schwächung unserer Partei und damit der Kampfkraft der Arbeiterklasse, nichts sehnlicheres wünschen diese Herrschaften sich. Eine Verabschiedung des Programms auf dem 17. Parteitag war vor allem auch deswegen zwingend notwendig, weil die Partei bis zur Beschlussfassung im gewissen Sinn ohne Parteiprogramm stand. Das bis dahin gültige 78’er Programm konnte natürlich nicht die neue Klassenkampflage der internationalen Arbeiterbewegung nach dem Sieg der Konterrevolution über das sozialistische Weltsystem berücksichtigten. Deshalb war eine neue programmatische Orientierung in der Partei dringlich erforderlich.
Anderseits machen es die Unzulänglichkeiten im Parteiprogramm der DKP notwendig, dass die theoretische Diskussion und Schulung der Mitglieder in der DKP ohne Unterbrechung fortgeführt wird, denn es ist erkennbar, vor allem weil das Programm ein Kompromissprogramm in theoretischen Fragen darstellt, dass das beschlossene Programm nur ein Übergangsprogramm für eine relativ kurze Zeit sein kann. Der schwerer werdende internationale Klassenkampf erfordert, dass die Arbeiterbewegung auf der Basis einheitlicher theoretischer Positionen zielklar geführt werden muss und ihre Positionen in alle Bevölkerungsschichten getragen werden müssen. Klassenbewusstsein ist immer wieder neu herauszubilden! Nur so kann das Ziel der DKP erreicht werden, nämlich Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung als ersten Schritt auf dem Weg der Menschheit zum Kommunismus.
Herr Jacobs verwendet in seinem Werk den Plural, symptomatisch dafür gleich die erste Überschrift „Was wir befürchten“. Nur wen er mit dem „wir“ meint, schreibt er an keiner Stelle. Also nur ein methodischer Trick, um die eigene Auffassung zu erhöhen, als ob eine ganze Gruppe mit ihm der gleichen Meinung sei und damit seine Meinung doch ein größeres Gewicht bekommen solle. Angesprochen hat er unter vorgenannter Überschrift den Parteivorstand der DKP. Ja Herr Jacobs, auch Sie mussten sich gedulden, wie alle Mitglieder der DKP auch, welche in der Programmdiskussion ihren Beitrag leisteten, bis die Antragskommission und der Parteivorstand mit dem Antrag zur Annahme des überarbeiteten Parteiprogramms an den 17. Parteitag den Genossen und auch Ihnen eine Antwort auf die Überarbeitungsvorschläge gaben und die Delegierten des Parteitages mit ihrem Beschluss. Oder wollten Sie als „Gruppensprecher“ eine Extrawurst gebraten haben? Man kann sicherlich trefflich darüber streiten, ob nicht Genossin Hager in ihrem Referat noch tiefgründiger auf die Beweggründe der Ablehnung einzelner Vorschläge zur Veränderung des Programmentwurfs eingehen hätte sollen. Aus meiner Sicht und der Sicht der sächsischen Delegierten war Nina Hagers Rede auf dem 17. Parteitag der DKP ein klasse Referat, welches die Delegierten emotional ansprach und begeisterte! Das wäre aber zu Lasten des Zeitvolumens für die Aussprache der Delegierten des 17. Parteitages gegangen – auch keine ideale Alternative, oder?
Nun genug zu Formalismen, jetzt wende ich mich wieder einigen Positionen zu, welche Herr Jacobs im Heft 3/2006 des „offen-siv“ vertrat und bewerte diese aus meinem Blickwinkel.
Im Absatz 3 des ersten Abschnitts „Was wir befürchten“ wird von ihm behauptet, dass das neue Programm dazu beitragen würde, eine Art theoretischer Verwirrung über eine ganze Periode der Arbeiterbewegung zu stiften. Jacobs meint damit den Teil des neuen DKP-Parteiprogramms (Antrag des PV), der sich mit den Erfahrungen/Lehren des realen Sozialismus befasst. Nina Hager veranschaulichte deutlich in ihrem Referat auf dem 17. Parteitag zur Zusammenfassung der Diskussion, dass es noch nicht möglich war, eine abschließende Bewertung des realen Sozialismus vorzunehmen und damit auch nicht die Wege des Aufbaus des Sozialismus nach Erringen der Macht durch die Arbeiterklasse. Sie schätzte ein: „Debattiert wird auch über die Schlussfolgerungen, die aus der Niederlage für künftige sozialistische Gesellschaften gezogen werden müssen, und über Lehren der Geschichte. Unterschiedliche Einschätzungen gab und gibt es auch im Zusammenhang mit den Ursachen der Niederlage von 1989/90, vor allem über das Verhältnis von inneren und äußeren Faktoren, objektiven und subjektiven Momenten. ... Die Ursachen für die abweichenden Standpunkte lagen und liegen wahrscheinlich u.a. in unterschiedlichen Erfahrungen und auch - ausgehend von der gemeinsamen marxistischen Grundlage - in verschiedenen theoretischen Ansätzen. Manche Diskussion und die starke Betonung der eigenen Rolle in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen war dabei sicherlich auch von der Sorge geprägt, die DKP würde ihr kommunistisches Profil aufgeben und möglicherweise in der PDS oder in den gesellschaftlichen Bewegungen aufgehen. Das bedeutet, dass es nicht unserer wissenschaftlichen Inkompetenz oder dem Streit von Personen geschuldet war, dass wir uns letztlich bei der Erarbeitung eines Programms so schwer taten. ...“ Ich stimme in der Bewertung dieses Komplexes mit Nina Hager überein. Zudem ist es so, zumindestens ist mir nichts anderes bekannt, dass es noch keine allgemein anerkannten, abschließenden und umfassend verallgemeinerten marxistischen Lehren aus der Niederlage des realen Sozialismus in Osteuropa für den Aufbau einer zukünftigen kommunistischen Gesellschaftsordnung gibt. Der 17. Parteitag der DKP konnte an diesem Zustand auch nichts ändern, darin stimme ich mit Herrn Jacobs überein.
Ich selbst bin nicht davon überzeugt, dass es richtig sein kann, dass wir, um nicht einige potentielle Bündnispartner oder den Verfassungsschutz aufzuschrecken, nicht die marxistischen Grunderkenntnisse zur Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats beim Aufbau des Sozialismus in unser Programm aufnehmen hätten sollen. Stattdessen wurde im Programm formuliert, bei allen richtigen Bewertungen, welche vorher vorgenommen wurden: „Die DKP sieht die Aufgabe der kommunistischen Partei im Sozialismus darin, zusammen mit anderen fortschrittlichen Kräften im Ringen um die besten politischen Ideen und Initiativen immer aufs Neue das Vertrauen der Menschen und maßgeblichen Einfluss zu erringen. ... Es ist die Aufgabe der Kommunistinnen und Kommunisten, sozialistisches Bewusstsein in den Massen zu entwickeln, sie für das selbstständige, initiativreiche Wirken beim Aufbau des Sozialismus zu gewinnen und für dessen Verteidigung gegen alle Versuche zu mobilisieren, den Kapitalismus wiederherzustellen.“ (aus Absatz 11 Abschnitt III DKP Programm 2006) Diese These birgt in sich dennoch die Gefahr, dass bei einem Ringen um die beste Lösung auch mal Kräfte mit weniger guten Lösungen, ja sozialismusfeindlichen Lösungen, siegreich sein können, wie das Jahr 1989 in der DDR schmerzhaft belegt. Gerade deswegen müssen wir konsequent das Prinzip der Diktatur des Proletariats als wahrhafte Demokratie der Mehrheit in einer sozialistischen Gesellschaft beachten, wenn notwendig auch gegen eine Minderheit ausgeübt.
In diesem Zusammenhang sei der vollständigkeitshalber darauf hingewiesen, dass es keine Demokratie an und für sich gibt, sondern dass Demokratie objektiv immer vom Klassencharakter der jeweiligen Gesellschaftsordnung, in der die Menschen leben, geprägt wird. Die Bourgeoisie im Allgemeinen kann für sich alleine schon keine Volksherrschaft ausüben, weil sie rein quantitativ stets eine Minderheit darstellt, welche mit fortschreitender Internationalisierung - manche geben sich modern und sagen Globalisierung dazu - zahlenmäßig weiter schrumpft. Bleibt festzustellen, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung die Diktatur einer Minderheit über die Volksmehrheit, die Arbeiterklasse, ist und mit der Bezeichnung „wahre Demokratie“ ihr Klassencharakter verschleiert werden soll. Schlussfolgernd kann es nur eine bürgerliche Demokratie geben, ausgerichtet auf die Klasseninteressen der Bourgeoisie oder eine sozialistische Demokratie, dort wo Sozialismus errichtet wird. Letzteres ist wahrhafte Demokratie, also Volksherrschaft. Diese wird im Sozialismus als Diktatur des Proletariats ausgeübt, also Diktatur der sozialistischen Produktionsverhältnisse gegenüber dem rudimentös noch bestehenden Privateigentum an Produktionsmitteln. Wie notwendig diese Diktatur des Proletariats ist, zeigte uns schmerzlich der Sieg der Konterrevolutionäre um Gorbatschow im Bündnis mit Kohl/Bush sen. und Kosorten.
Daraus leitet sich für die Mitglieder der DKP das Erfordernis ab, weiter zu ringen um eine verallgemeinerungsfähige Herausarbeitung von Lehren aus dem realen Sozialismus für den Sozialismus unserer Zukunft.
Über eins bin ich mir sicher, der Illusion von Hermann Jacobs sollten wir nicht unterliegen und annehmen, dass nach einer solchen „Debatte ... eine andere Art der historischen Einschätzung der ersten weltgeschichtlichen Praxis“ des „Kommunismus“ geben wird „... Es wird eine Variante sein, die den fortsetzenden Formen der Arbeiterbewegung größeren Mut macht, in der Zukunft der Geschichte dort, wo bereits Zukunft in der Vergangenheit war, anzuknüpfen.“ Warum überhaupt erst Lehren aus der Niederlage ziehen, wenn für Herrn Jacobs bereits feststeht, dass die Arbeiterbewegung einfach dort anknüpfen sollte, wo sie beim ersten „Feldversuch Sozialismus“ von den Konterrevolutionären unterbrochen wurde. Das ist für mich nichts anderes als Aufforderung dafür, gleiche Fehler zu wiederholen. Das widerspräche zudem der Herangehensweise nach dem dialektischen und historischen Materialismus, wonach mit der historischen Entwicklung sich auch eine Entwicklung in den Produktionsverhältnissen vollziehen wird. Ein einfaches Anknüpfen an den Entwicklungsstand des Sozialismus des Jahres 1989 beim Aufbau des Sozialismus der Zukunft wird beispielsweise allein auf Grund der Entwicklung der Produktivkräfte gar nicht möglich sein.
Was Jacobs meint, schreibt er einige Zeilen weiter unten „... Und doch wollen wir uns im Wesentlichen nicht bei der Kritik des ... DKP-Programms aufhalten. Hier würde ja doch immer das Maß durch eine Kritik am Sozialismus vorgegeben, und wir bewegten uns in den Grenzen, die die DKP gesteckt. Sondern wir wollen einmal den Versuch machen, auf der Basis der Kritik an anderen Versuchen, Grundlagen zu formulieren, von denen wir meinen, dass sie die richtigen, notwendigen wären, worin also wahrhaft Traditionen, die bisher schon entwickelt worden sind, aufgenommen und an die Zukunft der Arbeiterbewegung weitergereicht werden. Sonst fängt die Zukunft damit an, dass mit den Illusionen aufgeräumt werden muss, die auf der Grundlage von Fehleinschätzungen des realen Sozialismus Aufnahme in die Bewegung gefunden haben. Eine Zeit, die für sich selbst nicht unbedingt eine revolutionäre ist, die sich aber um die Reinheit und Wahrheit in der Theorie sorgt, ist dennoch eine revolutionäre.“
Nun ja, aber die absolute Wahrheit, die hat wohl niemand gepachtet, sie unterliegt genauso einer Fortentwicklung wie der menschliche Erkenntnisprozess selber und die Entwicklung der Produktionsverhältnisse. Ob anderseits Herrn Jacobs Erkenntnisse, welche er im Heft 3/2006 des offen-siv darlegte, dazu beitragen, dass man unsere Zeit im vorgenannten Sinne als revolutionär bezeichnen kann, wird wohl nicht allein von seinem Erkenntnisstand bestimmt.
Was versteht nun Herr Jacob unter Sozialismus: „Wir verwenden den Begriff „Kommunismus“ für alle Phasen der neuen Gesellschaft, also sowohl für die unmittelbar nachrevolutionäre Zeit als auch für die Zeit des Aufbaus der Planwirtschaft, im allgemeinen Aufbau des Sozialismus genannt, und natürlich für unser Ziel, die klassenlose Gesellschaft. Diese Wortwahl bevorzugen wir, weil darin die Kontinuität der kommunistischen Entwicklung besser ausgedrückt ist als in der begrifflichen Gegenüberstellung von Sozialismus und Kommunismus.“ Aha, Aufbau des Sozialismus simplifiziert auf den Aufbau der Planwirtschaft. Gestaltung eines ganzen Komplexes neuer komplizierter gesellschaftlicher Prozesse reduziert auf die administrative Ebene und dann, wie eingangs erwähnt, nur nahtlos anknüpfen wollend an den Entwicklungsstand, welcher im realen Sozialismus des 20. Jahrhunderts erreicht wurde. Das er, Jacobs, diese vereinfachte Vorstellung durchaus ernst meint, zeigt folgendes Zitat: „Was ist der wichtigste Gegenstand unserer Kritik am Programmentwurf der DKP? ... Dass die DKP den Zentralismus des realen Sozialismus ablehnt unter dem Motto der "erstarrten Initiative der Volksmassen"; also dieser Gegensatz von Zentralismus als dem gewählten Produktionsverhältnis und dem um seine "Eigeninitiative" gebrachten Volk, ... wenn denn der Zentralismus mit dem Begriff der Gesellschaft des Kommunismus zusammenfällt (wovon wir aber ausgehen); dann gibt es zwar auch ein Subjekt, aber es ist ein Subjekt des Zentralismus, d.h. ein solches Subjekt, das seine Initiativen und Freiheiten im Rahmen des Zentralismus realisiert, und nirgendwo anders. D.h. subjektlos muß deshalb der Kommunismus, der mit dem ökonomischen Zentralismus zusammenfällt, nicht sein.“ Die sozialistische Planwirtschaft war und wird auch in Zukunft lediglich Instrument beim Aufbau des Sozialismus sein, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Eine Gleichsetzung Zentralismus mit Kommunismus ist deshalb falsch. Was die DKP unter Sozialismus versteht, ist im Abschnitt „Das sozialistische Ziel“ Absätze 1 – 6) festgeschrieben. Der demokratische Zentralismus anderseits ist ein Organisationsprinzip marxistisch-leninstischer Parteien und im sozialistischen Staat. Im Abschnitt „Ursachen der Niederlage“ im neuen DKP-Programm wird im Absatz 3 von „Zentralisierung der Kräfte“ gesprochen, also eine Konzentration auf notwendige Schwerpunktaufgaben und nicht über die zentrale staatlich Leitung und Planung. Dies sind zwei Paar Schuh, auch wenn eine „Zentralisierung der Kräfte“ unter sozialistischen Bedingungen durch die zentrale staatlich Leitung und Planung zu realisieren ist. Das Jacobs die Aussagen unseres Programms falsch deutet und beides verwechselte, zeigt gleich der zweite Absatz im Kapitel „Entfremdung vom Eigentum“, der da lautet: „Verdammt. Wir sagen doch, dass der der Überwindung der Rückständigkeit gewidmete Zentralismus nur ein der Politik geschuldeter Zentralismus war. Der eigentliche Zentralismus, der mit der ökonomischen Entwicklung der Planwirtschaft entsteht, kommt doch erst jetzt, wo Ihr ihn gehen lassen wollt, aus der Geschichte verabschieden wollt. Welch ein Unterschied im historischen Verständnis des Kommunismus!“ Das wollen die Mitglieder der DKP mit Sicherheit nicht, weil dies gegen ihre gewonnenen Erfahrungen spräche, auch wenn es, zugegebenermaßen, so eindeutig nicht im Programm formuliert steht! Anderseits birgt die Verwendung des Begriffs Kommunismus in Jacobs Formulierungen, unabhängig davon, welche Entwicklungsphase er gerade meint, die Gefahr in sich, dass Missverständnisse geradezu provoziert werden!
Zu einer letzten Problematik aus Jacobs Artikel, welcher ich mich zuwenden möchte, der Frage der Warenproduktion im Sozialismus, welche er verneint, indem er die These aufstellt, „Warenproduktion ist Eigentumsproduktion! Die Ware ist eine Eigentumsform, und der Kommunismus keine. Eine allgemeine Eigentumsform hebt das Eigentum dem Begriff nach auf, es ist ja nur noch an die Arbeit, an die Kräfte der Arbeit im Ganzen zu binden. Eigentum aber unterstellt die Bindung des ökonomischen Verhältnisses an lediglich besondere Arbeit. Man kann die besondere Arbeit in einer gesellschaftlichen Form aneignen (der Wertform) - das ist Warenproduktion, als spezifische gesellschaftliche Form des Privateigentums. (Dass man immer wieder diese Selbstverständlichkeit des Marxismus wiederkäuen muss, ist schon ein Harm. Aber das hat mit der kommunistischen Illusion zu tun, Kommunismus sei lediglich Befreiung von der Ausbeutung, also von der kapitalistischen Klasse, und diese Befreiung stellt man sich als Rückkehr in die Vergangenheit vor). ... Gerade in der bürgerlichen Gesellschaft kann der Proletarier seinen ökonomischen Gegensatz, aus der Aneignung des Wertes ausgeschlossen zu sein, nicht lösen, sondern nur in einer Gesellschaft nicht des Wertverhältnisses; direkt aus dem Gegensatz zum Wertverhältnis resultiert der eigene Gesellschaftsanspruch des Arbeiters, der Kommunismus. Daher ist das Verständnis der Frage von Warenproduktion und Kommunismus wesentlich für den Kommunismus; ohne hier von Verständnis zu sein, ist kein Verständnis des Kommunismus möglich. Unkenntnis kann hier tödlich wirken.“
Herr Jacobs, welche Arroganz schlägt einem aus diesen Worten entgegen, alle anderen irren und ihre Thesen sind die absolute Wahrheit. Zur Aufklärung dieser Thesen bedarf es Fragen nach dem Charakter der Ware selbst, Warenproduktion, Wesen der Vergesellschaftung, Wertgesetze sowie der Ware-Geld-Beziehungen.
Ich beginne mich der Problematik mit Karl Marx seiner Kritik des Gothaer Programms zu nähern. Marx schreibt in seinen Randglossen im I. Abschnitt fast am Ende des ersten Punktes „Quelle des Reichtums und der Kultur wird die Arbeit nur als gesellschaftliche Arbeit. ...
2. ... kommunistische Gesellschaft ... Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch regelt, ... Inhalt und Form sind verändert, weil ... nichts in das Eigentum der Einzelnen übergehen kann außer individuelle Konsumtionsmittel.“
Es ergibt sich aus den Randglossen, dass im Sozialismus sehr wohl Warenproduktion herrscht, erst in der höheren Phase des Kommunismus wird die Verteilung eine andere sein.
Der Ware liegen auch im Sozialismus ihre drei wesentlichen Funktionen zugrunde. Sie ist das Produkt menschlicher Arbeit, sie befriedigt ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis und sie wird für den Austausch produziert. Die Ware ist auch im Sozialismus Träger von Wert und Gebrauchswert. Grundlage der Entstehung von Ware überhaupt war die gesellschaftliche Arbeitsteilung. Der Unterschied der Ware im Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus besteht darin, dass die menschliche Arbeitskraft keine Ware mehr ist, Grund und Boden aufhören, als Spekulationsobjekte zu dienen und Produktionsmittel nicht entgegen gesellschaftlichen Bedürfnissen erworben sowie genutzt werden können.
Also sind die in der sozialistischen Produktionsweise erzeugten Waren das Produkt ausbeutungsfreier menschlicher Arbeit, welche für die Befriedigung gesellschaftlicher und persönlicher Bedürfnisse hergestellt und ausgetauscht werden. Die Erfahrungen zeigen, dass diese Waren nur mit Hilfe des Geldes austauschbar sein werden.
Weder Markt noch Wertgesetz können im Sozialismus gesamtgesellschaftlich betrachtet eine spontan regulierende Rolle spielen, sie werden bewusst genutzt.
Der neue Inhalt der Warenproduktion und der Ware–Geld–Beziehungen besteht demzufolge darin, dass sie zur Festigung der Planwirtschaft und zur Förderung der Initiative der Produzenten genutzt werden. Im Sozialismus besteht zwar eine Übereinstimmung zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der gesellschaftlichen Form der Aneignung der Ergebnisse der Arbeit, aber der Charakter der sozialistischen Warenproduktion erzeugt anderseits auch einen unvermeidbaren Grad an Ungleichheit zwischen den einzelnen Produzenten. Durch Produktivkraftentwicklung und Ausgestaltung sozialistischer Produktionsverhältnisse wird dem entgegengewirkt werden können und so später ein neuer Vergesellschaftungsgrad der Arbeit erreicht werden. Marx beschreibt dies in seinen erwähnten Randglossen so: „In der höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst erstes Lebensbedürfnis geworden; ... erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.“
Dipl. oec. Klaus-Dieter Lange,
Grimma
H. Eildermann:
Josefs Fluch
Ihr raubt der Erde das Licht!
Ihr kämpft um die Herrschaft der Dinge
Über die Menschen. Vampir - gleich
Herrscht, die ihr tot seid,
Über die Lebenden. Ihr
Saugt ihre Lebenskraft aus
Für mehr tote Dinge, für euch.
Ihr habt Auschwitz gebaut.
Vietnam wolltet ihr in die Steinzeit bomben.
200 Jahr nach der Dampfmaschine
Verrecken in eurer Welt Jahr für Jahr
Zehn Millionen Kinder an Armut.
Ihr sperrt die künftigen Darwins und Einsteins
Aus den Schulen aus, schickt die Marx´
Und Heines ins Gas, stehlt den Mozarts die Geige,
ermordet die Virchows mit AIDS.
Täglich kommt eure „Ordnung“
Auf die Verdammten der Erde,
Schlimmer als jeder Tsunami,
Den die Natur fertig bringt.
Wie wenig Opfer dagegen
Mussten wir bringen, das Sterben
An Armut zu enden! Doch jährlich
Begründen die Schwätzer euch neu,
Warum es so sein muss
Wie es bei euch ist.
Lassen wir euch gewähren,
Bleibt eine Wüste für die,
Die nach uns dann kommen.
Ihr verurteilt uns, weil
Wir ein paar tausend Verräter
Und des Verrates Verdächt´ge
Erschossen haben, um euch
Aufzuhalten! Doch ihr
Verurteilt uns nicht einmal selbst.
Niemand wollte euch auch
Auschwitz begründen hören!
Ihr schickt eure Schwätzer vor.
Und die sagen tausende Worte:
Eins gegen euch, (Wer würde
Sonst auf sie hören?) Die andren
Sagen sie nur gegen uns.
Und viele von ihnen glauben
Sogar dem eigenen Geschwätz.
Ich sage euch: Die Menschen
Werden begreifen: Zusammen
Können sie nicht überleben
Mit euch! Denn ihr müsst
So sein vielleicht, wie ihr seid,
Aber sein müsst ihr nicht!
Wir aber helfen den Menschen,
Das zu begreifen, so wie
Wir ihnen damals halfen
Als ich noch lebte bei ihnen.
Schwätzer, besinnt euch beizeiten:
Wär´ es nicht klüger, gemeinsam
Mit den anderen Menschen
Am Leben zu bleiben?
An jener Wand, die da für
Die Feinde der Menschheit bereit steht,
Leuchtet als Menetekel,
Geschmückt von Hammer und Sichel
Der Name der Stadt, die von mir
Kündet als eurem Besieger.
H. Eildermann,
Hamburg
ANMERKUNGEN
-
"Die vom modernen Sozialismus erstrebte Umwälzung ist, kurz ausgedrückt, der Sieg des Proletariats über die Bourgeoisie und die Neuorganisation der Gesellschaft durch Vernichtung aller Klassenunterschiede... Erst auf einem gewissen, für unsere Zeitverhältnisse sogar sehr hohen Ent-wicklungsgrad der gesellschaftlichen Produktivkräfte wird es möglich, die Produktion so hoch zu steigern, daß die Abschaffung der Klassenunterschiede ein wirklicher Fortschritt, daß sie von Dauer sein kann ohne einen Stillstand oder Rückgang in der gesellschaftlichen Produktionsweise herbei-zuführen." (F. Engels: Flüchtlingsliteratur V, MEW 18, S. 556-557)
-
"Innerhalb der gesellschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln begründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus, ebensowenig erscheint hier die auf Produkte verwendete Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigenschaft, da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren... Womit wir hier zu tun haben, ist eine kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt." (K. Marx: Kritik des Gothaer Programms, - MEW 19, S. 19-20) Marx spricht an dieser Stelle eindeutig vom "ersten Stadium" des Kommunismus, vom Sozialismus, wo die Produzenten für die von ihnen geleistete Arbeit ohne Vermittlung durch den Markt als Gegenleistung Güter bekommen, die ebensoviel Arbeit enthalten.
-
W. I. Lenin, Rede über die Volksverdummung mit der Parole Freiheit und Gleichheit .. (Ges. Werke - Ungarisch - Bd. 38, S. 344). Die Leninsche Definition stimmt mit der von Marx stammenden Be-schreibung des Sozialismus überein, abgesehen davon, daß der Unterschied zwischen Arbeitern und Bauern und darum ein Warenaustausch zwischen ihnen weiter besteht.
-
S. Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus, Frankfurt/M. 1975, S. 189
-
Gütermangel und der davon untrennbare Bürokratismus kann den Warencharakter der Produktionsmittel verstärken. Die sowjetische Wirtschaft liefert dazu Beispiele: Da das Einkommen der Leiter der Unternehmen an die Planerfüllung gebunden war, diese jedoch durch Störungen in der Versorgung mit Produktionsmitteln und in der Zusammenarbeit der Betriebe gefährdet sein könnte, schlossen die Betriebe untereinander oft einen direkten - ungesetzlichen - Tauschhandel ab oder bestachen die Leiter der für die Versorgung zuständigen Organe, usw. Im letzteren Falle funktionierte das Geld in Wirklichkeit nicht mehr bloß als reines Verrechnungsmittel, sondern als reelles Umsatzmittel und vermittelte den Austausch von Produktionsmitteln.
-
"Weltgeschichte wäre allerdings sehr bequem zu machen, wenn der Kampf nur unter der Bedingung unfehlbar günstiger Chance aufgenommen würde". (K. Marx an Ludwig Kugelmann, MEW 33, S. 209).
-
K. Marx: Grundrisse der politischen Ökonomie. Erster Teil. In: Karl Marx: Ökonomische Manuskripte (1857 /58. Teil I. Dietz Verlag Berlin 1976, S. 102-103): - "Im ersten Fall, der von der selbständigen Produktion des Einzelnen ausgeht ... findet die Vermittlung statt durch den Austausch der Waren, den Tauschwert, das Geld, die alle Ausdrücke eines und desselben Verhältnisses sind. Im zweiten Fall ist die Voraussetzung selbst vermittelt; d.h. eine gemeinschaftliche Produktion, die Gemeinschaftlichkeit als Grundlage der Produktion ist vorausgesetzt. Die Arbeit des Einzelnen ist von vornherein als gesellschaftliche Arbeit gesetzt. Welches daher auch immer die besondre materielle Gestalt des Produkts sei, das er das schafft oder schaffen hilft, was er mit seiner Arbeit gekauft hat, ist nicht ein bestimmtes oder besondres Produkt, sondern ein bestimmter Anteil an der gemeinschaftlichen Produktion. Er hat darum auch kein besonderes Produkt auszutauschen. Sein Produkt ist kein Tausch-wert. Das Produkt hat nicht erst in eine besondere Form umgesetzt zu werden, um einen allgemeinen Charakter für den Einzelnen zu erhalten. Statt einer Teilung der Arbeit, die in dem Austausch von Tauschwerten sich notwendig erzeugt, fände eine Organisation der Arbeit statt, die den Anteil des Einzelnen an der gesellschaftlichen Konsumtion zur Folge hat. In dem ersten Fall wird der gesellschaftliche Charakter der Produktion erst durch die Erhebung der Produkte zu Tauschwerten und den Tausch dieser Tauschwerte post festum gesetzt. Im zweiten Fall ist der gesellschaftliche Charakter der Produktion vorausgesetzt und die Teilnahme an der Produktenwelt, an der Konsumtion ist nicht durch den Austausch voneinander unabhängiger Arbeiten oder Arbeitsprodukte vermittelt. Er ist vermittelt durch die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen, innerhalb deren die Industrie tätig ist."
-
K. Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4, S. 481
-
Hochentwickelte Länder würden "ursprüngliche Akkumulation" offenbar nicht benötigen; die weniger entwickelten könnten auch einen anderen Weg gehen, wenn wirtschaftlich starke befreundete Länder sie unterstützen.
-
Der Hauptinhalt des Überganges zum Sozialismus besteht in der Umwandlung der Mehrzahl der Individuen in gesellschaftliche Wesen, deren Verhalten zur Gemeinschaft schon dadurch bestimmt wird, daß sie sich als ihr zugehörig empfinden. Für privateigentümerische Ansichten ist so etwas ein Unsinn, eine Utopie. Doch die gemeinschaftliche Existenz ist die natürliche Lebensform der Menschen in den urtümlichen Jagdgemeinschaften, der Kämpfer der Revolutionen und der gerechten Kriege, der streikenden oder ganz einfach an die Ordnung der Großbetriebe gewöhnten Arbeiter. Der gesell-schaftliche Charakter der Arbeit, die Zusammengehörigkeit der Menschen verlangen eine Solidarität, und wenn es überhaupt eine "natürliche" Eigenschaft des Menschen gibt, so ist sie dies. Die moderne Biologie bestätigt überhaupt nicht, daß Aggression ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Wesenart sei; auch die Psychologie verwirft diesen Gedanken immer mehr, und Versuche beweisen, daß grundlegende Umwälzungen der Umwelt sogar solche aggressive Verhaltensweisen der Tierwelt zum Wegfallen bringen können, die man für unauslöschlich hielt. Andererseits ist es so, daß die vom Privateigentum genährte Konkurrenz auch die natürlichsten Eigenschaften auslöschen und in ihr Gegenteil umkehren kann. Die Frage besteht also nicht darin, ob eine gemeinschaftliche Gesellschaft eine Utopie sei oder nicht, sondern wie man solche Bedingungen schaffen kann, unter denen die von der Unmoral des Privateigentums angesteckten Menschen einem gemeinschaftlichen Charakter der Arbeit entsprechen können. Da die Menschen von ihrer Umgebung gestaltet werden, diese jedoch wiederum von den Menschen, geraten wir scheinbar in einen Teufelskreis. Diesen kann nur jene Klasse durchbrechen, die am stärksten am Zustandekommen der gemeinschaftlichen Gesellschaft interessiert ist, und auch sie nur unter Führung einer bewußten Vorhut.
-
Der Gedanke ist schon bei Engels auffindbar: "Die Kommune mußte gleich von vornherein anerkennen, daß die Arbeiterklasse, einmal zur Herrschaft gekommen, nicht fortwirtschaften könne mit der alten Staatsmaschine; daß diese Arbeiterklasse, um nicht ihrer eignen, eben erst eroberten Herrschaft wieder verlustig zu gehn, einerseits die alte, bisher gegen sie selbst ausgenutzte Unter-drückungsmaschinerie beseitigen, andrerseits aber sich sichern müsse gegen ihre eignen Abgeordneten und Beamten, indem sie diese, ohne alle Ausnahme, für jederzeit absetzbar erklärte." F. Engels, Einleitung zu "Der Bürgerkrieg in Frankreich". Ausgabe 1891, MEW 17, S. 623.
-
Das Gebiet, welches zur Mobilisierung der Massen in der am meisten direkten Form sich eignet, da es im größten Maße überschaubar ist, ist die soziale Verwaltung (Verwaltung von Wohnungen, Einweisung in Ferienheime, Beihilfen, usw.) und die örtliche Selbstverwaltung. Die letztere enthält solche elementaren, doch keineswegs leicht lösbaren Angelegenheiten wie die Kontrolle des Kleinhandels, der Sanitärversorgung, der Bautätigkeit, des Umweltschutzes; Fürsorge für Kranke und Alte; die Einrichtung von Kantinen, Nähereien, Waschanstalten, um das Leben der örtlichen Bevölkerung zu erleichtern usw. Das System selbst steht oder fällt mit der Beziehung zwischen der Partei und den Massen, gleich wie umgekehrt die Beziehung zwischen der Partei und den Massen weitgehend vom Sein oder Nichtsein der sozialistischen Selbstverwaltungs- und Aufsichtsformen abhängt.