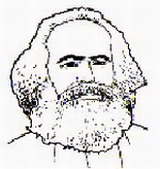Zeitschrift für Sozialismus und Frieden 07/07
Herausgeber: Verein zur Förderung demokratischer Publizistik (e.V.)
Spendenempfehlung: 1,60 €
Leo Kever
Wir haben uns immer gewehrt!
Aus dem Leben eines Kommunisten
Inhalt
- Konkrete Solidarität
- Redaktionsnotiz
- Leo Kever: Wir haben uns immer gewehrt
- Kindheit (1922 – 1934)
- Jugend (1935 – 1940)
- Reicharbeitsdienst und Einberufung zur faschistischen deutschen Wehrmacht (1941/42)
- Mit der Sechsten Armee an die Ostfront (1942)
- Verwundung und geschickte Ausweichmanöver (Herbst und Winter 1942/43)
- Frankreich und Heimaturlaub im faschistischen Köln (1943)
- Desertation in Italien (1943)
- Amerikanische und englische Gefangenschaft in Nordafrika (1943/44)
- Gefangenschaft in Amerika (19441946)
- Zurück in Europa (1946)
- Wieder in Köln (1946/47)
- Anfang der 50er Jahre – Ich soll mithelfen beim Aufbau der Bundeswehr
- Anhang
Konkrete Solidarität |
Leo Kever hat in den 70er und 80er Jahren gesammelt bzw. selbst aufgebracht:
- 4244 Zentner Arzneimittel gesammelt für Cuba, Nordkorea und Serbien
- 800 Autoreifen aus rund 10.000 als gut herausgesucht für Cuba
- 15.000 Brillen gesammelt und einzeln verpackt für Cuba
- einen gebrauchten Omnibus für Cuba gekauft und dorthin verschiffen lassen
- für 1.000 – 1.200 DM cubanischen Rum für die FG BRDCuba verkauft
- 4.000, DM als Darlehen für das revolutionäre Nicaragua gegeben .(und nach drei Jahren zurückbekommen)
(Beim Aussortieren und Verpacken der Hilfsgüter halfen zeitweilig die Genossen aus Dormagen L. und K. B. sowie die Genossen aus Köln A. L. und W. L. )
Redaktionsnotiz |
Dies Heft ist, gemessen an unserer sonstigen publizistischen Arbeit, eine eher untypische Veröffentlichung. Es geht diesmal nicht um Theorie, sondern um Erlebnisse und Erfahrungen eines inzwischen 85jährigen Kommunisten.
Es geht um die letzten Jahre der Weimarer Republik, um die Zeit der faschistischen Herrschaft in Deutschland und um die Erlebnisse und Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Im Anhang bringen wir noch einige Episoden aus den späten 80er und frühen 90er Jahren sowie eine Strecke gelebter Solidarität.
Wir haben dies Heft aus drei Gründen gemacht:
- Die noch immer oft und reichlich zu hörende Rede davon, dass man sich damals (zur Zeit des Faschismus und ganz besonders zur Zeit des Zweiten Weltkriegs) ja gar nicht wehren konnte, weil man dann sofort erschossen worden wäre, wird in jeder der einzelnen Stationen dieses Heftes und in jeder der einzelnen Episoden Lügen gestraft und damit als billige Ausflucht der verkappten Sympathisanten der Nazis, Mitläufer und egoistischen Feiglinge entlarvt.
- Die Realität von Krieg wird in aller Brutalität deutlich. Alle diejenigen, die sich für die so genannten „Frieden erhaltenden“ oder „Frieden schaffenden“, mit einem „robusten Mandat“ ausgestatteten Auslandseinsätze der Bundeswehr erwärmen können oder zumindestens zu bedenken geben, dass man doch jeden „Einzelfall“ genau prüfen müsse, sollten sich die Schilderungen der Fronteinsätze ansehen und sich vorstellen, dass sie selbst dort liegen.
- Es wird eine ganz hervorragende Haltung deutlich: „Diesem Staat keinen Mann und keine Mark“ – diese Abwandlung des BebelZitates äußerte Leo Kever bei seiner geplanten „Registrierung“ zum Aufbau der Bundeswehr gegenüber dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Es ist Opposition, grundsätzliche Opposition, schonungslose und unbeugsame Opposition – und zwar in allen Belangen. Hier richtet sich keiner mit den Verhältnissen ein, nein, hier kämpft einer sein Leben lang.
Vor allem diese Haltung war es, die uns dazu bewogen hat, dieses Heft zu machen. Wir können viel lernen von diesem aufrechten Gang.
Das Heft haben wir aus den von Leo Kever selbst aufgeschriebenen Erinnerungen und einem ausführlichen Interview mit ihm zusammengestellt. Er hat es korrigierend durchgesehen.
Leo Kever ist im Juni des Jahres 85 Jahre alt geworden. Wir gratulieren ihm mit diesem Heft nachträglich ganz herzlich mit einem kämpferischen „Rot Front“!
Redaktion Offensiv, Hannover
Spendenkonto Offensiv:
Inland: Konto Frank Flegel, Kt.Nr.: 30 90 180 146 bei der Sparkasse Hannover,
BLZ 250 501 80, Kennwort: Offensiv
Ausland: Konto Frank Flegel,
Internat. Kontonummer(IBAN): DE 10 2505 0180 0021 8272 49,
Bankidentifikation (BIC): SPKHDE2HXXX; Kennwort: „Offensiv“.
Leo Kever: Wir haben uns immer gewehrt |
Kindheit (1922 – 1934)
Am 23. Juni 1922 bin ich in KölnNippes, Ortteil Mauenheim, geboren. 1928 kam ich in die Schule. Erst bin ich in die Katholische Schule gekommen. Da blieb ich drei Jahre, bis 1931. Und dann kam mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater, und sagte zu meinem Vater:
„Warum ist der Junge in der katholischen Schule? Wir haben doch auch eine Freie Schule!“
Die war nun aber natürlich von der SPD, nicht von der KPD. Mein Eltern waren aber Mitglieder der KPD. Und deshalb hat mein Vater sich mit seinem Bruder noch rumgestritten, aber schließlich hat er gesagt: „Geht in Ordnung, Robert, Du hast Recht. Wenn der Junge bei der SPD zur Schule geht ist das immer noch besser als bei den Katholischen“.
So kam ich in die Freie Schule – bis 1933, bis die Nazis kamen.
Da muss ich nebenbei bemerken: Diese kurze Zeit, es waren knapp zwei Jahre, waren sehr wertvoll für mich. Mein ganzes Wissen aus der Schule habe ich praktisch alles in diesen zwei Jahren eingesaugt, da habe ich mehr gelernt als in den anderen acht Jahren – erst bei den Katholischen, nachher bei den Evangelischen. Aber das nur nebenbei gesagt.
Also: mein Vater war in der KPD, meine Mutter auch. Meine Eltern haben uns als Kinder ja schon alles miterleben lassen. Wir waren nicht ausgegrenzt. Ich weiß noch genau, wie meine Mutter erzählt hat:
„Ihr hättet eigentlich noch mehr Geschwister. Wir haben zweimal wegmachen lassen.“
Das hat unsere Mutter uns ganz offen erzählt.
„So viele Kinder konnten wir nicht ernähren, wir konnten sie nicht brauchen“
Wir waren aufgeklärt, meine Eltern haben auch nie diesen Quatsch mit dem Christkindchen mitgemacht, das gab’s bei uns nicht. Meine Mutter sagte:
„Kinder, das ist alles Blödsinn mit dem Christkind. Was Ihr Weihnachten geschenkt bekommt, da muss der Papa schwer für arbeiten.“
Das war bei uns alles perfekt.
Zurück zur Freien Schule: Wir kriegten freies Lernmaterial und alles, was wir brauchten in der Freien Schule, alles von der SPD. Trotzdem haben wir als Kinder in der Freien Schule eine Streikaktion durchgeführt. Da war ich zehn Jahre alt. Da hat ein Lehrer einen von uns geschlagen, aber nur aus Wut irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das gewesen ist, wir müssen ihn dermaßen geärgert haben, dass ihm eine Sicherung durchgebrannt ist, und da hat er einen geschlagen. Da sind wir alle aufgestanden und haben protestiert. Und 100 Meter weiter war damals das SPDOrtsgruppenbüro in KölnNippes, da wurde auch die Rheinische Zeitung herausgegeben, das war die SPDZeitung. Und da haben wir davor protestiert, da kamen die raus, fragten: „Was ist los?“ „Der Lehrer hat die Kinder geschlagen“ und so weiter, da sind wir sogar in die Zeitung gekommen. Na, schließlich sind wir wieder zurück in die Schule. Der Lehrer hat sich total gewundert, wie wir so was machen konnten. Ja, aber schließlich war wieder Frieden und Eintracht.
Und dann gab es diesen Angriff auf meine Eltern und uns im Herbst 1932. Ich war immer noch zehn Jahre alt. Wir saßen in meinem Elternhaus zusammen: meine Schwägerin, die war zum ersten Mal da an dem Tag, dann mein ältester Bruder, der war schon Mitte zwanzig, ich war ja der Jüngste. Er stellte uns seine Braut vor und so weiter. Dann meine Schwester mit ihrem Mann, die waren hier. Und von nebenan der Bendermachers Christian, der Bendermachers Eugen, die waren auch hier. Die waren alle nicht in einer kommunistischen Organisation, aber Sympathisanten. Und dann war der Menzes Albert hier, der war im RFB. Und vom Arbeitersportverein war der Hannes da, der war ein Freund meines Bruders, die gingen immer zusammen paddeln. Ich weiß nicht mehr genau, wer sonst noch hier war. Dann meine Eltern natürlich und mein mittlerer Bruder, der war damals vierzehn. Unsere Bude war gerammelt voll. Und uns war ein Schäferhund zugelaufen, gerade an dem Tag. Ein herrenloser Hund. Als wenn er was gespürt hätte, der kam überall hin mit, sogar in den Keller, und wollte nicht mehr weg.
Auf einmal, wir sitzen alle in der Küche und mein mittlerer Bruder saß am Fenster, sagt der plötzlich: „Drüben stellen sich die Nazis auf.“ „Wieso Nazis?“ Ja, dann gucken wir: da standen sie, braune Uniformen, drüben auf der anderen Straßenseite. Sagt noch einer von uns: „Wer weiß, was die wollen, ach lass die mal, die ziehen bestimmt gleich wieder ab.“
Auf einmal brüllen die Nazis „Du Schwein“ und schießen schräg an unserem Haus vorbei. Der Nachbar, der Vater vom Eugen und vom Christian, der gerade auf dem Weg um die Ecke kommt, wird getroffen und schreit: „Die Nazis, die Verbrecher! Die haben mich erschossen!“ Zum Glück hatten sie aber nicht richtig getroffen, nur den Arm gestreift. Aber die Söhne sind ja bei uns und hören das. „Die haben unseren Papa erschossen!“ Und der Christian reißt die Tür auf und schreit: „Die Straßen frei dem roten Bataillon!“ und stürmt raus und natürlich alle hinterher. Da sind die Nazis ins Laufen gekommen und sind dann so 50 oder 60 Meter weiter erst wieder stehen geblieben. Auch meine Eltern waren mit rausgelaufen und standen drüben auf der anderen Straßenseite an der Bahnmauer. Und dann haben die Nazis, diese Verbrecher, immer von ca. 50 – 60 Metern auf die Mauer des Bahndamms gezielt. Es war zum Glück dunkel, immer auf die Mauer gezielt, aber nicht getroffen. Am nächsten Tag haben wir dann die Einschüsse an der Bahnmauer gesehen, in der Mülltonne und vor dem Haus in der Treppe. Und den Hund haben sie erschossen, das arme Tier.
Am nächsten Tag, meine Eltern haben sofort die Mordkommission alarmiert, kamen die dann an und haben alle Einschüsse markiert. Die in der Bahnmauer sah man noch jahrelang.
Das war im Herbst 1932, die Nazis waren schwer im Vormarsch. Wir hatten zwei der Verbrecher erkannt. Der eine wohnte uns vom Garten genau gegenüber, das war der Stiefsohn dieser Nazis, war bei der SS. Und schräg dort gegenüber der Sohn war auch mit dabei, der war von der SAFührung hier. Wir haben sie angezeigt, wir hatten sie ja erkannt. Aber was ist damit geworden? Sie sind verhaftet worden. Vorher flüchteten sie auf den Friedhof, wo die Polizei sie von den Bäumen herunterholten, aber ein paar Wochen später waren die Nazis an der Regierung, da wurden die natürlich wieder freigelassen. Nach dem Krieg hast Du von denen hier nichts mehr gesehen.
Ich ging zu der Zeit noch immer auf die Freie Schule, aber nicht mehr lange. Die Nazis kamen ja bald an die Macht. Im Februar 1933 sagte unser Klassenlehrer – er wohnte auch hier in KölnMauenheim, wie wir, der Lehrer Strausberg, den Namen vergesse ich nie, er war ein junger Mann noch, wir waren so zehn, elf Jahre, er war so an die 30, Ende 20, der ging mit uns durch Dick und Dünn, wir gingen wandern, so richtig kameradschaftlich und alles, also da sagte der:
„Kinder, die Nazis kommen. Wir verteilen jetzt alles, was wir noch haben an Lehrmaterial, Büchern, Zeichenblöcken, Stiften.“
So wurde alles verteilt, damit den Nazis nichts in die Finger fiel.
Dann hat es nur noch einige Tage gedauert, da kamen die Nazis in die Schule rein, wir wurden rausgeschmissen, beschimpft: „ihr Sozialistenlümmels, ihr Lumpen, diese Brut“ und so weiter, und die Lehrer haben sie sofort geschnappt, verhaftet, von denen haben wir nichts mehr gehört, wirklich, nichts mehr gehört. Wahrscheinlich sind die ins KZ gekommen oder sogar gleich umgebracht worden.
Danach wurden meine Eltern dann gezwungen, mich zu den Pimpfen zu geben. Das war die NaziOrganisation für die Kinder bis 14 Jahren. Und da musste ich nun hin. Ich wehrte mich:
„Nee, das will ich nicht! Nee, da geh’ ich nicht hin!“
Aber mein Vater sagte: „Du musst dahin, das geht nicht anders.“
„Ja aber dann will ich ins TambourKorps“, sagte ich. „ich will da nicht mitmarschieren!“
„Ja, gut“, sagte mein Vater.
Und so musste ich ins TambourKorps gehen. Wir mussten dann doch mitmarschieren.
Inzwischen war 1934, und mein Vater war ja Kassierer für die Rote Hilfe. Jetzt muss ich etwas ausholen. Wir hatten hier einen SAArzt, also der war Amtsarzt für die SA und das war unser Hausarzt. Der wusste, dass wir Kommunisten waren, aber er ließ das so, na gut. Seine Frau war schlimmer, die war NSFrauenschaftsleiterin von Mauenheim, das war das Miststück. Der Idiot von Arzt hat sich von der und von der SA praktisch missbrauchen lassen. Und dann war er stolz auf den Posten, lief in der braunen Uniform herum – und dann den Arztkittel drüber. Aber als Arzt war er einwandfrei. Der hat uns immer geholfen, obwohl er wusste, dass wir Kommunisten waren. Das hat für den nichts bedeutet, das muss ich ehrlich sagen.
Und dann war meine Mutter wieder einmal krank. Da kam der hier rein, und mein Vater hatte hier noch das Buch mit den RoteHilfeMarken und die Abrechnungen liegen. Da sagt der:
„Herr Kever, sind Sie verrückt? Sind Sie wahnsinnig? Wie können Sie das hier so rumliegen lassen?! Sie wissen doch, ich bin Amtsarzt bei der SA – und Sie haben hier die Rote Hilfe liegen. Ich müsste Sie ja gerade ins KZ bringen!
Lassen Sie die Sachen hier verschwinden – ich habe nichts gesehen!“
Und damit war das für ihn erledigt. Also so war der in Ordnung. Wir hatten viel, viel Glück hier in Mauenheim, normaler Weise gab’s das nicht. Aber hier kannten wir uns alle und wir, die Kommunisten, waren hier verwurzelt. Und wir konnten uns manchmal auch wehren.
Hier nebenan wohnte ja die stellvertretende NSFrauenschaftsleiterin, die Stellvertreterin von der Arztfrau. Und der hat meine Mutter erst die Nase blutig und dann die ganze dreckige Schnauze zerschlagen. Und das kam so: Früher hatten wir so Doppelfenster, die Flügel konnte man einzeln aushängen. Meine Mutter hatte die ausgehängt und wollte die sauber machen. So standen die draußen an der Hauswand. Da kommt diese stellvertretende Frauenschaftsleiterin und hat die Fenster umgeschmissen. Wir hörten hier drinnen das Klirren, und meine Mutter ist dann rausgegangen. Da ging dieses NaziMiststück quer durch die Blumen und sagt:
„Sehen Sie, Frau Kever, so macht man das!“
Da sagt meine Mutter: „Ach, Frau Meyer, warum denn so gehässig, das macht man doch unter Nachbarn nicht“.
Und sie stellt die Fenster wieder auf. Währenddessen kommt die Alte meiner Mutter immer näher und näher. Auf einmal greift meine Mutter zu und haut ihr direkt links und rechts ins Gesicht. Die hatte dann die Nase aufgeplatzt, die Schnauze am Bluten. Und meine Mutter sagte:
„Frau Meyer, so macht man das, so macht man das, so macht man das!“
Ja, das war meine Mutter. Sie war einfach so. Da gibt es noch eine Episode, um ein Bild zu kriegen von meinem Elternhaus. Hier etwa einen Kilometer weiter gab es damals eine Ziegelei. Da gab es auch immer Bruchsteine, und die haben wir uns hier alle geholt, für den Schuppen oder den Hühnerstall und so weiter. Mein Vater auch, mit der Schubkarre hin und Bruchsteine geholt. Auf einmal steht die Verwalterin von der Ziegelei, Frau Moor, draußen vor der Tür auf der Straße und schreit da:
„Frau Kever, Frau Kever, Ihr Mann, der Spitzbube, der hat hinten Steine bei uns gestohlen auf der Ziegelei, der hat Steine gestohlen!“
Da geht meine Mutter an die Tür und sagt:
„Frau Moor, wenn man so was zu reden hat, da schreit man nicht über die Straße. Kommen Sie bitte rein, das wollen wir dann hier regeln.“
„Ja, ich komme.“
Frau Moor kommt rein, meine Mutter schnappt sie sich am Kragen und haut ihr ein paar in die Schnauze und sagt: „Frau Moor, Sie Dreckschwein! Was hat mein Mann? Wiederholen Sie!“ Dann macht meine Mutter die Türe auf, tritt die Alte in den Arsch, die fliegt auf die Straße, und meine Mutter sagt: „Frau Moor, Sie wissen doch, dass hier eine Stufe ist, passen Sie doch bitte auf. Jetzt sind Sie so gefallen!“
Und das muss ich auch noch erzählen, das war so 1935, 1936: Also auf der anderen Seite nebenan wohnten Kommunisten und dann Sozialdemokraten, hinten gegenüber waren drei Häuser – alles Nazis. Da wohnte auch die Schwiegermutter von dem SAFührer, die Frau Kramer, deren Tochter die Frau dieses NaziLumpen war.
Meine Mutter unterhält sich also mit den Nachbarinnen, da brüllt die:
„Halt die Schnauze, Du dreckige Kommunistensau!“
Und da sagt meine Mutter, natürlich extra laut zu den Nachbarinnen, mit denen sie gerade sich unterhalten hatte:
„Sie haben doch gehört, was die Frau Kramer gerade über mich gesagt hat. Was sagt unser Führer: Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch deutsche Volksgenossen. Frau Kramer, das melde ich Ihrem Führer! Sie werden noch von mir hören.“
Es hat keine zehn Minuten gedauert, da stand die Alte hier und sagte mit Tränen in den Augen: „Frau Kever, bitte, bitte, ich habe es nicht so gemeint, ich weiß, ich habe eine lose Schnauze, Sie kennen mich, ich meine das doch gar nicht so“, und hat um Abbitte gebettelt noch und noch und noch.
„Na ja“, sagt meine Mutter, „ist gut, Frau Kramer, wir wollen uns keine Schwierigkeiten mehr machen, ich verzeihe Ihnen, ist in Ordnung.“
Das war schon toll, wie die auf einmal meine Mutter angebetet hat, obwohl sie ja kurz vorher noch die „Kommunistensau“ gewesen war.
So war meine Mutter. Ein letztes noch, dann kommen wir auch wieder zurück zur Schule. Mein mittlerer Bruder, der vier Jahre älter war als ich, ging ja auch zur Katholischen Schule. Und eines Tages hat der Pfaffe den geschlagen. Der kam nach Haus, sagt die Mutter:
„Was ist mit Dir?“
„Ja, der Pfarrer hat mich geschlagen.“
„Der Pfaffe, wo wohnt der?“
„Ja, der wohnt direkt im ersten Haus in Weidenpech“
Und der musste immer von der Kirche an der Kirchhofsmauer vorbei nach Hause gehen.
„Ooch“, sagte meine Mutter, „beruhig’ Dich, ich regle das.“
Und was macht die? Die passt den abends nach der Kirche an der Mauer ab, als er von der Messe kommt und fällt über den her, schlägt den links und rechts, zerkratzt ihm das Gesicht und die Platte und sagt:
„Du Dreckstück, Du fasst meinen Jungen nicht mehr an.“
Und zwei weitere Geschichten möchte ich noch von meiner Mutter berichten (allein über sie könnte ich ein ganzes Buch schreiben):
Im Ersten Weltkrieg war sie in Köln als Straßenbahnfahrerin beschäftigt – bei Schnee und Eis im ungeheizten Führerhaus. Bei jeder Weiche musste sie runter vom Zug, das Weichenstelleisen über der Schulter vor zur Weiche, dann wieder zurück zur Bahn. Dabei nichts Vernünftiges zu essen außer Graupen und Steckrüben. (Konrad Adenauer war damals Oberbürgermeister von Köln und hieß im Volksmund „SteckrübenGraupenauer“.
Als meine Mutter die Schnauze voll hatte, hielt sie einfach die Bahn an, nahm das Weichenstelleisen auf die Schulter und befahl den Fahrgästen: „So, alles aussteigen! Jetzt marschieren wir zum Streik!“ Es war 1916 oder 1917. Dann kam berittene Polizei und zerteilte den Streikzug. Sie war die Anführerin eines der ersten Streiks in Köln!
Und so 1935/1936 war es, da ereignete sich folgende erwähnenswerte Episode. Neben uns wohnte ja die stellvertretende NSFrauenschaftsleiterin. Ihr Mann war ein langer, dünner Bayer, „der Sepp“ genannt – ein verkommenes NaziMiststück. Der hatte nun meine Eltern bei der Ortsgruppe angezeigt: bei uns wären immer kommunistische Versammlungen. Mein Vater war inzwischen auch auf der Straßenbahn.
„Oh Frau, was soll das werden?!“
„Keine Bange“, sagte die Mutter, „halte Dich ruhig. Ich werde das schon machen.“
Es war ein schöner, warmer Sommertag. Meine Mutter nimmt den Regenschirm und die beiden gehen zur Ortsgruppe. Familie Meier war schon dort. Als meine Eltern kommen, fängt der „Sepp“ schon an:
„Jaoh, wissen´s, Herr Oatsgruppenleita, doa bei die Kävers, doa kummtz immer so a kommunistsch Gesindl aoh!“
Meine Mutter wie eine Furie mit dem Schirm auf den los:
„Du widerlicher, gehässiger Bayer!“ – und schlägt ihn mit dem Schirm.
„Du Halunke vergiftest mir die Hühner! Ich habe aufgepasst und Dir aufgelauert, wie Du meinen Tieren Giftkörner gestreut hast. Da habe ich Dir heißes Wasser über die Pfoten gekippt. Und deshalb willst Du mich jetzt hier beim Ortgruppenleiter verleumden. Noch ein Wort von Dir, und ich schlage den Schirm auf Deinem bayerischen Schädel total kaputt!“
Der Ortsgruppenleiter, ganz entsetzt: „Macht, dass Ihr alle hier rauskommt! Wie ich sehe, ist das ein ganz gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit, der nichts mit der Partei und mit der Ortsgruppe zu tun hat.“
So hatte die Mutter wieder die Situation gerettet. Das mit den Hühnern war natürlich erfunden.
Zurück zur Schule: nun war ich ja nach der Auflösung unserer Freien Schule auch wieder in die Katholische Schule gekommen. Bei den Katholischen stellte ich dem Pfaffen so viele kritische Fragen über Adam und Eva – oder die heilige Maria mit ihrer Jungfrauengeburt und dergleichen mehr, dass ich als Störer des Unterrichts nach Hause geschickt und von da ab vom Religionsunterricht ausgeschlossen wurde. Und nun war ich ein Jahr bei den Katholischen gewesen, da hab’ ich gesagt: „Nee, bei denen bleib’ ich nicht, ich will hier raus, ich geh’ zu den Evangelischen“.
„Ja, ist in Ordnung“, sagten meine Eltern, kein Wunder bei dem Pfaffen, und so kam ich in die Evangelische Schule. Dort war es ganz in Ordnung, ich bin dann bis zum Ende der Schule, also bis zu meinem 14. Lebensjahr, bei den Evangelischen geblieben. Danach habe ich eine Lehre gemacht als Vulkaniseur.
Jugend (1935 – 1940)
Nach den Pimpfen sollten wir in die HJ. Dazu muss ich sagen: hier war das so, dass von meinen ganzen Kumpels keiner in der HJ war. So ist dann erstmal keiner von uns gegangen. Aber dann wurde geworben, kommt doch, Ihr könnt auch in die MarineHJ, ja, Ihr kommt aufs Schiff. Und da haben sich doch tatsächlich zwei gemeldet, aber wir anderen nicht. Und dann waren sie immer hinter uns her, die Nazis. Immer hinter uns her. Da haben wir zum Beispiel hier am Marktplatz Musik gemacht, ich hatte ein Akkordeon, andere hatten Gitarren und einer konnte gut singen, dann haben wir da Musik gemacht. Dann haben die Nazis uns eingekreist, auf einen LKW geworfen und mitgeschleppt ins HJHeim. Wenn wir noch mal so auftreten würden, kriegten wir Prügel. Und es war auch so, sie haben uns gejagt hier durch den Stadtteil, erst mit der HJ, dann auch mit der SA.
Deshalb sind wir nachher ausgewichen. Ungefähr einen Kilometer weiter von hier ist eine alte Ziegelei gewesen. Da haben wir uns dann immer da getroffen, haben diskutiert, musiziert, Mundharmonika gespielt, Akkordeon und alles so was. Und einmal dann kamen zwei von uns, sie waren Brüder, mit der Idee: „Mensch, wir machen einen Schützenverein auf! Und da machen wir die Kapelle.“ Ein paar von uns waren ja schon im TambourKorps bei den Pimpfen gewesen, so hatten wir unseren halben Schützenverein schon zusammen. Da brauchten wir nicht zur HJ, im Schützenverein waren wir geschützt. Denn so ein Schützenverein galt bei den Nazis als ein deutschnationaler Verein. War er ja auch, wurde er doch von den alten Zentrumsleuten, der Kirche und anderen konservativen Kräften finanziert. Trotzdem lehnten wir auch ab, vor oder für die Kirche zu spielen.
Es gab Uniformen, schwarze Hose, weißes Hemd, grüne Jacke und wir waren der Musikzug. Wir waren der einzige Jungschützenverein und viel eingeladen hier in Köln und Umgebung, in Nippes, Mauenheim, Kerpen, Niel, Frechen, was weiß ich.
Plötzlich wurden wir von der SA aufgefordert: „Ihr müsst für uns spielen!“
Ja, was jetzt machen?
„Wir kommen aber nur in der Schützenuniform, wir haben keine braunen Hemden und auch sonst nichts.“
„Ja, braune Hemden kriegt Ihr von uns“, sagte die SA. „Ihr müsst nur braune Hosen anziehen“.
„Haben wir nicht!“
„Dann müsst Ihr eben andere Hosen anziehen“.
Dann haben wir uns wie ein Karnevalsverein angezogen: jeder zwar ein braunes Hemd, aber eines war dunkelbraun, eins hellbraun und so weiter, und fast jeder eine andere Hose, jeder eine andere Krawatte, alles bunt durcheinander. Da sind wir hier am Marktplatz abmarschiert, und schließlich waren wir kurz vor dem Versammlungsplatz. Da sollte der NaziGauleiter Grohe sprechen, der war hier bei den Nazis ein hohes Tier, und wir sollten da spielen. Als die Offiziellen uns sahen, haben die uns dann lieber schnell nach Hause gejagt: „Ihr dreckigen Schweine, ihr Verbrecher, Hunde, wenn wir Euch wieder kriegen, wartet nur“ und so weiter. So sind wir da davon gekommen.
Und dann haben wir einem Nazi, einem SASturmFührer, aufgelauert. Keiner hat es rausgekriegt, dass wir das waren. Wir waren zu viert, damals so 16, 17 Jahre alt. Dieses NaziSchwein hatte im Ersten Weltkrieg einen Arm verloren, deshalb hatte er einen künstliche Arm, wir nannten ihn immer „der GummiArm“. Und der wohnte da an der Ecke, wo wir uns auf dem Marktplatz immer trafen, und dieses Schwein hat uns verpfiffen und die SA alarmiert, dass die uns verprügelten. Da haben wir dem aufgelauert, eines Abends, mit vier Mann. Wir hatten einen ZweiZentnerSack, stülpen ihm den über den Kopf und dann haben wir den vermöbelt, wir haben den zusammengeschlagen und dann liegen gelassen. Es ist nie einer darauf gekommen, dass wir das hätten sein können. Dabei haben sie immer nachgeforscht: Wer war hier im RFB, wer war hier in der Kommunistischen Staffel, aber sie konnten uns nie auf die Spur kommen. Deshalb war eine Zeit lang dicke Luft in Mauenheim.
Das war so unsere Jugend hier.
Reicharbeitsdienst und Einberufung
zur faschistischen deutschen Wehrmacht (1941/42)
Am 4. Januar 1941 kam ich zum Reichsarbeitsdienst (R.A.D.). Nach einem etwa dreiwöchigen Aufenthalt in einem Lager in der Eifel ging es mit dem Zug ins besetzte Frankreich, nach „Samer“, einem kleinen Ort in Nordfrankreich, im Pas de Calais. In dieser Sklaveneinheit, die laut NaziKanzler Kiesinger (von Beate Klarsfeld wegen seiner NaziVergangenheit zurecht öffentlich geohrfeigt), ja die „Schule der Nation“ sein sollte, verbrachte ich neun Monate meiner Jugend.
Wir waren gerade erst 18 und mussten schuften wie die letzten Kulis – bei weniger und schlechter Ernährung. Straßenbau und Flugplätze anlegen für die deutschen Jagdflugzeuge und die deutschen „Fliegerasse“. Bei der harten Arbeit und der schlechten Ernährung mussten wir auch noch strafexerzieren.
Zu dieser Zeit flogen die britischen Bomber schon erste Luftangriffe auf deutsche Städte, so auch auf Köln. Aus unserer Heimatstadt kamen Berichte, Briefe usw. über diese Angriffe.
Eines Tages platzte uns der Kragen. Nach dem Einrücken von der Arbeit sollten wir noch verschiedene Appelle wie Uniformappell, Arbeitszeugappell usw. über uns ergehen lassen. Wir weigerten uns alle, legten uns einfach auf unsere Matratzen und verriegelten die Türen. Die Führer brüllten, tobten und machten sonst was. Wir standen nicht auf. Am nächsten Tag sollte dann Strafexerzieren sein – am Sonntag, und wir hatten arbeitsfrei! Wir hängten die Briefe und Berichte aus unseren Heimatstädten, auch aus Köln, gut leserlich an die Tür und legten uns wieder ins Bett.
Nun kamen sie wutentbrannt: „Raus mit Euch!“
Wir brüllten: „Schaut auf die Tür! Lest, was wieder in Köln los war!“
Sie zogen uns aus den Betten, dabei dauerndes Gebrüll „Raus mit Euch!“ – „Verdammtes Pack“ usw. – und wir kletterten wieder in die Betten, sie zogen uns wieder raus.
Nun muss man wissen, dass „Samer“ wirklich ein kleines Dort war. Wir waren dort mit etwa 80 Mann. Zwei Gruppen lagen am einen Ende des Dorfes, zwei Gruppen am anderen Ende und in der Mitte befand sich die Führerschaft. Als es uns zu toll wurde, standen wir auf und marschierten von beiden Seiten aus zum Führerquartier unter Absingen des Liedes:
„Wir sind von Hoffmanns Tropfen RADRegiment,
Haben ein Brett vor dem Kopf, dass uns keiner mehr erkennt.“
Und die Strophe ging so:
„Er wollte mal und konnte nicht, er hat ihn in der Hand,
da ist er aus Verzweiflung in der Stube rumgerannt
Er wollte mal und konnte nicht, das Loch war viel zu klein,
der Kragenknopf der passte nicht ins Oberhemd hinein.“
Das Lied hatte so 67 Strophen. Den Refrain (Hoffmanns Tropfen) sangen wir dann noch mal vor dem Führerquartier. Und das alles natürlich unter Beifall und Gelächter der Bevölkerung, die ja merkte, was bei uns los war, zumal unsere Führer, diese Waldheinis (sie kamen aus dem Bayerischen Wald) herumbrüllten und Schaum vor der Schnauze hatten. Wir kriegten zu hören:
„Ihr dreckigen, verfluchten Halbfranzosen!“ „Eure Eltern hätte man kastrieren müssen!“ „Euch hätte man gleich nach der Geburt erschlagen sollen!“
Und: „Wir freuen uns über jede Bombe, die auf Köln fällt!“
Nun war natürlich erst recht Stimmung in der Bude. O je, o je, da ging es erst richtig los. Wir antworteten: „Ihr widerlichen bayerischen Hinterwäldler, wir drehen Euch den Hals um!“ usw. Einige von uns wollten auf die Strolche los und sie verprügeln. Hätte eine Seite Waffen gehabt, ich glaube, es hätte Tote gegeben. So war die Stimmung.
Es war einfach wunderbar – und das alles unter den Augen unseres „Erbfeindes“.
Die Sache wurde natürlich an höchster Stelle beim Führer des Reichsarbeitsdienstes, Robert Ley, gemeldet. Von wem? Wir hatten „zum Glück“ auch einige unter uns, deren Eltern gute Nazis waren. Die brachten die Meldung auf den Weg. So kamen die hohen Herren zu uns. Einige von uns mussten in den Bau, ich war natürlich auch mit dabei. Aber was sind schon ein paar Tage Arrest.
Einige unserer Führer wurden versetzt, wir bekamen die Ermahnung, so etwas nicht noch einmal zu wagen. Und der Dienst ging weiter.
Trotzdem kam es ab und zu doch zu Ungehorsam. Im Sommer gab es ranzige Margarine, und wir warfen das Zeug gegen die Küchentür, so dass in der Hitze die fettige, ranzige Brühe daran herunterlief. Niemand machte Meldung. Im September hieß es dann, dass wir bald nach Hause fahren würden. Von dem Tag an wagte keiner dieser Hinterwäldler mehr, unsere Stube zwecks abendlichem Stubenappell zu betrete. Stubenabnahme gab es nicht mehr, dazu hatten sie zu viel Angst. Da flog schon manchmal ein harter Gegenstand, wenn einer von ihnen es wagte, die Tür zu öffnen, schnellstens zog er den Kopf ein und die Tür war wieder zu.
Am 26. September 1941 fuhren wir mit dem Zug nach Deggendorf im Bayerischen Wald. Am 28. September kamen wir dort an und wurden aus dem RAD entlassen, in der linken Hand die Entlassungspapiere, in der rechten Hand den Stellungsbefehl für den 3. Oktober beim Vorläufer der Bundeswehr, der faschistischen deutschen Wehrmacht, in Krefeld zu erscheinen. Aus Köln sollte ich die Uniform des Reichsarbeitsdienstes nach Deggendorf zurückschicken. Ich steckte die Schandklamotten in einen alten, total schmutzigen Brikettsack und ab damit an den Absender.
Eine Bemerkung zum Schluss noch: Zu meiner RADEinheit gehörte auch der Bruder der weit über Köln hinaus bekannten Komödiantin, Kabarettistin und Schauspielerin Trude Herr. Eine ganz hervorragende, fortschrittliche Familie aus KölnNippes!
Am 3. Oktober 1941, ich war im Juni des Jahres 19 Jahre alt geworden, war es dann so weit: Ich durfte mich rühmen, ein würdiges Mitglied der großdeutschen Wehrmacht zu werden. Ich stand mit meinem Pappkarton auf dem Hauptbahnhof, einige meiner Kameraden aus dem R.A.D. standen mit mir auf dem Bahnsteig, und ich harrte der Dinge, die da kommen sollten. Und ich sollte diesbezüglich nicht enttäuscht werden. Zunächst kamen einige Männer auf mich zu mit je einer Kette um den Hals, je einem Stahlhelm auf dem Kopf und einem Schild auf der Brust: „Feldgendarmerie“, im Jargon der Landser auch „Kettenhunde“ genannt. Uns schwante natürlich nichts Gutes in Anbetracht der Präsenz der „Kettenhunde“, die uns zu unserem nächsten Bestimmungsort, nämlich Krefeld, begleiteten. Wir stiegen ziemlich bedrückt und geknickt in den Zug.
Nach einer Fahrt von etwa eineinhalb Stunden waren wir dann in Krefeld. Die „Kettenhunde“ lieferten uns bei der 4. KraftfahrerErsatzabteilung in der NassauKaserne ab. Da ging dann das übliche Theater los. Wir mussten erstmal auf dem Kasernenhof antreten, und dann stellten sich unsere kommenden Vorgesetzten vor. An erster Stelle der KompanieChef, ein Hauptmann sowieso, dann der „Spieß“, der Hauptfeldwebel – in Angst einflößender Pose. Danach kamen dann die Feldwebel und die Unteroffiziere dran. Nachdem dann so einige Reden, die wohl als Standpauken gedachte waren und die vollgestopft waren mit vaterländischen und führertreuen Parolen und vielen Drohungen, gehalten waren, wurden wir zu den Unterkünften gebracht. Wir waren so etwas ja schon von der „Schule der Nation“, dem Reichsarbeitsdienst, gewohnt, auch wenn hier bei der Wehrmacht der Drill und die Schikanen noch schlimmer waren. Vor allen Dingen fühlten wir uns jetzt sehr hilflos.
Kurz und gut, nachdem wir unsere „Stuben“ kannten, wurden wir zur Kleiderkammer befohlen. Hose, Jacke, Mütze, Schuhe, Stiefel, Strümpfe, Unterwäsche, Koppel und zuletzt stülpte uns jemand den Stahlhelm auf den Kopf. Jeder bescheidene Versuch eines kleinen Widerstands oder auch nur einer Anmerkung zur Kleidergröße wurde sofort im Keim erstickt mit dem kleinen Wort „passt“, manchmal wurden noch die markanten Wörter „Schnauze halten!“ hinzugefügt. Nachdem wir nun „eingekleidet“ waren, ging’s zum Waffenempfang auf die Waffenkammer. Dort bekam jeder ein Gewehr und, ich glaube, 20 oder 30 Schuss Munition. Das Seitengewehr hätte ich fast vergessen. Wir mussten es stets am Koppel, in der Scheide steckend, tragen.
Dann wieder zurück zur Stube und die Betten und die Spinde in appellgerechten Zustand bringen! Danach dann im Laufschritt zum Essensempfang. Denn kurz nach dem Essen ging es schon los.
Raustreten zur ersten Übung: Grüßen und Exerzieren! Als wir traurigen Gestalten nun da standen, dem einen schlotterten die Klamotten um die Knochen und dem anderen ging die Hose nur bis gut übers Knie oder die Jackenärmel nur gut über die Ellenbogen, gaben wir unseren neuen Herren natürlich willkommenen und wohl auch geplanten Anlass zu schönen Schikanen: „Ihr Arschgeigen“, „Ihr blöden Trottel“, „Ihr Arschlöcher von Palermo“, „Ihr bekloppten Filzläuse“, „Seht Euch mal an, wie Ihr ausseht“, „In diesem Aufzug wollt Ihr Eure Vorgesetzten grüßen“ und so weiter. „Das muss einfach bestraft werden! Ihr wollt es nicht anders, dann beginnen wir eben mit Strafexerzieren!“ Wer das erlebt hat und diesen sadistischen Menschenschindern jemals machtlos ausgeliefert war, weiß, was das bedeutet. Mehrere Stunden bei Kälte und Regen oder bei Staub und Hitze wie ein Stück Dreck herumgejagt zu werden, bis der letzte Uniformfaden durchgeschwitzt ist, die Knie schlottern, die Füße den Dienst versagen, die Zunge buchstäblich am Halse klebt und der ganze Körper vollkommen apathisch ist und man wirklich nicht mehr weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist, der weiß, wie uns zu Mute war. Jeder Ansatz eines eigenen Willens sollte gebrochen werden. Im späteren Verlauf unseres Drills heulte manch einer während des Strafexerzierens oder danach wie ein kleines Kind. Ich sagte immer und immer wieder: „Lasst Euch von diesen Verbrechern nicht unterkriegen! Die wollen damit doch nur erreichen, dass sich schon viele nach kurzer Zeit freiwillig an die Front melden.“ Ich sollte damit Recht behalten.
Nach dem Strafexerzieren ging es dann müde und zerschunden zurück auf die „Stuben“. Um sechs Uhr abends war „Essensempfang“ und um zehn Uhr „Zapfenstreich“ mit Stubenabnahme durch den „Unteroffizier vom Dienst (U.V.D.)“. Danach wurde das Licht gelöscht und alle träumten mit Schrecken vom nächsten Tag.
Das war der erste Tag in der Gemeinschaft der großdeutschen Wehrmacht. Und auf diese oder ähnliche Art verliefen auch die nächsten Tage. Eine Episode soll das verdeutlichen:
Wenn wir Scharfschießen hatten, musste die Kompanie drei bis vier Kilometer weit bis zum Schießstand marschieren. Auf dem Weg dorthin musste natürlich gesungen werden, und wenn nur irgendeinem der Unteroffiziere und Feldwebel das eine oder andere Lied nicht gefiel (und es gefielen ihnen immer verschiedene Lieder nicht), dann ging es: „Sprung auf! Marsch, Marsch!“ „Hinlegen!“ „Tiefflieger von links!“ „Panzer von rechts!“ und was es der schönen Dinge noch mehr gab. Auf dem Rückweg war dann gewöhnlich das Theater noch schlimmer als auf dem Hinweg. Durch die Schikanen schon auf dem Anmarsch, dann die Angst vor dem schlechten Abschneiden beim Schießen wurden viele „Fahrkarten“ und „Nullen“ geschossen. Das Ganze muss man sich so vorstellen: Die Scheiben wurden in einer Entfernung von 50 oder 100 Metern aufgestellt, je nach Planung des Schießens. Dann wurde entweder stehend, kniend oder liegend freihändig geschossen. Da die ganzen Anweisungen nur mit lautem Gebrüll und mit kernigen Zusätzen erfolgten, waren die meisten mit den Nerven herunter und total fertig, ehe das Schießen überhaupt begann. So kamen dann die vielen „Fahrkarten“ und „Nullen“ zusammen („Fahrkarte“ heißt, gar kein Treffer auf der Scheibe, „Null“ ist ein Treffer auf der Scheibe, aber außerhalb der 12 Ringe). Auf dem Rückweg waren dann die Hetzerei und die Schikane noch größer als auf dem Hinweg. Nun hatten sie ja einen triftigen Grund: Vergeudung von Wehrmachtseigentum, also Sabotage.
Ich stand – und mit mir noch einige andere – auf dem „LeckMichamArsch“Standpunkt. Aber vielen konnte man ansehen, wie sie sich das alles viel zu sehr zu Herzen nahmen und immer apathischer und widerstandsloser wurden.
Als nun so acht bis zehn Tage verstrichen waren, sollten wir vereidigt werden. Wenn heute Menschen sagen, ja, warum habt Ihr das alles mit Euch machen lassen und habt noch nicht einmal die Vereidigung verweigert, dann ist das eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Die meisten reden sich einfach damit heraus, dass man sonst erschossen worden wäre. Im Einzelfall stimmt das auch. Nur: hätten die das auch bei einer Kompanie oder einem Batallion oder einer noch größeren Einheit durchgeführt? Aber das Verbrecherische an dem verfluchten NaziRegime war die Angst, sich seinem Nebenmann, wenn man ihn nicht 100%ig kannte, anzuvertrauen, es konnte ja immer ein faschistischer Denunziant sein. Das war die Stärke des NaziRegimes, ein System der Angst und des Denunziantentums zu errichten. Diese Angst bestand noch bei Vielen auf den Schlachtfeldern im Angesicht des Todes. Das war die so genannte Tapferkeit des deutschen Soldaten. Einfach Angst, nichts als Angst vor den Vorgesetzen, der Gestapo, der Feldgendarmerie und den Erschießungskommandos.
So wurden wir denn zur Vereidigung geführt. Zu meinem Glück wurden wir in geschlossener Formation und nicht einzeln vereidigt. Was hätte ich da gemacht, die Vereidigung verweigert und mein Leben verwirkt – oder einen Meineid geschworen und mich vor mir selber geschämt? Aber im Verband war es natürlich wesentlich einfacher. Ich bewegte nur etwas die Lippen und sagte leise in etwa die Worte: „Ihr Verbrecher, leckt mich am Arsch!“ und ähnliche nette Sätze. Ich hatte danach ein entspanntes Gefühl und brauchte mich nie an einen Eid, der mir aufgezwungen wurde, gebunden fühlen. Dasselbe sagte ich auch später zu amerikanischen Militaristen, die die deutschen Soldaten ob ihrer Zackigkeit verehrten und bewunderten und uns Antifaschisten als Vaterlandsverräter betrachteten (als Amerikaner!), da wir gegen den Faschismus waren. Faschismus ist eben nicht auf ein Land oder im Einzelfall auf eine Armee begrenzt, in der amerikanischen beispielsweise gab es derer auch „en masse“. Aber vorerst weiter mit der deutschen Wehrmacht.
Die Vereidigung war nun vorüber und wir sollten den LKWFührerschein machen. Wir waren ja schließlich eine KraftfahrerErsatzabteilung. Wir sollten als LKWFahrer oder später als Panzerfahrer als Nachschub an die Ostfront kommen. Ich musste natürlich versuchen, da einen Riegel vorzuschieben. Also durfte ich zunächst mal den Führerschein nicht bestehen. Für Viele war die Führerscheinprüfung ein freudiges Ereignis, weil sie doch nun hoffte, aus dem Kasernendrill herauszukommen, und sei es auch auf Kosten einer Reise an die Ostfront. Denn mittlerweile hatte das größenwahnsinnige „Genie“ Adolf Hitler ja auch die Sowjetunion überfallen – wie so viele Länder vorher. Also, meine Kameraden mühten sich ab, den Führerschein zu bestehe. Ich wollte genau das Gegenteil. Aber trotz aller Bemühungen bestand ich ihn doch. Mir nahm leider keiner ab, dass ich zu doof war, um im Theoretischen nicht zu bestehen und zu nervös und fickerig, um ein Auto zu lenken. Da sich so Viele so sehr angestrengt hatten, hatte ich aber im Vergleich schlecht abgeschnitten und bekam die Wort mit auf den Weg, ich sei ein „blödes Arschloch“ und ich solle mich „in Zukunft in Acht nehmen.“
Kurz und gut, weil ich mich so dumm und ungeschickt angestellt hatte, wurde ich mit einigen Anderen nach Lingen an der Ems abgeschoben anstatt an die Ostfront. In Lingen wurde Infanteriedienst groß geschrieben. Dazu gehörte an erster Stelle das Scharfschießen. Nun war ich kein schlechter Schütze, ich war ja rund zwei Jahre im Jungschützenverein – statt in der HJ – gewesen. Weil ich aber immer bestrebt war, nie meine Haut zu Markte zu tragen für dieses verhasste System, war es nun kaum verwunderlich, dass ich immer zu den allerschlechtesten Schützen der ganzen Kompanie gehörte. Was dabei herauskam, war zwar manchmal Ausgangssperre und Strafexerzieren, aber das war mir egal.
Trotzdem hatte ich manchmal ab Sonnabend Mittag, 12.00 Uhr frei bis Sonntag, 24.00 Uhr. Da bin ich dann – auch ohne Urlaubsschein – nach Hause gefahren. Mit viel Glück und Geschick entging ich immer den Militärstreifen. Als ich einmal zu Hause ankam, war mein Bruder auch gerade, auch ohne Urlaubsschein, eingetroffen.
Mein Vater hatte im Luftschutzbunker während der Bombenangriffe Volksreden gehalten: „Leute! Diese Sondermeldungen, das sind alles nur Lügen! Ich gehe jetzt nach Hause und da höre ich den Engländer und dann komme ich zurück und berichte Euch, was wahr ist.“
Da haben sie ihn angeschissen. Nun musste er zum Ortsgruppenleiter kommen. Zum Glück war das auch ein alter Mauenheimer. Mein ältester Bruder, stationiert in Holland, ist zum Glück auf Urlaub in Köln. Mein Vater erzählt ihm das und fragt:
„Mein Gott, was machen wir denn jetzt!“
„Ach“, sagt mein Bruder, „ich gehe mit auf die Ortsgruppe“
So ist der dann in Frontuniform mit meinem Vater mit. Da sagt der Ortgruppenleiter:
„Herr Kever, was habe ich gehört: Sie haben im Bunker die Leute aufgehetzt und vom Engländer erzählt? Ja sind sie denn verrückt!?“
Da springt mein Vater auf: „Ja, hab ich gemacht! Stimmt das etwa nicht, was ich gesagt habe?“, und fängt schon wieder an, Volksreden zu halten.
Alle waren natürlich sprachlos, und da sagt mein Bruder: „Sehen sie denn nicht, dass der verrückt ist, dass der nicht zurechnungsfähig ist, der Alte?“
„Ja, Herr Kever, ich sehe es, nehmen Sie ihn nur mit und sagen Sie ihm, er soll gefälligst die Schnauze halten!“
1943 fiel mein mittlerer Bruder an der Ostfront – auf Geheiß des faschistischen Regimes. Am Rande sei hier nur bemerkt, dass mein Vetter und mein bester Freund von den verfluchten Nazis standrechtlich erschossen wurden. Ich bin selber auch mehrmals in hoher Gefahr gewesen. Aber davon berichte ich noch.
Inzwischen war ich schon fast drei Monate in Lingen an der Ems, in der „WalterFlexKaserne“ und wurde vorbereitet für das große Sterben für „Führer, Volk und Vaterland“ und sollte im Massengrab enden. Ich war noch immer 19 Jahre alt und das, was mir bevorstehen sollte, war so gar nicht nach meinem Geschmack.
Ein Marschbataillon wurde aufgestellt für die Ostfront (Nordabschnitt, Leningrad). Aber nun muss beim Militär ja alles seine Ordnung haben, also musste auch die Anzahl der Soldaten im Bataillon genau stimmen. Wie groß war die Aufregung, als sich herausstellte, dass es fünf oder sechs Mann zuviel gab (und das bei 1.000 Mann!).
Ich hatte mir schon das Gehirn zermartert, aber mir wollte keine Lösung einfallen, wie ich den Verein wechseln könnte. Der Zufall und meine typische Widerborstigkeit kamen mir zu Hilfe, als ich mich schon mit meinem Schicksal abgefunden hatte. Es war zwei oder drei Tage, bevor wir an die Leningrader Front fahren sollten. Wir hatten im Gelände unseren Dienst mit „Hinlegen!“, „AufAuf!“, „Tiefflieger von links!“ und mit PlatzpatronenSchießen gerade beendet. „In Reih’ und Glied aufstellen!“, hieß es dann, und: „Gewehre entladen!“ Das ging folgendermaßen vor sich: Das Gewehr wurde schräg vor dem Körper gehalten, so dass der Kolben rechts unter war und der Lauf nach links oben zeigte. Die linke Hand hielt nun das Gewehr und die rechte Hand öffnete das Schloss, so dass die Patronen heraus und auf die Erde flogen, von wo sie dann aufgehoben wurden. Weil mir das nun zu viel Arbeit war und ich wohl auch dachte, dass mir das zu blöde ist, hob ich das Gewehr hoch und feuerte einfach die letzten Patronen aus dem Lauf heraus. Erst allgemeines Schweigen ob meiner großen Freveltat. Dann ein Aufschrei der Wut und Entrüstung seitens des diensthabenden Zugführers: „Welches Dreckschwein, welche Wildsau war das?“ Dann war ich dran: „Im Laufschritt“, „Hinlegen“, „Auf, Marsch, Marsch!“, „Hinlegen“ und so weiter, bis ich es satt hatte und einfach liegen blieb und weiteres Strafexerzieren verweigerte. Da war natürlich vollends der Teufel los. Der Zugführer versuchte mich hochzuheben, aber ohne Erfolg, ich ließ mich immer wieder fallen mit der Bemerkung: „Ich kann nicht mehr. Ich habe die Füße kaputt.“ Als er endlich merkte, dass alles nichts half und ich nicht mehr „auf und nieder“ mitmachte, gab er mir den „dienstlichen“ Befehl, sofort zur Kaserne zurück zu gehen und mich umgehend beim KompanieChef zu melden.
Ich ging aber statt zum KompanieChef auf meine „Stube“, zog mir Schuhe und Strümpfe aus und besah mir erstmal meine Füße. Tatsächlich hatte ich durch die harten KnobelBecher (gemeint sind die Stiefel) ein paar Blasen auf den Zehen. Mit einer Rasierklinge schnitt ich die Blasen auf und schnitt mir die Zehen dabei so auf, dass es blutete. Die schmutzigen und schweißigen Strümpfe zog ich dann wieder darüber und dann hinein in die „Knobelbecher“! Mein Weg führte mich nun aber nicht zum KompanieChef, sondern – humpelnd – zum Krankenrevier. Dort meldete ich mich beim zuständigen Oberarzt und schilderte ihm den Sachverhalt. Als er dann meine Füße sah, die Dank meiner Nachhilfe in einem ganz schönen Zustand waren (die Strümpfe klebten durch das Blut schön an den Zehen fest), fragte er sofort nach dem Namen des Feldwebels. Zu mir sagte er dann: „Sie melden sich nicht beim KompanieChef, das erledige ich. Sie bleiben direkt hier auf dem Krankenrevier!“
Da hatte ich durch einen Zufall – den ich dann bis zur Grenze ausgereizt habe – doch erreicht, was mir trotz intensiver Überlegung und Anstrengung nicht gelungen war: Das Bataillon wurde ohne mich nach Osten in Marsch gesetzt.
Auf dem Revier blieb ich so 14 Tage, dann wurde ich als gesund entlassen. Aber wohin jetzt mit mir? Meine Kompanie war weg. Junge Rekruten hatte die Kaserne voll belegt und jede Kompanie war vollzählig. Die einzige Lösung, die blieb, war, dass ich abgeschoben wurde zur „Genesungskompanie“. Überwiegend bestand sie aus ArmeeAngehörigen, die beim Überfall auf die Sowjetunion verwundet worden waren und nun, nach dem LazarettAufenthalt, sich dort für den nächsten Einsatz im Osten erholen sollten. Ich „Pfeife“ meldete mich nun mit meinen wenigen Habseligkeiten als „Schütze Arsch aus dem dritten Glied“ bei meinem neuen KompanieChef. Der schien mich aber eher als eine weitere Belastung seiner Person und seiner Aufgaben anzusehen. Es war einige Tage vor Ostern. So fragte er mich, ob ich denn schon Urlaub bekommen hätte nach dem Lazarettaufenthalt. Ich wollte ihm natürlich auch keine weiteren Umstände machen und verneinte wahrheitsgemäß. Ich solle auf die Schreibstube gehen und dort den Urlaubsschein beantragen. So bekam ich Heimaturlaub von Karfreitag bis Dienstag nach Ostern. Das war der erste Urlaub von fast einer Woche Länge, seit ich die Ehre hatte, das Vaterland zu verteidigen.
Gegen wen eigentlich? „Wir“ Deutschen sind ja nicht angegriffen oder gar überfallen worden. Das Gegenteil war der Fall. In unsere Nachbarländer fielen unsere Soldaten ein und benahmen sich wie die schlimmsten Barbaren. Alle Länder wurden leergefressen und ausgeraubt. Die arbeitsfähigen Frauen und Männer wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet, zusammengetrieben und abtransportiert – zur Rüstungsarbeit verschleppt. Wer sich dem widersetzte, kam in Konzentrationslager oder wurde gleich an Ort und Stelle liquidiert. So sah die „Humanität“ und der „Fortschritt“ aus, den wir als „arische“ und „hoch entwickelte Kulturnation“ den angeblich unterentwickelten Völkern beibringen sollten.
Eines Tages tauchten ein paar arrogante, schwarzgekleidete Typen in der berüchtigten SSUniform bei uns in der Genesungskompanie auf. Unser „Haufen“ musste Aufstellung nehmen. Es war klar, sie suchten Kanonenfutter für ihren verbrecherischen Einheiten der „WaffenSS“. Erst wurde durch großkotzige Reden von Ruhm, Ehre und dem besonderen Vertrauen des „Führers“ versucht, Freiwillige zu werben. Einige meldeten sich dann auch voll Freude und Enthusiasmus, dem „Führer“ auf besondere Art verbunden zu sein. Aber das waren viel zu wenige! So griffen sie zu Zwangsmaßnahmen. Alle, die wenigstens 1,80 Meter oder 1,78 Meter maßen, wurden einfach zwangsrekrutiert. Ich hatte wieder Glück, denn es waren nur wenige Zentimeter, die sie daran hinderten, mich mitzunehmen. Meine Kameraden taten mir leid, wie sie nun sehr niedergeschlagen und berückt ihren neuen Besitzern folgten.
Kurzfristig wurde dann ein weiteres neues Marschbataillon aufgestellt und die Gesunden und die Wiedergenesenen wurden aufgeteilt. Es bestand für mich nun absolut keine Möglichkeit mehr, mich daran vorbei zu drücken. Ich musste mit, ob ich wollte oder nicht.
Mit der Sechsten Armee an die Ostfront (1942)
Ende April oder Anfang Mai 1942, kurz bevor ich 20 Jahre alt wurde, setzte sich unser Zug, vollgepfropft mit zum kleineren Teil tatsächlich freudig erregten, zum großen Teil aber tief bedrückten Soldaten in Richtung Osten in Bewegung. Die Bedrückten waren natürlich diejenigen Älteren, die die Gräuel der Ostfront bereits am eigenen Leibe erfahren hatten und die wenigen Jüngeren, die trotz Schikanen und Propagandatrommel einen klaren Kopf behalten hatten.
Zum ersten Mal in meinem Leben machte ich nun Bekanntschaft mit dem Viehwagen als Transportmittel. Wir waren ja auch nichts anderes als besseres Schlachtvieh, nur mit dem Unterschied, dass viele von uns sehr, sehr viel dummer und blöder waren als das arme Vieh, das sonst mit diesen Waggons transportiert wurde. Denn wir ließen uns zur Schlachtbank führen, obwohl wir denken konnten! In jedem der Viehwagen war etwas Stroh auf dem Boden verteilt und je 40 Mann wurden in einen Waggon verfrachtet. Je 20 Mann lagen oder saßen mit dem Kopf an der Längswand, gegenüber genau so, so dass die Füße dem Gegenüber bis an die Knie oder darüber hinaus reichten. Also, von einer komfortablen Reise, wie sie solch aufrechten und tapferen Vaterlandsverteidigern doch zugestanden hätte, war keine Rede. Aber wenn ich daran denke, wie die Transporte waren, die wir später sahen mit den armen sowjetischen Kriegsgefangenen, die mit über 100 Mann in solche Waggons gepresst wurden, bar jeder Menschlichkeit, muss ich doch sagen, fuhren wir beinahe noch erster Klasse.
Wenn ich mich recht erinnere, fuhren wir über Hannover, Berlin, Dresden nach Warschau, dann über Minsk bis Orscha, ca. 80 – 100 km vor Smolensk.
Am 8. Mai 1942, genau auf Muttertag, es sollte noch drei lange Jahre dauern, bis die Rote Armee Europa vom Faschismus befreit haben würde – kamen wir in Orscha an. Wir, oder wenigstens viele von uns, betraten zum ersten Mal die Erde „Mütterchen Russlands“, wie die Einheimischen ihr Land ehrfürchtig nennen. Der Empfang, den „Mütterchen Russland“ uns bereitete, war angemessen, nämlich alles andere als freundlich. Es regnete Bindfäden und wir marschierten ungewissen Zielen entgegen. Ach Du liebe Güte, war das alles trostlos! Überall Schlamm und Morast Orscha war ein kleines Städtchen mit wenigen befestigten Straßen. Sonst nur Schlammwege. Einige meiner großdeutschen „Kameraden“ konnten es sich angesichts dieser „Kulturschande“ und dieser unterentwickelten „Untermenschen“, wie sie es nannten, nicht verkneifen, mit Naziparolen um sich zu werfen. „Wie! Hier muss mal mit eisernem Besen gefegt werden und diesem Gesindel Zivilisation und deutsche Kultur beigebracht werden!“
Wir sollten zu einer 10 – 12 Kilometer entfernten Ortschaft marschieren. Dabei mussten wir durch ein kleines, dichtes Wäldchen – auf einem Knüppeldamm. Das Gelände war so morastig, dass es keine normalen Wege gab. Es regnete, es wurde dunkel, man sah buchstäblich die Hand vor Augen nicht, ich rutsche aus und sackte gleich bis übers Knie in den Morast. Mit Hilfe eines Kameraden zog ich das Bein aus dem Schlamm, aber der Stiefel fehlte. Es war unmöglich, den Stiefel aus dem Morast zu ziehen. Inzwischen war die Einheit weitermarschiert, ich war mit zwei Kameraden zurückgeblieben. Nun hüpfte und humpelte ich mit einem Stiefel am Fuß und am anderen den Socken weiter.
Kurz darauf sahen wir ein paar allein stehenden Häuser. Es war inzwischen schon zwischen neun und zehn Uhr abends. Wir gingen auf das erstbeste Haus zu. Es wurde irgend etwas gefeiert. Mich wunderte, dass die Leute noch Lust an einem Fest hatten. Oder vielleicht feierten sie auch wegen der verdammt schlechten Voraussetzungen, die für sie vorhanden waren. Wir klopften an und traten mitten zwischen die völlig verdutzen Menschen. Unser Anblick war sicher auch wenig Vertrauen erweckend. Das Gewehr quer vor der Brust oder auf dem Rücken hängend, völlig verschlammt, beschmutzt und ich nur mit einem Stiefel an den Füßen. Als sich der erste Schrecken gelegt hatte und sie sahen, dass sie von uns nichts zu befürchten hatten, waren sie ganz freundlich zu uns und forderten uns, ihre Feinde, auf, mit ihnen zu feiern und zu trinken. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Schließlich verbrachten wir die Nacht bei ihnen. Unsere Gewehre stellten wir einfach an die Wand, legten uns benebelt in eine Ecke und schliefen.
Als es am nächsten Morgen hell wurde, brachen wir auf, nachdem wir uns freundlich von den netten Menschen verabschiedet hatten. Das war der erste Vorgeschmack auf wahre Kultur! Kein Hass auf uns, obwohl „wir“ Deutschen doch ihr Land überfallen hatten und als Eindringlinge kamen. Wenn sie gewollt hätten, hätte sie uns nachts einfach umbringen und im Morast versenken können. Diese Freundlichkeit fand ich später noch öfter vor. Viele Einwohner, vor allem jüngere, sprachen ein paar Brocken deutsch und versuchten mit uns zu diskutieren, anstatt uns mit Hass zu verfolgen im Gegensatz zu allergrößten Teilen der deutschen Bevölkerung, die die osteuropäischen Menschen mit ihrem durch nichts zu entschuldigendem, gnadenlosen Hass verfolgten.
Gegen 10.00 Uhr morgens kamen wir dann bei unserer Einheit am Bestimmungsort an. Ach du meine Güte, was bereitete man uns für einen schönen Empfang. Erst wüste Beschimpfungen, dann Strafrunden immer um die Kompanie, die extra uns zu Ehren angetreten war. Ich mit nur einem Stiefel und dem mit Lumpen umwickelten anderen Bein. Wirklich ein grandioses Bild eines deutschen „Herrenmenschen“. Ich musste mir das Lachen gewaltsam verbeißen trotz des „Auf!“, „Hinlegen!“ usw. rund um die Kompanie. Dann kam die donnernde Standpauke, von wegen „Entfernung von der Truppe“, die „gerade in Feindesland“ als „besonders schwerwiegend und gravierend“ verurteilt wurde. Vom Kriegsgericht sehe man nur deshalb ab, weil jeder Soldat gebraucht werde, aber man werde in Zukunft ein wachsames Auge auf uns haben.
Dann hieß es aufsitzen. Die Fahrzeuge quälten sich von einem Schlag und Schlammloch mühsam ins andere, hüpfend und schnaufend Richtung Smolensk. Von uns wusste noch immer niemand genau, wo es hinging. Alle bewegte die bange Frage: „Werden wir etwa zur Offensive gegen Moskau eingesetzt?“ Die Richtung stimmte. Die Erleichterung war riesig, als unsere Fahrzeuge hinter Smolensk nach Süden abschwenkten in Richtung Roslawl, Briansk, Orel. Wir fuhren hinter der Front her.
Inzwischen hatten wir so um die 600 km von Orscha aus zurückgelegt und waren so acht oder neun Tage unterwegs. Man muss sich das vorstellen: acht Tage auf der Piste, steinharte Holzsitze auf einem rüttelnden, schüttelnden und bockenden LKW in einer von Panzern und anderen Kettenfahrzeugen tief ausgefahrenen Spur, übersäht mit Schlaglöchern jeder Größe und Tiefe. So waren wir froh, dass in Kursk eine mehrtägige Ruhepause eingelegt wurde.
Nach ein paar Tagen hieß es dann plötzlich, unser erster Feldeinsatz stünde bevor. Vielen von uns, natürlich auch mir, rutschte das Herz in die Hose. Müssen wir angreifen? Müssen wir stürmen? Was steht uns bevor? Wie mag das nur ausgehen!?! Das waren die bangen Fragen. Und ich musst einfach mit ansehen, dass ich diesmal vollkommen machtlos war, dass wir jetzt alle in diesen Irrsinn geschickt würden und es kein Gegenmittel gab. Wir waren unseren eigenen Henkersknechten machtlos ausgeliefert.
Wir fuhren noch etwa 50 70 km mit dem LKW in Richtung eines kleinen Flusses namens „Timm“. Auf der anderen Seite lag die Rote Armee mit Infanterie, Artillerie und Panzern und blockierte den weiteren Vormarsch der faschistischen deutschen Wehrmacht in Richtung der Industriestadt Woronesch und zum Don. Nun sollte ich mich also diesem Geheimnis umwitterten und Ehrfurcht einflößenden Fluss, dem „Stillen Don“, wie das herrliche Buch von Michail Scholochow heißt, als brutaler Eindringling, als Mitglied einer faschistischen Okkupationsarmee nähern. Es war fürchterlich.
Wir fuhren mit den LKWs bis an einen Waldrand. „Los, los! Absteigen!“, schallte es. „Gepäck und Waffen aufnehmen!“ „Ohne Tritt Marsch – durch den Wald!“ Der Wald mochte einige hundert Meter breit sein, dann sahen wir den Fluss vor uns, ein etwa 80 – 100 Meter breiter, träge dahinfließender Strom. Mittlerweile war es dunkel geworden. Wir hauten uns an der Uferböschung, die hier ca. 30 Meter breit zum Fluss hin abfiel, hin. Hinter uns der Wald, vor uns der Fluss, gegenüber die Rote Armee, von der wir uns noch keine Vorstellung machen konnten. Im Wald hinter uns lagen noch Pioniere mit Pontons und Schlauchbooten, mit denen wir den Fluss überqueren sollten – unter Artilleriefeuer der Roten Armee. Die deutsche Artillerie mit Raketenwerfern ca. 12 km hinter uns. Gegen fünf Uhr, also um die Morgendämmerung, sollte der Angriff beginnen!
Einer der Offiziere ging zwischen uns Neulingen herum und sagte, es sollte doch mal jemand von uns oder besser noch mehrere versuchen, die Gefühle, die uns jetzt in Vorbereitung und Erwartung des morgigen Angriffs beherrschten, in einem Stimmungsbericht zusammenzufassen. Vielleicht käme so ein Artikel in die SoldatenZeitung. Diese blöde Pflaume dachte sicherlich, er könnte damit unseren Kampfgeist und unsere Moral aufrichten und wir würden morgen mit HurraPatriotismus gegen „den Russen“ und ohne mit der Wimper zu zucken in den Tod stürmen. Aber den Gefallen tat ihm keiner. Es war trotzdem für einige der letzte Abend ihres Lebens, der nächste Tag brachte ihnen den „Heldentod“ – obwohl sie natürlich genau so wenig Helden waren oder Helden sein wollten wie ich.
Um fünf Uhr brauchten wir nicht geweckt zu werden. Wir wurden aus unserem unruhigen und dösenden Schlaf gerissen, weil wir dachten, die Welt geht unter oder die Hölle hat ihren Schlund aufgerissen und will wahrhaftig alles verschlingen. Unsere Artillerie hatte das Feuer eröffnet. Granaten und Minen sämtlicher Kaliber brausten über uns hinweg. Die Abschüsse ließen uns fast das Trommelfell platzen. Die Granaten flogen krachend, donnernd und tosend über uns hinweg und krepierten am anderen Flussufer, wo sie schreckliche Spuren hinterließen. Es dauerte einige Zeit, bis wir begriffen, was überhaupt los war. Durch Befehle, die lauthals herausgebrüllt worden, um den infernalischen Krach zu übertönen, wurden wir hin und her gejagt, bis alle Mannschaften auf die Pontons und Schlauchboote aufgeteilt waren. Ich kam zu einem Schlauchboot, das wir mit 10 oder 12 Mann über die Böschung ins Wasser schleppten und dann versuchten, mit voller Kraft das andere Ufer zu erreichen. Mittlerweile hatten die sowjetischen Truppen sich von ihrer Überraschung erholt und antworteten ihrerseits mit heftigem Artilleriefeuer. Mehrere Boote wurden getroffen und zerfetzt oder kenterten, es gab viele Tote und Verletzte. Ich hatte Glück, in einem der ersten Boote gewesen zu sein und sehr schnell das andere Ufer erreicht zu haben, denn direkt am erreichten Ufer waren keine Soldaten der Roten Armee und vor ihrer Artillerie waren wir durch die hohe Böschung geschützt. Wir warteten, bis so ziemlich alles, was noch lebte und sich noch bewegen konnte, das Ufer erreicht hatte. Dann wurde vorwärts gestürmt.
Wir sahen die ersten gefallen sowjetischen Soldaten, auch Pferde mit aufgerissenen Leibern. Es war ganz schrecklich anzusehen, der Magen drehte sich um. Einige völlig abgebrühte und verrohte deutsche Landser untersuchten die Toten nach eventuell nützlichen Dingen. Wenn sie nichts fanden, zogen sie ihnen die Stiefel aus oder rissen ihnen mit roher Gewalt irgendein brauchbares Stück vom Körper. Dann noch ein Tritt von diesen rohen und abgebrühten Halunken und dann ging es weiter. Nach ca. 5 – 7 km setzten sich die deutschen Truppen fest, weil dort die Rote Armee Widerstand leistete.
Ich kam gerade dazu, als die ersten sowjetischen Krieggefangenen gemacht worden waren. Da hieß es dann:
“Ja, was machen wir mit denen?“
„Umlegen!“ Und da sagte ich dann:
„Nee, die bringe ich nach hinten.“ Inzwischen mussten die deutschen Nachschublinien den Fluss bald erreicht haben.
Da haben die mich erstaunt angeguckt wie eine Idioten, als wenn ich sie nicht alle im Kopfe hätte.
„Die bringst Du zurück?“
„Ja, die bringe ich zurück. Und die liefere ich ab – und dann komme ich Euch wieder hinterher.“ Es waren drei Mann.
„Ja, ist in Ordnung.“ Und die stürmten wieder nach vorn.
Ich gehe mit denen also zurück, und das muss man sich jetzt so vorstellen. Nach einem Waldstück war da so 600 – 700 Meter weiter ein Dorf. Und da sage ich zu den Dreien:
„Doma! Dawei! Matka!“ Also, so weit ich russisch konnte: „Geh, geh nach Haus, geh zur Mutter!“
Die bleiben stehen, sehen mich an, und gehen nicht! Die dachten direkt, ich würde sie dann von hinten erschießen.
Ich zeige auf mein Gewehr: „Ich njet, nix, njet! Doma! Dawei!“
Da begreifen sie endlich und hauen ab, weg waren sie.
Dann habe ich mich erst noch ein bisschen ausgeruht und bin schließlich wieder meiner Einheit hinterher. Auf dem Weg sah ich die ersten toten deutschen Soldaten, zerfetzt, zerrissen von der eigenen Artillerie, die das Feuer nicht weit genug nach vorn verlegt hatte. Es war ein einziges Inferno.
Ich meldete so selbstsicher und selbstverständlich wie möglich: „Melde gehorsamst, habe die Gefangenen abgeliefert.“
Gut, das war auch Leichtsinn, aber es war eben auch ernst. Ich konnte sie einfach nicht abliefern, die hätten bei den verfluchten Faschisten doch kaum eine Chance gehabt zu überleben.
Jedenfalls habe ich die Jungens einfach nach Hause geschickt – und alles war gut gegangen.
Es ging dann noch einige Kilometer vorwärts und abends hauten wir uns alle einfach dahin, wo wir gerade waren und schliefen sofort ein, so erschöpft waren wir. Am anderen Morgen wurden dann schon ein paar SuperEifrige zum E.K. vorgeschlagen. Dass ich nicht dabei war, versteht sich von selbst.
Am nächsten Tag ging es weiter vorwärts, nun mit Panzern und Sturmgeschützen. Ein Teil der Soldaten saß auf den Panzern und Sturmgeschützen (ein Sturmgeschütz ist ein offenes Kettenfahrzeug mit einer aufmontierten 5,5 oder 7,65 cm Kanone). Da nicht alle auf den Fahrzeugen Platz hatten, lief ein Teil nebenher. Natürlich war ich bei denen, die erst nebenher liefen und dann, weil ihnen die Puste ausging, immer langsamer wurden. So konnte ich mich als HinterherHinkender der sinnvollen Aufgabe widmen, die Verwundeten zu betreuen und zurück zu bringen. Allerdings habe ich so von den Scheußlichkeiten und Verbrechen, die vorne passierten, wenn Soldaten der Roten Armee gefangen genommen wurden, nicht allzu viel mitbekommen.
Später sah ich dann ein solches Verbrechen, einen Doppelmord, begangen von Offizieren der faschistischen deutschen Wehrmacht. Ich hoffe, dass diese zwei Verbrecher ihre gerechte Strafe noch bekommen haben. Als nämlich der Widerstand für die Einheiten der Roten Armee vor uns immer aussichtsloser wurde, haben sich einzelne oder kleine Gruppen ergeben. So war es auch bei diesen beiden „hervorragenden“ deutschen Offizieren. Nur schade, dass ich nicht wusste, woher sie kamen und sie nicht kannte, sonst hätte ich sie nach dem Krieg beim KriegsverbrecherTribunal angezeigt. Vorher muss ich erklären: Man hatte mich zum MGSchützen2 degradiert. Das hieß, dass ich hinter dem MGSchützen1, der das MG und einen Gurt mit ca. 70 – 80 Schuss trug, zwei Kisten mit Munition für das MG hinterherschleppen musste. Ich komme also mit den beiden Kisten angeschleppt, da sehe ich so etwa 70 Meter entfernt die beiden Offiziere. Sie hatten drei Gefangene gemacht.
Es ging so blitzschnell mit diesen Mördern, dass ich nur noch einen retten konnte. Der eine Offizier schlug einem Gefangenen mit der Kante des Spatens den Schädel ein, der Gefangene schrie entsetzlich auf, bis der Offizier ihn endlich totgeschlagen hatte, der zweite dieser Unmenschen stach dem zweiten Gefangenen wie ich dann sah, war es eine Frau das Seitengewehr in den Hals, die Brust und den Bauch. Meine Zurufe kamen zu spät. Ich rief nämlich: „Halt! Halt! Diese Schweine (man musste so reden) können wir noch brauchen, die sollen unsere Munition nach vorne bringen!“ So konnte ich wenigstens einem das Leben retten, indem ich den Mördern klar machte, dass wir ihn als Lastenkuli bräuchten. Wenn diese beiden Verbrecher nicht in Russland krepiert sind, haben sie sicherlich als sehr angesehene und mit Ehre ausgestattete Ausbilder eine Aufgabe in der „phantastischen“ Bundeswehr bekommen und durften wieder die Jugend in Schmutz und Verbrechen hineinziehen, kriegen jetzt ihre „wohlverdiente“ Rente.
Nun, mein Gefangener trottet apathisch neben mir her. Da kommen wir an einer alten Villa vorbei, plötzlich bekommen wir Gegenfeuer aus der Richtung der Villa. Wir werfen uns in Deckung. Das Feuer verstummt. Und ich sage wieder mein Sprüchlein:
„Doma! Dawei! Matka!“ „Doma! Dawei!“
Er springt auf und verschwindet in Richtung der Villa. Die Munitionskästen ließ ich dann auch einfach liegen. Unter „Feindfeuer“ kann so was schon mal vorkommen.
Am Sammelpunkt beim Aufsitzen fragte niemand, wo der Gefangene denn geblieben sei. Nun fuhren wir auf den Panzern und Sturmgeschützen in die Stadt Woronesch, hauten uns einfach an den Straßenrand und schliefen todmüde – sofort ein.
Am nächsten Tag kamen wir an einem Krankenhaus vorbei, das von deutschen Truppen, wahrscheinlich SSAngehörigen, sie waren auch beim Angriff dabei, geplündert wurde. Wir sahen welche mit wissenschaftlichen Geräten, mit Stethoskopen und Mikroskopen herumlaufen, die sie später wieder wegwarfen, weil sie in ihrer Doofheit als Herrenmenschen die Bedeutung und Notwendigkeit dieser lebensnotwendigen Geräte nicht einmal kannten. Andere schleppten Mullbinden und anderes Verbandsmaterial als Bänder und Fahnen hinter sich her. Es war mehr als peinlich.
Wir marschierten durch die Stadt hindurch bis an das westliche Ufer des gleichnamigen Flusses Woronesch. Die Rote Armee hatte sich über den Fluss, der eine Breite von ca. 150 Metern hatte, zurückgezogen. Wir Idioten mussten uns im Ufersand eingraben und boten so den Beobachtern, Granatwerfern und Scharfschützen der Roten Armee hervorragende Ziele. Das war wieder so ein typisches Charakteristikum deutscher Tapferkeit. Obwohl wir alle sofort wussten, dass es heller Wahnsinn war, kamen wir aus Feigheit diesem unsinnigen Befehl nach. So lagen wir dann eine ganze Zeit als Zielscheiben dort, bis es uns möglich war, uns unter Verlusten vom Ufer in sichere Verstecke zurückzuziehen.
So und ähnlich ging es noch einige Tage weiter, dann wurden wir von anderen Einheiten abgelöst und fuhren per LKW weiter nach Süden. Nun war in unserer Kompanie einer, der sich als grandioser Held fühlte, als treuer Vasall unseres von der Vorsehung auserkorenen „Führers“ Adolf Hitler. Er war Obergefreiter und hatte für jeden erschossenen Sowjetsoldaten „Russen“, wie er sagte eine Kerbe in den Kolben seines Gewehres geschnitten, wie ehedem die tapferen Westmänner, die Vorfahren und Idealgestalten der großen nordamerikanischen Nation (unsere heute so verehrten Verbündeten) für jeden erschossenen Ureinwohner (Indianer), denen man das Land raubte im Namen der Freiheit. Unser grandioser Held wurde dann zum Unteroffizier befördert und bekam eine Gruppe. Später erschoss er dann einen unserer Kameraden. Aber darauf komme ich noch zurück, ebenfalls darauf, wie wir mit drei Mann unser Urteil an ihm vollstreckten. Der kam wenigstens nicht mehr lebend aus der Sowjetunion zurück, um sich zu Hause in Deutschland mit seinen Heldentaten zu brüsten und den Bazillus der NaziIdeologie weiter zu verbreiten. Und die Rote Armee musste sich an ihm noch nicht mal die Hände schmutzig machen.
Nach einem Tag Fahrt lagerten wir mitten in der Steppe. Wie immer total übermüdet hauten wir uns irgendwo hin, um ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Ich legte mich etwas abseits in eine Mulde und breitete eine Plane über mir aus. Die stechende Sonne (es war so um den 15. Mai 1942, also kurz vor meinem 20. Geburtstag, die Sonne ist in der Ukrainischen Steppe zu der Zeit sehr heiß) scheuchte mich am nächsten Vormittag aus meiner Schlafhöhle. Zu meinem nicht geringen Erstaunen befand ich mich gänzlich allein auf weiter Flur. Ich hatte nichts gehört von dem Aufbruch und der Abfahrt meiner Kompanie. Da stand ich nun wie Pik Sieben, einsam und verlassen, ohne Ausrüstung und Verpflegung, mitten in der Ukrainischen Steppe und wusste nicht, in welche Richtung ich mich bewegen sollte.
Nach ein paar Stunden Fußmarsch, Waffe und Munition waren mir zu schwer, die hatte ich weggeworfen, fand mich ein deutscher Spähwagen und nahm mich mit zu meiner Einheit.
Ich wurde mit einem ungeheuren Donnerwetter empfangen. Ein wahrer Hagel von Schimpfwörtern prasselte auf mich nieder: „Sie hundsmiserabler Soldat…Kein Funken von Stolz und Ehre…Schandfleck der Kompanie…Müsste vor das Kriegsgericht gestellt werden…Lässt seine Waffen und seine Munition im Riss…Kommt einem Vaterlandsverrat gleich“ und dergleichen mehr. Die Ansprache des Kompaniechefs endete dann mit dem glorreichen Schlusspunkt: „Ich bestrafe Sie wegen unerlaubten Entfernens von der Truppe und Verlust der Waffe mit sechs Tagen verschärftem Arrest!“ Mich konnte das nicht besonders aufregen, da ich von der deutschen Wehrmacht schon mehr gewohnt war als diese Lapalie. Aus meiner widerspenstigen Haltung gegenüber Faschismus und Nationalismus sagte ich denn auch dem Unteroffizier, der mich zum Arrest holte: „Die paar Tage sitze ich auf einem Arschbacken ab.“ Dieser Unteroffizier, der meine Meinung über den Arrest natürlich treu und brav dem Kompaniechef überbracht hatte, konnte mir dann noch am gleichen Tag die freudige Miteilung machen, dass ich für „die andere Arschbacke“ auch etwas zum Absitzen bekäme und deshalb der Arrest verdoppelt würde.
Nach meiner Entlassung aus dem Knast ging der preußische Alltag wie gewohnt seinen Gang. Es wurde exerziert, Schießübungen mit Platzpatronen (scharfe Munition war zu teuer), dann wurde Grüßen geübt: „Der deutsche Soldat muss so beschäftigt werde, dass er keine Minute Zeit hat, um über sich nachzudenken.“ Dieser Satz steht in der „Heeresdienstvorschrift (H.D.V.)“ und stammt schon aus dem 19. Jahrhundert, bereitwillig wurde er von den Nazis übernommen.
Wenige Tage später fuhren wir per LKW wieder weiter zurück. Kontakt mit der Bevölkerung bot sich kaum, die Sprachschwierigkeiten waren groß und die Einheimischen zeigten wenig Lust, mit uns in Kontakt zu treten. Wir fuhren weiter nach Süden, ins so genannte Donezbecken. Das ist eine größere Ansammlung von Industriestädten zwischen Donez und Don, nordöstlich der Krim, südöstlich von Charkow und Kiew und nördlich von Rostow am Asowschen Meer. Es ist ein an Kohle und Erzen reiches Gebiet. So war es nicht verwunderlich, dass wir auf neue Taten für Großdeutschland vorbereitet wurden, geredet wurde von ehrenvollen Aufgaben und glorreichen Einsätzen, die das E.K. und das Ritterkreuz als Auszeichnungen in greifbare Nähe rücken würden. Wir wurden wieder aufgefüllt zu „voller Kampfkraft“, um die eroberten Kohlen und Erzgruben zu bewachen. Unsere Grube lag ca. 4 – 5 Kilometer von unserem Standort entfernt.
Eine Korporalschaft übernahm jeweils die Wache für 24 Stunden und marschierte geschlossen dorthin. Als bekannt wurde, dass sich in der Nähe eine Gruppe junger Russinnen einquartiert hatte, die für kleine Gefälligkeiten gern bereit waren, Ihrerseits Gegenleistungen zu erbringen, drängelten sich fast alle danach, freiwillig die Wache zu übernehmen. Die Russinnen taten ihren Dienst aber nur, um die Wachtruppen von ihrem Dienst abzuhalten und in Sicherheit zu wiegen. Eines Tages flog die Grube, gesprengt von Partisanen, in die Luft, einige deutsche Soldaten wurden getötet und die Russinnen waren mit den Partisanen verschwunden.
Kurz nach dem Vorfall traf der Bescheid ein, dass unsere Division unverzüglich nach Stalingrad verlegt würde. Oweioweh, wie ging die Angst um, wie wurde es fast allen – oder wenigstens denen, die noch einen klaren Kopf behalten hatten – mulmig und flau im Magen. Des größenwahnsinnigen, von der „Vorsehung gesandten Führers“ Worte anlässlich des Angriffs auf Stalingrad klingen mir noch heute in den Ohren: „Stalingrad wird und muss fallen, nicht weil es zufällig den Namen dieses Mannes trägt, sondern weil es die Wolga, den wichtigsten Güterstrom Russlands, kontrolliert.“
An dieser Stelle komme ich auf den treuen Vasall des „Führers“ zurück, den kernigen Obergefreiten, der dann Unteroffizier wurde, und der sich für jeden von ihm „zur Strecke gebrachten“ (wie er sich auszudrücken beliebte) sowjetischen Soldaten eine Kerbe in den Kolben seines Gewehres ritzte. Hier erschoss er einen unserer Kameraden. Angeblich aus Versehen, beim Waffenreinigen. Keiner der am Vorfall Beteiligten durfte über die Sache sprechen. Aber hinter der Hand erfuhren wir natürlich die Wahrheit. Es geschah nach einem Wortduell, bei dem unser Kamerad sich weigerte, den barbarischen Krieg fortzusetzen und nach Stalingrad zu marschieren. Es durfte das wahre Motiv nicht genannt werden, um keine AntiStimmung hervorzurufen, so wurde die Lüge vom Waffenreinigen in die Welt gesetzt.
Mit dem Wort „Stalingrad“ hatte, ohne dass wir Bestimmtes wussten, der Sensenmann schon von vielen von uns Besitz ergriffen, und der Aasgeier, den wir als stolzen deutschen Adler auf der Brust trugen, kreiste schon über uns. An einem schönen, klaren Morgen, es muss so um den 5. oder 6. Juni 1942 gewesen sein, war es dann so weit. Es hieß: „Alles auf die Fahrzeuge! Es geht nach Stalingrad!“
Es ging nach Süden bis Rostow an der Mündung des Don ins Schwarze Meer, dann weiter über Schachty bis nach Kalatsch. Dies war die so genannte „Riegelstellung“ hinter dem großen Donbogen, also zwischen Don und Wolga gelegen, in der Nähe des Leninkanals. Hier beträgt der Abstand zwischen Don und Wolga ca. 80 – 90 Kilometer.
Am vierten oder fünften Tag abends erreichten wir besagte Riegelstellung. Wir fuhren unmittelbar bis an einen hohen Erdwall – er wurde Tatarenwall genannt. Hinter dem Wall spielte sich ein Feuerzauber solchen Ausmaßes ab, dass ich erst gar nicht erfassen und begreifen konnte, dass es sich um Schießduelle handelte. Als die Wahrheit dann bis in mein Hirn gedrungen war, da kann ich nur sagen, schlotterten mir die Knie nicht schlecht. Uns allen dämmerte, über den Wall müssen wir rüber und auf der anderen Seite mitten in diesem Getümmel uns in die Erde buddeln. Gegen diese Feuerwalze, die da vor uns stand bzw. über uns hinwegbrauste erschien uns Woronesch wie ein Kinderspiel mit Feuerwerk. Man ließ uns erstmal ein bisschen zur Besinnung kommen. Dann kam der Befehl: Rüber über den Erdwall und etwa 30 – 40 Meter davor Schützenlöcher in die Erde buddeln.
Wir saßen immer mit zwei Mann in einem Schützenloch, das wieder ca. 20 – 30 Meter vom nächsten entfernt lag. Unser tüchtiger Unteroffizier, von dem ich schon zwei Mal sprach, war wegen „Tapferkeit und Führertreue“ ausgezeichnet worden. Er lag einige Schützenlöcher links von uns, näher zum Wall und zum linken Flügel hin. Vorher war schon beschlossen worden: „Der darf hier nicht mehr lebend rauskommen.“
Der erste Tag mit seinen ungeheuren Angriffen und unserer unbeschreiblichen Angst war vorüber gegangen, vom tapferen, unübertroffenen deutschen Soldaten war nicht mehr viel übrig geblieben, denn jeder, wirklich jeder verspürte nur noch Angst. Der deutsche Herrenmensch bestand nur noch aus einem Häufchen Elend. Endlich kam der Abend und all das Elend und die Not wurden vom schützenden Mantel der Dunkelheit umhüllt. Da hörte man dann das Schreien und Stöhnen der Verwundeten, hüben und drüben arbeiteten sich die Sanitäter und ihre Helfer zwischen den Fronten durch und schleppten diejenigen Verwundeten, die noch nicht verblutet oder durch Hitze und Durst umgekommen waren, zu ihren Truppen hinüber. Es lässt sich alles sehr, sehr schwer schildern. Am Tag schoss jeder auf jeden und auf alles, was sich bewegte. Wer nun verwundet wurde, konnte tagsüber nicht zurückkriechen zum Sanitäter oder zum Feldlazarett. Und er konnte auch nicht geholt werden. Die einzige Möglichkeit bestand darin, sich selbst notdürftig zu verbinden, soweit man noch dazu in der Lage war oder man hatte Glück, dass jemand direkt in der Nähe war und erste Hilfe leisten konnte. So wartete man, manche unter bestialischen Schmerzen, bis es dunkel wurde. Wer Glück hatte, wurde erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit verwundet. Aber wer morgens früh schon erwischt wurde, für den war es meistens das Ende. Das hört sich alles so brutal und herzlos an, aber so war es wirklich! Alle waren völlig abgestumpft und gleichgültig, wir waren nur noch Tiere, ach, viel schlimmer als die Tiere!
Die Scharfschützen der Roten Armee hatten unsere Schützenlöcher natürlich inzwischen auch entdeckt und nahmen uns unter Feuer. Sie schlichen durch das Steppengras so auf 70, 80 oder 100 Meter heran, ohne dass es jemand bemerkte. Mein Kumpel, der mit mir in einem Loch saß, bekam einen Volltreffer auf den Stahlhelm. Der Helm flog mit Gewalt ins Genick und er wurde ohnmächtig. Der Helm selbst hatte den Schuss abgehalten, er hatte nur eine starke Schwellung auf der Stirn und am Hinterkopf. Abends brachte ich ihn zum KompanieGefechtsstand. Nun war ich allein in unserem Schützenloch. Wir befanden uns nun schon ein paar Tage in dieser beschissenen Lage und waren, wie gesagt, schon völlig abgestumpft. Es setzte zu allem Überfluss nun auch noch ein Landregen ein, unsere Schützenlöcher liefen voll Wasser.
Mein Kumpel hatte nicht verstanden, aus seiner leichten Verletzung für ihn das Beste zu machen (so wie ich es später besser verstand), so war er nach drei Tagen Aufenthalt hinten beim Tross morgens wieder in unserem Schützenloch erschienen. Ungefähr 500 – 600 Meter links von uns stand ein abgeschossener sowjetischer Panzer und einige Soldaten der Roten Armee, die mit einem LKW ankamen, versuchten, ihn wieder flott zu machen. Zwischen unserem Schützenloch und den arbeitenden Soldaten befand sich das Loch des besagten Unteroffiziers. Um nun sein Heldentum erneut unter Beweis zu stellen und vielleicht einen neuen Orden zu bekommen, versuchte er, diese Arbeiten zu unterbinden, indem er wie verrückt auf die arbeitenden Soldaten schoss – natürlich ohne Erfolg, denn von ihm aus waren es bestimmt noch 400 oder 450 Meter. Als er sah, dass seine Bemühungen ohne Erfolg blieben, kroch er aus seinem Loch in deren Richtung voran und stellte sich plötzlich aufrecht, er dachte wohl, er könnte sie nun besser erwischen. Stattdessen aber wurde er erwischt – von einem der sowjetischen Scharfschützen, die, wie schon beschrieben, unsichtbar in unserer Nähe waren. Er wurde ins Bein getroffen und fiel um. Er schrie, es solle jemand von uns kommen, um ihm wieder in die Deckung zu helfen. Natürlich ignorierten wir das, so kroch er mühsam allein zurück in sein Loch. Und tobte wie verrückt. Natürlich wollte er wieder irgend jemanden vors Krieggericht bringen wegen „Feigheit vor dem Feind“ und so weiter. Bei seiner Toberei kam er auch immer wieder mit dem Kopf und dem Oberkörper aus dem Loch heraus. So bot er ein gutes Ziel und wir schossen ihn über den Haufen. Mit drei Mann schossen wir auf ihn. Wer ihn nun erwischt hat, kann ich schlecht sagen. Er kippte hintenüber und blieb mit dem Oberkörper auf der Brüstung des Schützenlochs liegen. Die Sowjetsoldaten hatten den Panzer – offen in unserem Blickfeld – inzwischen irgendwie repariert und hauten mit LKW und Panzer ab, zurück zu ihren Linien.
In der Dunkelheit gingen wir dann rüber zu unserem speziellen Freund, dem Unteroffizier, und sahen mit Genugtuung, dass es mit ihm vorbei war. Später wurde er dann mit anderen Toten und Verwundeten zurück gebracht und irgendwo beerdigt.
Nach vielleicht 10 Tagen wurden wir abgelöst und kamen einige Kilometer zurück, wo die Kompanie wieder aufgefüllt wurde, wie das so schön hieß. Und nach ein paar Tagen ging es wieder los an die vorderste Fron, diesmal noch näher an Stalingrad heran. Die faschistische Front zog sich immer enger in einem Halbkreis um die Stadt herum. Wir waren vielleicht 12 – 15 Kilometer vom nordwestlichen Stadtrand entfernt und konnten in der Ferne die Fabrikschornsteine erkennen. Mit dem Fernglas sahen wir den Silberstreif der Wolga in der Sonne glänzen.
Die Rote Armee leistete zum Glück heftigen Widerstand. Am 14. oder 15. August 1942 erfolgte wieder einer der vielen Panzerdurchbrüche. Es erschien plötzlich ein sowjetischer Panzer vor uns, nur ca. 20 Meter entfernt. In unserem Rücken standen deutsche Panzer. Wir nahmen volle Deckung, ein Krachen, Knallen und Bersten, dann MGFeuer, schließlich war Stille. Der sowjetische Panzer war abgeschossen und stand in Flammen. Ein sowjetischer Soldat war tödlich getroffen und lag mit dem Kopf auf den brennenden Gummilagern, die zwischen den Panzerketten waren. Es war schrecklich anzusehen, wie sein Körper qualvoll zuckte – und niemand konnte helfen. Der andere Rotarmist war leichter verletzt, mit einem Schuss durch den Arm oder die Hand. Er stöhnte leise vor sich hin. Ich kletterte aus meinem Loch und versuchte mit einem Verbandpäckchen wir hatten jeder zwei davon die Wunde zu verbinden. Damit war ich natürlich den Gewehren der Scharfmacher im Weg. Einer von der deutschen PanzerBesatzung schrie dann auch: „Scheren Sie sich in Ihr Loch und verschwenden Sie kein Heeresgut an einen dreckigen Russen!“ Aber es kamen mehrere meiner Kameraden zu Hilfe und wir kümmerten uns einfach nicht mehr um dieses unbarmherzige Schwein.
Ich habe viele gute und hervorragende Kameraden in dieser verhassten Wehrmacht getroffen, aber auch viele, sehr viele gefühllose, kaltherzige und skrupellose Verbrecher in der grauen Uniform der Wehrmacht gesehen. Mörder und NaziVerbrecher gab es nicht nur in der SS. Man hätte die Wehrmachtsangehörigen nach dem Krieg viel schärfer überprüfen müssen.
Verwundung und geschickte Ausweichmanöver
(Herbst und Winter 1942/43)
Am nächste Tag trat dann ein Ereignis ein, das dem großen „Führer“ einen treuen und tapferen Verteidiger seiner Ideen kostete und das dazu führte, dass Großdeutschland einen Soldaten weniger an der Front gegen den Bolschewismus hatte. Der Tag war verhältnismäßig ruhig verlaufen, abends kam die Feldküche und wir bekamen unser Essen. Ich saß auf der Brüstung meines Schützenloches und löffelte meine Nudelsuppe, da hörte ich den Abschuss der Granatwerfer, das schon zur Gewohnheit gewordenen „Flupp“. Und da spürte ich auch schon direkt nach der Detonation einen ordentlichen Schlag gegen meine Rippen unterhalb des rechten Arms. Die Nudelsuppe kam sofort wieder heraus. Mein erster Gedanke war: die Rippen sind gebrochen und der Krieg ist aus. Ich hatte das Glück, von dem die meisten träumten. Vorsichtig betastete ich meine Seite und fühlte zur Erleichterung nur wenig Blut und kein großes Loch. Dann sagte ich dem Nebenmann, dass ich verwundet sei.
Mein Kompaniechef, Oberleutnant Sittig, besah sich den Schaden: „Ach, es ist ja weiter nicht schlimm. 14 Tage beim Tross, dann ist die Sache wieder in Ordnung.“ Ein Splitter hatte ein faustgroßes Loch in die Uniform gerissen und war dann auf eine Rippe geschlagen. Die rechte Seite war geschwollen und auf einer Fläche, vielleicht gut handgroß, schwarz und blau. In der Mitte ein Loch, in dem der Splitter steckte. Er pulte ihn mit irgendeinem Instrument heraus und meinte dann, dass wir uns in ein paar Tagen wieder sehen würden, dann man lasse ja seine Kameraden nicht allein und man müsse ja für „Führer, Volk und Vaterland“ jederzeit sein Leben einsetzen. Wie ich später erfuhr, tat er selbst das tatsächlich. Er wurde noch zum Hauptmann befördert und ruht nun schon lange für „Führer, Volk und Vaterland“ in der russischen Erde.
Der Verpflegungswagen nahm mich mit zurück zum Tross. Am anderen Morgen dachte ich an die blöden Worte des Kompaniechefs. „Kameraden nicht im Stich lassen“, „Immer an Führer, Volk und Vaterland denken“, „Lebenseinsatz für Großdeutschland“. Da musste ich nur lachen und den Kopf schütteln.
Bei meinen Kameraden erkundigte ich mich sofort, wo in der Nähe ein Feldlazarett wäre. Der Spieß, der aus dem gleichen Holz geschnitzt war wie der – Gott habe ihn selig – Unteroffizier und der Oberleutnant Sittig, sagte gleich: „Sie brauchen nicht ins Lazarett! Die Sache heilen wir hier aus. Wenn jeder bei einer solchen Kleinigkeit ins Lazarett gehen und die Front verlassen würde, dann würden wir den Krieg verlieren!“ Dieser blöde Trottel! Verloren hatten wir, ehe wir begannen, weil es uns nicht gelungen war, den Faschismus zu verhindern!
Da ich von den anderen wusste, in welcher Richtung das Feldlazarett zu suchen war, holte ich meine persönlichen Dinge und Papiere, verstaute sie unter meiner Uniformjacke, ging zum Spieß und meldete mich ab, angeblich, um mir eine Tetanusspritze zu holen. Damit war er vollkommen einverstanden. Nach einigen Kilometern Fußmarsch kam ich dann im Lazarett an, bekam die Tetanusspritze – und es kümmerte sich keiner mehr weiter um mich. Ich sagte einem Sanitäter, der mir über den Weg lief, ein Arzt hier hätte mir gesagt, dass ich mir einen Platz zuweisen lassen sollte. Mir war mein Soldbuch nicht abgenommen worden. Das war ganz wichtig, denn wenn ein Soldat, egal wo und von welcher Streife und ganz egal, welche Umstände mitspielten, ohne Soldbuch aufgegriffen wurde, wurde er als Fahnenflüchtiger angesehen und das Standgericht, also die Erschießung, konnte sofort durchgeführt werden.
Am Nachmittag kam eine Wagenkolonne von „Sankas“ (Sanitätskraftwagen), die transportfähige Leichtverwundete abtransportieren sollte, um das Lazarett zu entlasten. Natürlich war ich dabei. Wir fuhren mit den Wagen bis Schachty. Im Januar 1943 sollte ich nochmals hierher zurückkommen. Dort stand schon ein Lazarettzug, der noch nicht ganz belegt war. Wir wurden verladen und fuhren in Richtung Rostow, Taganrog an der DonMündung ins Asowsche Meer. Inzwischen war meine Verwundung schon fünf bis sechs Tage her und die Heilung machte Fortschritte. Das hieß für mich: wenn Du nichts unternimmst, um die Heilung zu verzögern, wird man Dich entlassen, kaum, dass das Ziellazarett erreicht ist. Noch während der Zugreise, nachts, als alles dunkel war, machte ich etwas Theater und tat so, als ob meine Verwundung mir zu schaffen machte. Ich löste etwas den Verband und stach mir mit einem rostigen Nagel in das Loch in meiner Seite, das schon anfing zuzuwachsen. Zu meiner Freude war das Resultat, das ich auf diese Art erzielte, ganz hervorragend. Ich bohrte in unbeobachteten Momenten fleißig weiter mit dem Rostnagel in meiner Seite herum. Im übrigen half ich mit bei der Verladung der Verwundeten, die schlechter dran waren als ich.
Wir fuhren nach Dnjepropetrowsk, am Dnjepr gelegen, ungefähr 500 – 600 Kilometer von der Front entfernt.
Das Bohren mit dem rostigen Nagel zeigte nun schönste Erfolge. Die Wunde eiterte hervorragend und der Verband musste täglich gewechselt werden. „Kommt bestimmt von der Überanstrengung, hoffentlich gibt es keine Blutvergiftung“, sagte der Sani. „Das sind Tuchreste und die Reste des Granatsplitters.“ Mein KompanieChef hatte mich ja nach ein paar Tagen zurück an der Front sehen wollen… Ich blieb erstmal im Lazarett.
Eines Tages kam ein Transport rumänischer Soldaten an. Du lieber Gott, waren das arme Teufel! In Viehwagen kamen sie an, die Behandlung denkbar schlecht und miserabel, viele keine Schuhe und Strümpfe an den Füßen, nur ein paar alte Lumpen oder Stroh darumgewickelt. Sie wurden in ein paar Zimmer hineingepfercht. Ein paar Betten standen auch darin – für ganz schwere Fälle. Wer nicht mehr hineinpasste, musste in den Viehwaggons bleiben. Und die Verpflegung war auch nicht die gleiche wie die für die deutschen Soldaten. Aber für die Verteidigung Großdeutschlands und die Durchsetzung der Pläne des von Gott und der Vorsehung gesandten Adolf Hitler waren sie gut genug. Wir brachten den Rumänen einen Teil unserer Verpflegung rüber, was mit großem Dank entgegengenommen wurde. Zu ihrem Glück sind sie ja auch haufenweise übergelaufen zur Roten Armee und haben so ihren Beitrag geleistet zum Zusammenbruch der Südfront und somit zur schnelleren Beendigung des Krieges in seiner Gesamtheit.
Ich stand inzwischen auf der Entlassungsliste und sollte in zwei Tagen in Richtung Front in Marsch gesetzt werden. Als der Unterarzt am nächsten Morgen zur letzten Visite kam, stellte sich im Lauf des Gesprächs heraus, dass er auch aus Köln war, und zwar aus Stammheim. Mauenheim/Nippes, wo ich herkam, lag am Rhein genau gegenüber. Und er instruierte mich: „Wenn ich morgen mit den Entlassungspapieren komme, dann liegst Du ganz steif im Bett und kannst kein Bein und keinen Arm mehr bewegen. Den Rest erledige ich.“ Am nächsten Morgen kam dann die Visite und ich spielte meine Komödie. Nach einigem Palaver sagte der Oberarzt zum Unterarzt: „Sie haben Recht, der Mann ist noch nicht dienstfähig und an eine Entlassung kann im Moment nicht gedacht werden.“ Nun musste ich jeden Morgen Freiübungen machen, bekam heiße Bäder und Massagen. Auf diese Weise war es mir gelungen, noch bis Anfang Dezember 1942 im Lazarett zu bleiben.
Eines Tages war es dann aber unabdingbar so weit, der Tag meiner Entlassung aus dem Lazarett war da. Am Nachmittag wurden wir mit einigen Mann, ausgerüstet mit Entlassungspapieren und neuen Uniformen incl. Winterausrüstung auf die Reise zur Genesungskompanie nach Dnjeproderschinsk geschickt. Durch meine lange Verabschiedung im Lazarett und natürlich und vor allen Dingen in der Stadt war ich mal wieder der letzte, der auf dem Bahnhof ankam. Der Zug war mal wieder ohne mich abgefahren. Ich packte meine Sachen zusammen und ging zurück zum Lazarett, wo ich dann gegen Abend wieder ankam, natürlich zu aller Erstaunen. Viel anhaben konnten sie mir nicht. Ich war nunmal der dumme „Schütze Arsch“ im dritten Glied und hatte laut meinen Angaben den Zug nicht gefunden (weil er schon abgefahren war). Das brachte mir nochmal drei Tage Aufenthalt im Lazarett, dann wurde ich mit einigen anderen von einem Vorgesetzten zur Bahn begleitet und konnte nicht mehr ausbrechen. So fuhr ich also per Zug ins 80 – 90 Kilometer entfernte Dnjeproderschinsk. Von dieser tollen Einheit gibt es nicht viel zu berichten, außer, dass wir sofort mit „Drückeberger“ und „Faulenzer“ apostrophiert wurden und uns verdeutlicht wurde, dass wir uns keine Hoffnungen auf einen längeren Aufenthalt machen bräuchten. „Da kommt diese `Arschgeige´, diese `trübe Flasche´ aus dem Lazarett, wo er sich monatelang herumgedrückt hat und will sich auf diese Tour in der Etappe herumdrücken, sich vollfressen, vollsaufen und den Weibern nachstellen, während seine Kameraden draußen das Vaterland verteidigen!“
Am anderen Morgen wurde ich dann, was ganz klar war, vom Standortarzt wieder K.V. (kriegsverwendungsfähig) geschrieben. Dann bekam ich ein Gewehr samt Munition in die Hand gedrückt und mit einem donnernden „Heil Hitler!“ oder „Sieg Heil!“ oder „Es lebe der Führer“, ich weiß es nicht mehr so genau, wurde ich aus dieser wunderbaren Genesungskompanie entlassen.
Wir waren ein paar Mann, die mit einem Marschbefehl zu ihren alten Einheiten stoßen sollten. Wir gehörten ja alle der Sechsten Armee an, und wir wurden mit dem Befehl entlassen, die alte Einheit auf kürzestem Weg zu finden. Unsere Kompanien und Bataillone, die wir suchen sollten, lagen ja im Kessel von Stalingrad, der zu unserem Glück bereits geschlossen war. Das Verfluchte und Fatale an der Geschichte war aber, dass noch immer Truppen, die versprengt waren, zu dieser Zeit in den Kessel eingeflogen wurden.
Im Soldbuch war immer die Einheit bzw. Regiment oder Kompanie eingetragen, aber nicht die Sechste Armee. Das machte es leicht, nach der Einheit zu suchen, aber den Zusammenhang zur Sechsten Armee zu verschweigen.
Wir fuhren mit vier Mann los und in jeder größeren Stadt, wo der Zug hielt, stiegen wir aus, gingen zur Ortkommandantur, legten Marschbefehl und Soldbuch vor und fragten nach unserer Einheit. Klar, dass das Wort „Sechste Armee“ verschwiegen wurde. Einer konnte sich dann erinnern, dass das Regiment in diesem Ort lag, ein anderer wusste sich zu erinnern, dass es in jenem Ort lag. Nur wir wussten, dass alle Angaben falsch waren. Aber wir fuhren, wohlversehen mit dem Stempel der Ortkommandantur und mit neuem Proviant ausgestattet in die falsche Richtung.
Zwei Mann setzten sich dann von uns ab, sie wollten doch „zum alten Haufen zurück“. Die armen Irren. Nun, zwei Mann sind unauffälliger als vier. Einige Zeit später, so zwei oder drei Tage vielleicht, war ich dann allein unterwegs. Es war kurz vor Weihnachten 1942. Der ganze Südabschnitt hatte sich auf die Kesselschlacht in Stalingrad konzentriert. Soldaten konnten keine mehr eingeflogen werden, da das bisschen an Luftfracht, das zur Verfügung stand, kaum ausreichte für Munition und Verpflegung. Ich fuhr noch von Toranrog bis Schachty, das mir noch gut in Erinnerung war. Dort war dann diese Eisenbahnfahrt zu Ende, die mich in rund zwei Wochen von Westen nach Norden, von Norden nach Osten, dann nach Süden und zum Schluss wieder nach Osten kreuz und quer über 1.200 Kilometer durch die Ukraine geführt hatte.
Gegen Nachmittag, einen Tag vor Weihnachten, fuhr der Zug in Schachty ein, Endstation. Ich wollte mich natürlich wieder erkundigen, wo meine Einheit sich befand und ob es mir bald wieder vergönnt sein würde, im trauten Kreis der Kameraden der hehren Schlachtmusik lauschen zu können, aber dazu kam es nicht mehr. Der Zug war umstellt von Feldgendarmerie und ab sofort hatte nur noch deren Kommando Gültigkeit. So hatte ich ein kurzes Intermezzo bei den „Kettenhunden“.
Mit ungefähr 300 400 Mann marschierten wir vom Bahnhof Schachty zu einem rund vier Kilometer entfernten Dorf. Dort wurden wir in Privatquartieren zu jeweils sieben oder acht oder mehr Mann in einem Haus untergebracht. Die Verpflegung bestand aus halb verschimmeltem Kommissbrot, für sechs Mann eins pro Tag, dann einer Handvoll harter Erbsen oder Bohnen oder was weiß ich für Hülsenfrüchten und einem ganz armseligen Stück Speck oder Fett. Da saßen wir also in einem kleinen russischen Nest mitten in der Steppe zwischen Don und Wolga und schoben Kohldampf. Die „Kettenhunde“ hatten uns allen das Soldbuch abgenommen. Ohne Soldbuch konntest Du Dich aber nirgends hin wagen, ohne dass Du, wenn sie Dich aufgriffen, sofort vor ein Standgericht gekommen und als Fahnenflüchtiger erschossen worden wärst. Es sollte noch bis Ende Januar 1943 dauern, bis ich einen Weg gefunden hatte, dort abzuhauen.
Inzwischen hatte die Sechste Armee im Kessel von Stalingrad kapituliert. Jetzt hätte eigentlich jeder, jedenfalls die Halbüberzeugten und die Mitläufer, einsehen müssen, dass alles verloren war, dass wir uns nun vom Faschismus befreien, Friedensverhandlungen einleiten und ein anderes, antifaschistisches Deutschland aufbauen müssten. Hätte! Aber nichts von dem! Von einigen wenigen Einsichtigen abgesehen schworen viele dieser von der NaziIdeologie zu Halbaffen gemachten Angehörigen der „deutschen Kulturnation“ schreckliche und ewige Rache und glaubten noch immer an den „Endsieg“. Das „Genie“ des „größten Feldherren aller Zeiten“ werde der Welt schon zeigen, wo es langgeht. Es war zum Verzweifeln.
Ende Januar, so um den 20. rum, war der Kessel in Stalingrad liquidiert und die Rote Armee formierte sich wieder neu, um weiter nach Westen vorzustoßen. Einzelne Stoßtrupps waren schon bis in den Raum Kalatsch vorgestoßen, ungefähr 150 Kilometer von uns entfernt.
Die faschistische Front wurde in diesem Bereich überwiegend von ungarischen, rumänischen und italienischen Verbänden gehalten. Dazu eine SSLeibstandarte (entweder „Adolf Hitler“ oder „Großdeutschland“, ich weiß es nicht mehr genau) und zwei bis drei Wehrmachtsdivisionen, das waren die ganzen „Verteidiger“ der südlichen Ukraine. Da war es nur eine Frage der Zeit, wann die Front zusammenbrach: Von Kalatsch runter über Schachty, Taganrog, Rostow weiter runter bis zur Krim. Wenn das nicht sehr schnell ginge, waren die faschistischen Verbände, die im Kaukasus standen und den Befehl hatten, die Sowjetunion von ihrem Ölnachschub aus Baku und Batum abzuschneiden, stark bedroht. Also musste dieser wahnwitzige Plan, über den Kaukasus hinweg ans Kaspische Meer vorzustoßen, schnellstens aufgegeben und die Okkupationstruppen schnellstens zurückgeholt werden. Das gelang den NaziFührern auch zum Teil durch brutale und rücksichtslose Gewaltmärsche, bis dann die Rote Armee die 300 Kilometer bis zum Asowschen Meer durchgebrochen war. So war die Lage.
Eines morgens beim Appell traf dann das ein, was ich befürchtet hatte: alle, die in der Lage waren, ein Gewehr halten zu können, wurden zu einem Marschbataillon zusammengestellt, was eilends dem Vormarsch der Roten Armee entgegen geworfen werden sollte. Es war vollkommen klar, das unser bunt zusammengewürfelte „Haufen“ nichts anderes sein konnte als ein Todeskommando. Das konnte ich nicht mitmachen.
Ich also schnurstracks zum Bataillonskommandeur und fragte ihn geradeheraus, ob er mir keinen Urlaubsschein ausstellen könnte. Er glaubte erst, nicht richtig gehört zu haben, dann schüttelte er nur den Kopf und gab an, an meinem Verstand zu zweifeln. Wie ich denn überhaupt auf so eine Idee käme. Ich erzählte ihn so unbefangen wie möglich, dass ich aus dem Lazarett käme und schon über zwei Jahre keinen Urlaub mehr gehabt hätte. Es ging etwas hin und her, aber zum Schluss kamen wir dann zu der Entscheidung, dass ich als Rekonvaleszent (also zwar aus dem Lazarett entlassen, aber noch nicht völlig genesen) nicht einsatzfähig wäre.
Am kommenden Morgen beim Abmarsch des Kommandos wurden nochmals alle Namen aufgerufen. Als mein Name verlesen wurde, tat der Leutnant ganz erstaunt: „Was machen Sie halbtoter Mensch in einer Einheit, von der allerhöchster Einsatz verlangt wird!? Wenn Sie sich auch gesund fühlen und mit wollen, kann ich Sie als Ballast nicht gebrauchen! Machen Sie sich schleunigst an den linken Flügel und gehen Sie zum Arzt!“ Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen.
Fast alle anderen rückten ab. Nur sehr wenige konnten sich aus dieser Todesmannschaft retten. Es vergingen zwei, drei Tage, da kamen einzelne versprengte Sturmtruppen zurück und berichteten eben über die Katastrophe, die über sie hereingebrochen war. Nun wurde es allerhöchste Zeit, dass ich diesem Verein den Rücken kehrte.
Ich musste zum Zahnarzt – oder besser: ich wollte zum Zahnarzt. Weil ich dafür nach Schachty musste, musste man mir nämlich das Soldbuch aushändigen. Ich bekam es mit der allerstrengsten Auflage, sofort zur Einheit zurückzukehren. An diesem Tag schaffte ich den Absprung.
An der Zufahrtsstraße nach Schachty stand schon ein Schild: „Überreste der Sechsten Armee sammeln sich im Raum Schachty! Weitere Hinweise bei der Ortkommandantur.“ Ich erkundigte mich, wo sich denn die Dritte Infanteriedivision sammelte und wanderte dorthin. Es waren vielleicht noch 50 bis 60 Mann. Aus meiner Kompanie waren noch drei Mann und der Spieß am Leben. Wir blieben einige Tage.
Schließlich kam der Abmarschbefehl, weil die Rote Armee im weiteren Vormarsch war. Wir saßen wieder auf offenen, rumpelnden LKWs, jetzt auf vereister und von Schneewehen unpassierbar gemachter Piste – Temperaturen um minus 30 Grad. Wir fuhren nach Südwesten.
Unterwegs sahen wir dann ein Bild, das wir so schnell nicht vergessen sollten und bei dem die ganze verbrecherische Brutalität der braunen Mörder deutlich wurde. Wir fuhren nämlich an einer vielleicht 300 – 400 Meter langen Mauer vorbei. Jedenfalls dachten wir, dass es eine Mauer sei. Bei näherem Hinschauen entpuppte sich die Mauer als Monument einer riesigen Gräueltat der Faschisten. Diese „Mauer“ bestand aus ermordeten Sowjetbürgern, aus Leichen, steif gefrorenen Leichen, teils in Uniform, teils in Zivil. Wenn ich bei einer Strecke von 400 Metern rund 1.000 Menschenleiber nebeneinander lege und bei einer Höhe von 1,50 m bis 2 m acht aufeinander, so macht das 8.000 bis 10.000 ermordete Sowjetbürger aus. Es war wohl keine Zeit mehr gewesen, die Ermordeten in einem Massengrab zu verscharren – in dieser zu Stein gefrorenen Erde.
Wenn ich mir vorstelle, dass die Rote Armee bei ihrem Vormarsch nach Deutschland Gleiches mit Gleichem vergolten hätte (was sie natürlich nicht tat – Kommunisten tun so was nicht), dann bestände Deutschland aus einer menschenleeren Mondlandschaft. Der ehemalige Offizier für wehrgeistige Führung, spätere Ministerpräsident von Bayern, „Verteidigungs“Minister der BRD, Franz Josef Strauß, der mal Kanzler von Deutschland werden wollte, hat einmal gesagt: „Ein Volk, das solch einen Aufbau geleistet hat wie das deutsche, hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr zu hören.“ Aufhetzung und Chauvinismus! Und wenn man sich Deutschland heutzutage ansieht mit seinen Truppen überall in der Welt: Imperialismus und Militarismus!
Nun wieder zurück zum Winter 1943. In der Nähe von Stalino (heute: Donetzk) wurde ein neues Quartier bezogen, denn die Kompanie musste wieder etwas „auf Vordermann gebracht“ werden und zwar durch „soldatische Disziplin“ – wie sie das nannten. Wir waren gerade mal wieder zu Geländeübungen mit Platzpatronen ausgerückt, als der Schreiber, das war die rechte Hand vom Spieß, also der „Schreibstubenbulle“, außer Atem angewetzt kam und meldete, das „russische“ Panzer nur noch wenige Kilometer entfernt von uns operierten. Im Laufschritt ging es nun zurück. Als wir – trotz der Kälte schwitzend – ankamen, lagen schon die Marschbefehle bereit. Je ein Unteroffizier oder ein Feldwebel mit ja sechs bis acht Mann erhielt einen Marschbefehl. Jeder schlage sich durch auf eigene Faust, ganz egal wie. Das Ziel war Dnjepropetrowsk. Das war ja die freudigste Überraschung, die es überhaupt geben konnte! Die Parole bei den deutschen Faschisten hieß nur noch – wie auf einem sinkenden Schiff – rette sich, wer kann!
Also, die tapferen und ruhmreichen Deutschen und mit ihr die verbündeten Armeen befanden sich auf der Flucht vor dem so geschmähten „slawischen Untermenschen“. Meine Gruppe hatte sich, wie zu erwarten war, in dem heillosen Durcheinander verloren. Ich weiß nicht, ob alle das Ziel Dnjepropetrowsk erreicht haben. Aber nach und nach trafen dort doch viele Überlebende ein. Inzwischen war es März 1943 geworden.
Frankreich und Heimaturlaub im faschistischen Köln (1943)
Wir gingen täglich auf die Ortskommandantur und horchten im Soldatenheim herum, was denn nun eigentlich los war und was mit dem Scherbenhaufen, der sich noch immer stolz „Sechste Armee“ nannte (wenn auch nur noch klägliche Reste derselben am Leben waren), passieren sollte. Eines Tages hörten wir die Nachricht, dass jetzt der Zug zusammengestellt sei und am nächsten Tag die Abfahrt nach Frankreich bevorstünde. Da blieb nicht mehr viel Zeit zu überlegen, wir schnürten unsere Bündel und fuhren ins Ungewisse. Kälte, Hunger, Läuse und Dreck waren zeitweise unerträglich. Nach acht Tagen erreichten wir die polnische Grenze. Wir erreichen Beuthen und Gleiwitz, fuhren über Oppeln nach Breslau. In Schlesien war vom Krieg und der mit ihm verbundenen Zerstörung noch nicht viel zu spüren und die Begeisterung für Hitler und die braune Kumpanei stand noch immer hoch im Kurs – trotz der gerade erfolgten Niederlage von Stalingrad. Wir hatten in Breslau einen längeren Aufenthalt und konnten den Zug verlassen und uns ein wenig die Beine vertreten.
Überall wurden wir als „die Helden von Stalingrad“ gefeiert. Die B.D.M., Rotkreuz und WehrmachtsMädchen und was sonst alles an weiblichen Uniformierten herumlief, fielen uns um den Hals und knutschen uns ab. Nach diesem seltsamen Intermezzo fuhren wir weiter über Görlitz, Dresden, Leipzig und Eisenach. Ob unser Ankommen immer schon im voraus telegraphiert wurde? Der Empfang war immer gleich, wenn der kümmerliche Rest der „glorreichen“ Sechsten Armee im Bahnhof einlief – Menschenmengen, die uns zujubelten, uns Proviant und Alkohol zusteckten. Man wollte uns verlorenen Söhnen der faschistischen Mutter Germania wohl den Glauben und die Hoffnung auf den Endsieg und die Geborgenheit im Schoße des „Tausendjährigen Reiches“ wieder näher bringen und sicherlich den jubelnden Idioten auf den Bahnsteigen auch.
Als wir dem Ruhrgebiet entgegenfuhren und dem Rhein immer näher kamen, wurden die Bilder der Zerstörung durch den Luftkrieg größer und die „Empfangskomitees“ auf den Bahnhöfen immer kleiner und einfacher. Inzwischen fuhren wir nachts, weil die alliierte Lufthoheit über Deutschland Eisenbahntransporte bei Tageslicht unmöglich machte. So fuhren wir eines nachts auch durch Köln – über die Hohenzollernbrücke, Hauptbahnhof. Wie gern ich ausgestiegen wäre, ist wohl jedem klar. Wir fuhren weiter über Belgien nach Frankreich, über Paris Richtung Südfrankreich. Südlich von Bordeaux erreichten wir dann nach fast vier Wochen unser Ziel, ein kleines Nest vier Kilometer entfernt von St. Jean Pied le Port.
Also, da waren wir nun und die abenteuerliche, abwechslungsreiche und beschwerliche Fahrt war zu Ende und der triste KommissAlltag sollte wieder Besitz von uns ergreifen. Nach einiger Zeit des Exerzierens und der Disziplinübung hieß es plötzlich, diejenigen, die im Lazarett waren und noch keinen Urlaub hatten, sollen sich auf der Schreibstube melden. Ich war mit unter den Glücklichen. Drei Wochen Heimaturlaub hatte ich nun. Meine Eltern hatten wegen der dauernden Luftangriffe eine zweite Wohnung 10 Minuten entfernt im Bunker. Meine Brüder und meine früheren Freunde waren alle so wie ich in fremden Ländern, in denen wir alle nichts zu suchen hatten.
Der Heimaturlaub war widerlich. Jeder vor allem jede wollte mich bemuttern und versuchte mich zu verwöhnen. Ich war ein „Held von Stalingrad“ und alle diese Banausen, die uns vor dem Krieg, als wir noch „schäbige Zivilisten“ waren, von Polizei und SA verjagen und verfolgen ließen und uns für nichtswürdiges „Kommunistenpack“ hielten, überboten sich jetzt an Liebeswürdigkeiten. Und nicht nur B.D.M.Bräute liefen mir nach, es waren auch wohlsituierte verheiratete Frauen, deren Männer gerade irgendwo im Ausland das Vaterland verteidigten, mit eindeutigen Angeboten dabei. Ich hatte urplötzlich eine ganz neue Anziehungskraft für Frauen als „Held von Stalingrad“.
Ich haute einige Tage früher wieder aus Köln ab. Das ganze Theater hing mir zum Halse heraus. Alle außer meinen Eltern waren in fast hysterischer Weise dem „Führer“ verfallen, beteten NaziParolen vor sich her und verliehen mir einen Heiligenschein. So fuhr ich dann viel zu früh und unter dem großen Bedauern meiner Eltern wieder Richtung Frankreich. Zuvor hatte ich mit ihnen meine Desertation von der faschistischen Wehrmacht durchgesprochen und unterschiedliche Möglichkeiten erörtert.
Nachdem ich wieder bei meiner Einheit angekommen war, wurde die Kompanie nun unterschiedlich aufgeteilt. Wir waren ja aus unterschiedlichen Bataillonen und Regimentern zusammengewürfelt. Wie ja vorher schon erwähnt, waren aus meiner ursprünglichen Kompanie nur einige wenige Mann übrig geblieben. Wir wurden nun auf volle Kompaniestärke „aufgefüllt“ – mit Neuzugängen, die frisch aus der Heimat exportiert worden waren oder von anderen Einheiten abgestellt wurden.
Desertation in Italien (1943)
Eines Tages ging es dann wieder auf Transport, jetzt Richtung Osten zum Mittelmeer, es ging Schlag auf Schlag: erst nach Lyon, dann nach Toulon, über St. Raphael, Cannes, Nizza, Monte Carlo über die italienische Grenze. Weiter ging es über San Remo, Savona und Genua bis nach La Specia, von dort nach Florenz. In Florenz gab es – vollkommen absurd – einen ähnlichen Empfang im Bahnhof wie vor rund drei Monaten in Breslau. Italienische Fronthelferinnen und FaschistenMädchen fielen uns um den Hals und begrüßten uns als „Retter“ vor der Landung der Alliierten in Italien, die nach dem Zusammenbruch des glorreichen „Deutschen Afrikacorps“ unter Rommel unmittelbar bevorstand. Inzwischen war Frühsommer 1943, ich war gerade 21 Jahre alt geworden.
Die Faschisten in Italien waren genauso besessen und fanatisch wie unsere verfluchten NaziHorden. Zum Glück hatten sie aber bei der Bevölkerung wie auch beim Militär bei weitem nicht jenen Rückhalt wie die Nazis bei der ja so „intelligenten“ deutschen Bevölkerung. Im Gegensatz zur Lage in Deutschland sahen sehr viele Italiener und sogar viele der Faschisten später die Nutzlosigkeit des weiteren Kampfes ein, schlugen sich auf die richtige Seite und desertierten, trugen so zu einer früheren Beendigung des Krieges bei und ersparten so tausenden oder hunderttausenden viel Elend und Not! Von unseren hirnverbrannten und kleinkarierten EwigGestrigen wurde das natürlich als der größte Verrat an Europa im allgemeinen und unserem großdeutschen Vaterland und unserem geliebten „Führer“ und seiner MordGmbH im besonderen verurteilt und gebrandmarkt. Sie heulten vor Wut und stießen die schrecklichsten Bedrohungen und Verwünschungen aus.
Wir waren jetzt seit der Abreise in Frankreich rund 2.000 Kilometer mit der Bahn gefahren, kamen am Lago di Trasimeno vorbei und erreichten über Orvieto endlich unser vorläufiges Ziel: den Lago di Bolsena. Hier wurden wir noch ein Stück mit LKWs transportiert, und in Zelten in einem Wald nahe dem kleinen Ort Martha bezogen wir unser Quartier.
Es gab wieder den üblichen MilitärAlltag. Kontakt zur Bevölkerung war hier schwieriger als in der Sowjetunion oder in Frankreich. Es haperte mit der Sprache und wir waren ja nicht mehr in „Feindesland“, d.h. wir konnte nicht mehr so frei reden und ich mich nicht als NaziGegner bekennen. Natürlich lernten wir schnell die nötigsten Worte und radebrechten bald auch auf Italienisch – bis auf die hirnamputierten und arroganten braunen Jünglinge in Uniform, die auf dem Standpunkt standen, dass „dieses Gesindel“ doch deutsch lernen solle, wir als deutsche „Herrenmenschen“ hätten es jedenfalls nicht nötig, deren „Kauderwelsch“ zu lernen. Trotzdem – Schande, oh Schande! – lernten wir die Sprache der „Verräter“, denn „der Italiener“ ist „kein Soldat“ und hat den großartigen und glorreichen Sieg des „deutschen Adlers“ über die „slawischen Untermenschen“ und die „jüdischbolschewistische Weltverschwörung“ durch seinen „feigen Verrat“ vereitelt. Nach und nach stellten wir dann aber doch fest, dass man sich in Italien mit der Bevölkerung wesentlich besser unterhalten konnte als mit dem größten Teil der aufgehetzten „Volksgenossen“ in Deutschland.
Die alliierten englischen und amerikanischen Truppen waren inzwischen auf Sizilien gelandet. Alle konnten sich ausrechnen, dass der Tag der Entscheidung immer näher rückte. Die alliierte Luftflotte flog jetzt fast täglich über uns hinweg. Die italienischen Soldaten warfen scharenweise ihre Waffen weg, vernichteten ihre Fahrzeuge, Kanonen und Panzer oder ließen sie am Wegrand stehen und gingen einfach nach Hause. Mit SS und FeldgendarmerieAngehörigen, die sie aufhalten wollten, lieferten sie sich noch Gefechte, bei denen es auf beiden Seiten Tote gab.
Aus unserem Regiment wurden Einheiten Richtung Süden in Bewegung gesetzt, um die allgemeine Auflösung der italienischen Armee mit verhindern zu helfen.
Die deutschen Idioten und NaziAnhänger heulten über den „durch nichts wieder gut zu machenden Verrat“ der „Itaker“. Hätten doch die deutschen Soldaten nur einen Bruchteil von dem Mut besessen, den die italienischen „Verräter“ besaßen, denn zu dem, was die machten, gehörte wirklich Mut. Unter den Augen der deutschen Besatzer die Waffen wegzuwerfen oder zu vernichte, bedeutete Todesgefahr. Dafür muss man den tapferen italienischen Soldaten höchstes Lob zollen (wenn man die Sache nur etwas realistisch und objektiv betrachtet)! Jedenfalls hatte der „Verrat“ der italienischen Truppen dazu geführt, dass die entstandenen Lücken wieder mit deutschen oder anderen hilfswilligen Soldaten verbündeter Länder aufgefüllt werden mussten.
Die Kapitulation bzw. Revolte der italienischen Truppen hatte vor allem in der Gegend von Rom und weiter südlich stattgefunden. Mussolini, „Il Duce“, war verhaftet, dem deutschen „Führer“ ein weiterer Zacken aus der Krone gebrochen worden und an vielen Hausfassaden wurden Parolen angebracht wie: „Hitler et Duce kaputt“, „La guerra finito“. Der Krieg zu Ende. Leider hatten sie damit noch nicht ganz Recht. „Il Duce“ wurde von dem SSFührer Skorzeny und seiner Bande wieder befreit und der „Führer“ konnte sich noch immer auf seine blöden Schäfchen in Deutschland verlassen. Sie brachten nicht den Mut auf, den die als „Feiglinge“ verschrienen italienischen Soldaten gezeigt hatten. Lieber ließen sie sich im Massengrab verscharren, als ein einziges Mal in ihrem Leben Zivilcourage zu zeigen und den Krieg zu beenden.
Eines Tages fuhren wir mit unserem LKW vom Lago di Bolsena Richtung Rom, als plötzlich ein „hohes Tier“ der Fallschirmjäger, vielleicht ein Oberst oder General mit seinem Adjutanten mitten auf der Astraße steht und unseren Wagen anhält. Unser Unteroffizier spritzte natürlich aus dem Führerhaus des LKW, baut sein Männchen vor dem schwarzen Luftheini:
„Unteroffizier `sowieso´ mit 40 Mann vom I. Regiment `sowieso´, abkommandiert zum Requirieren von Fahrzeugen!“, schmettert er laut und hell wie Fanfarenklänge des Hitlerjungen Quex in die klare Luft und in die Ohren des Schwarzuniformierten.
Der winkt nur lässig ab und meint: „40 Pfeifen wie Ihr, dazu alle noch im Besitz eines Führerscheins, kann ich gut gebrauchen. Ab sofort gehört Ihr dem FallschirmjägerRegiment 8 unter Führung des Oberst Koch an!“
Oberst Koch war bei uns bekanntberüchtigt. Wie sich später herausstellte, war er der Oberst Koch selbst.
Wir mussten mit unserem LKW ihrem PKW folgen bis zum Regimentsstab. Es hieß ganz einfach: „So, Ihr seid nun Angehörige der Fallschirmjäger und gehört zur Stabskompanie!“
Einwände oder Proteste konnte es natürlich nicht geben von unserer Seite. Fallschirmjäger, UBootBesatzungen und SSAngehörige waren niemandem verpflichtet und keine Rechenschaft schuldig und konnten somit schalten und walten, wie sie es wollten.
Nun waren wir in der Region Rom stationiert. Wir waren privat einquartiert und es gab Familien – so auch die, bei der ich Quartier hatte –, die genau denselben Standpunkt vertraten wir ich und dem „Duce“ und dem „Führer“ die Pest an den Hals wünschten. Wir schimpften gemeinsam auf den ScheißKrieg, den lausigen „Duce“ und den verfluchten „Führer“. Auf der Hausfassade wie auf vielen anderen auch standen Parolen wie: „Hitler et Duce la morte“ (Tod für Hitler und Duce) oder „Vive la vincere antifascista“ (Es lebe der antifaschistische Sieg). Es gab deutsche Soldaten, die sich darüber aufregten. Aber da sich auch sehr viele nicht darüber aufregten, blieben die Häuser in ihrer schönen Bemalung, wie sie waren.
An einem schönen Morgen tauchte der Oberst bei uns auf und verkündete uns, dass uns unsere alte Einheit zurückverlangen würde. So kamen wir wieder unter den alten Befehl. Der für uns jetzt zuständige Gruppenführer wurde aufgefordert, uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit besonders scharf ranzunehmen.
Die Landung der britischen und amerikanischen Truppen geschah bei Neapel und Salerno. Inzwischen war es Anfang September 1943 geworden, mein 21. Geburtstag lag schon wieder drei Monate zurück. Es hieß: „Alles aufsitzen, es geht in Richtung Neapel. Wir müssen den Ami aufhalten und zurückwerfen.“ Nach einer 67stündigen Fahrt hatten wir die ca. 200 Kilometer, die uns von der Invasionsarmee trennten, zurückgelegt. Wir hörten das Grollen der Schlacht, die Detonationen von Bomben und Granaten. In der Gegend zwischen Aversa und Caserta, ungefähr 20 Kilometer nördlich von Neapel, hieß es mal wieder: „Alles absitzen!“ Es folgte ein einige Stunden währender Fußmarsch, bis wir gegen drei Uhr morgens die Stelle erreicht hatten, an der wir für Führer, Volk und Vaterland geopfert werden sollten.
Mein Zug bezog Stellung auf einer etwa 5–6 Meter hohen Böschung, von der man einen Überblick hatte auf große Weinfelder, die unter uns lagen. Mein Schützenloch lag an „allergünstigster Position“, wie mein Zugführer meinte. Ich empfand das anders. Die Stelle, die mir zugewiesen war, lag über der Weggabelung zweier Hohlwege, wie auf einem Aussichtsplateau und war eine vortreffliche Zielscheibe für etwaige alliierte Angriffe. Das sagte ich dann auch dem bornierten Zugführer. Außerdem sagte ich ihm auch noch ein paar weitere Liebenswürdigkeiten, die darin gipfelten, dass ich mich hinreißen ließ zu der Frage:
„Warum begreift Ihr Hornochsen denn nicht, dass wir hier nur unseren Kopf hinhalten sollen, damit die Kapitalisten als Kriegsgewinnler und die braunen Horden in der Etappe dick und fett werden?“, und dann weiterzumachen mit: „Leckt mich doch am Arsch mit Eurem verfluchten Krieg! Mit jedem Tag, den wir hier herausschinden und den Krieg verlängern sollen, halten wir doch nur diese Verbrecher am Leben.“
Die Antwort war: „Sie verdammter Idiot! Sie sind ja ein Meuterer, ich bringe Sie vors Kriegsgericht. Das werden Sie noch bereuen!“
Es gab einiges Hin und Her, dann wurde die Entscheidung auf den nächsten Morgen verschoben. Zur Strafe musste ich erstmal heute Abend Essen holen von der Feldküche, etwa zwei Kilometer entfernt. Das wäre nun eigentlich keine Strafe gewesen, aber man muss wissen, dass der Weg dorthin seit nachmittags unter alliiertem Artilleriebeschuss lag. Ein mir unbekannter Soldat wurde ebenfalls dazu eingeteilt. Als wir wieder einmal in Deckung springen und eine Zwangspause einlegen mussten wegen des Artilleriebeschusses, legte er los: „Verdammter Mist, verfluchte Scheiße, ich bin es leid! Ich haue ab bei der nächsten Gelegenheit.!“
Nun hatte ich einen gefunden, der auch desertieren wollte. Ich hatte den Gedanken nie aufgegeben, war in der letzten Zeit aber viel zu lange im Hinterland gewesen, um überlaufen zu können. Jetzt schien es hier möglich zu sein. Ich pflichtete ihm bei, schilderte ihm meine Überzeugung. Ob er mit mir zusammen gehen wolle? Er war sofort bereit und wir entwarfen einen Plan, wie wir die Sache organisieren wollten. Er war kein Antifaschist, eher ein dummer Bauernjunge. Ohne das Erlebnis dieses unerbittlichen Artilleriebeschusses wäre er wahrscheinlich weiterhin ein treudoofer Vasall des Führers geblieben. Jedenfalls hätte er in seiner Dummheit fast unsere Flucht vereitelt.
Ich hatte ihm eingeschärft: „Wir zwei melden uns heute Abend auf Horchposten.“
Wie der Name schon besagt, handelt es sich um die Aufgabe, den „Feind“, wenn er sich nähern sollte, frühzeitig aufzuspüren. – eben durch „Horche“. Dazu mussten sich zwei Mann 5060 Meter vor den eigenen Linien in die Felder legen und tarnen. Dann sollten sie frühzeitig hören oder sehen, wann der „Feind“ nahte und die eigenen Truppen warnen. Das alles natürlich ab Einbruch der Dunkelheit, bei zweistündiger Ablösung bis Tagesanbruch.
Mein Begleiter war völlig nervös und durchgedreht und wollte sofort einfach durch die Weinfelder nach vorn rennen „zu den Amis“. Das hätten unsere rückwärtigen Spähposten natürlich sofort bemerkt und wir wären nicht weit gekommen. Ich konnte ihn gerade noch einfangen. So ist es nochmal gut gegangen. Nachdem ich unmissverständlich auf ihn eingeredet und ihn förmlich dazu gezwungen hatte, erst einmal eine Stunde still auf dem uns angewiesenen Posten zu liegen, beruhigte er sich etwas. Als ich dann sagte, dass wir nun langsam abhauen könnten, drehte er schon wieder durch, wollte einfach aufspringen und losrennen. Ich machte ihm klar: „Nein! Wir müssen erst unsichtbar für unsere eigenen Linien weiter nach vorne kommen, bis wir aus ihrem Gesichtsfeld sind. Dann schießen wir einige Male um uns, um ein Gefecht vorzutäuschen. Sonst glauben sie die Gefangennahme nicht und suchen uns.“ Schließlich ging auch das in seinen blöden Schädel hinein. Wir handelten nach meinem Plan und setzten uns ab Richtung Neapel – Richtung der alliierten Truppen.
Etwa drei Wochen danach bekamen meine Eltern die Nachricht: „Ihr Sohn ist vermisst nach einem Gefecht vor Neapel.“ Es war wichtig, dass sie an eine Gefangennahme geglaubt hatten, denn im Falle einer bekannt gewordenen Desertation eines Soldaten wurden häufig die Eltern, falls vorhanden die Ehefrau oder andere Verwandte in der Heimat belangt – eben Sippenhaft. Meine Eltern wussten sofort Bescheid, wir hatten ja bei meinem letzten Heimaturlaub alles beredet und in meinem letzten Feldpostbrief hatte ich, so war es verabredet, von „Kanada“ geschrieben.
Es waren nach unserem Verschwinden vom Horchposten, den wir ja um 8.00 Uhr abends angetreten hatten, inzwischen wohl rund drei Stunden vergangen, als wir auf ein einsames Haus stießen, das neben einer gesprengten Straßenbrücke stand. Ich klopfte an und nach einer geraumen Zeit wurde uns die Tür von einer sehr verängstigten älteren Frau geöffnet. Als sie uns sah, fiel sie fast in Ohnmacht. „Oh Madonna! Oh, Madonna! Mia niente! Niente!“ flehte sie uns an. Als wir dann den Grund für ihre Angst erfuhren, wurden wir auch bleich im Gesicht.
Die Banditen von der WaffenSS hatten kurz zuvor einfach die Brücke in die Luft gejagt, ohne die Leute zu warnen. Die Fenster waren kaputt und einige der Leute, die noch im Haus waren, waren verletzt. Und nun dachte die arme Alte, die Verbrecher von der SS wären zurückgekommen und würden sie abknallen. Denen kam es ja auf ein Menschenleben mehr oder weniger nicht an. Als sie nun hörten, dass wir „Tedesci desertatore“ waren, freuten sie sich gewaltig und verabschiedeten uns mit vielen guten Wünschen und sehr herzlich.
Durch sie hatten wir nun erfahren, dass sich Einheiten der SS in der Gegend aufhielten. Wir mussten doppelt vorsichtig sein. Aber mit „Molto Fortuna“, wie die Italiener aus dem Haus an der Brücke uns gewünscht hatten , erreichten wir nach etwa einer weiteren Stunde die alliierten Truppen. Endlich waren englische Laute zu vernehmen.
Neben der Straße, auf der wir gingen, floss ein kleiner Bach. Bäume und etwas Unterholz standen entlang seiner Ufer. Wir warfen unsere Gewehre und die Stahlhelme einfach ins Gebüsch und marschierten freiweg einfach auf die englischen Geräusch zu. Hinter der nächsten Kurve sprangen „Amis“ von rechts aus dem Unterholz und von links von der Anhöhe, die die Straße auf der anderen Seite begleitete, herunter – alle mit der Maschinenpistole im Anschlag.
„Stop! Hands up!“, riefen sie und kamen auf uns zu. Als sie sahen, dass wir keine Waffen bei uns trugen, nahmen sie die MPs runter und fragten: „Why are you here? What’s the matter with you german sons of a bitch!?“ (Was ist los mit Euch? Warum seid Ihr deutschen Hundesöhne hier?) Damals verstand ich noch nicht viel von den Wörtern und konnte deshalb auch nicht viel antworten. Englisch war nun wieder eine total neue Sprache, mit der ich mich anfreunden musste. Es war nach russisch, französisch und italienisch die vierte. Ich versuchte dann, auf italienisch mich ihnen verständlich zu machen, sie verstanden aber auch kaum ein Wort dieser Sprache. So war die Verständigung schneller beendet, als sie begonnen hatte. Wir wurden durchsucht, und als sie den Inhalt unseres Brotbeutels in Augenschein nahmen, schüttelten sie nur den Kopf und brachen in Lachen aus. Wir lachten mit, und so war der Bann gebrochen.
Nach einigen Hin und Her kam dann ein Offizier, der deutsch sprach:
„Also, Ihr beiden, was ist mit Euch“?
„Wir hatten den festen Vorsatz, bei der nächsten Gelegenheit den NaziVerbrechern den Rücken zu kehren.“
„Also seid Ihr abgehauen aus ideologischen Gründen?“
„Jawohl, wir wollen mit den NaziBarbaren nichts zu tun haben.“
Als ich ihm dann noch erzählte, dass meine Eltern und meine (noch lebenden) Geschwister auch gegen die Nazis seien und sabotierten, wo sie könnten, freute er sich gewaltig und sagte, dass er mit seiner Familie 1933 über die Schweiz von Deutschland in die USA geflüchtet sei, um einer Verfolgung zu entgehen. Er meinte, dass er damals schon geahnt hätte, wie sich Deutschland unter dem Faschismus entwickeln würde. Aber eine solche Barbarei, verübt von einem solchen verbrecherischen System, hatte er doch nicht erwartet. Er verabschiedete sich dann von uns und wir konnten uns erstmal eine Nacht lang ausschlafen.
Am frühen Morgen wurden wir geweckt und es hieß wieder einmal: „Aufsitzen!“, diesmal aber auf englisch! Es ging im Jeep weiter zurück hinter die Front. Was wir da an Artilleriestellungen, Material und Munition sahen, war unfassbar. Die hatten so viele Granaten wie die faschistische deutsche Armee in Italien Gewehrpatronen!
In einem etwas größeren Dorf hielt unser Jeep auf dem Marktplatz an. Die Bevölkerung kam an das Fahrzeug und beschimpfte und bespuckte uns und versuchte uns zu schlagen. Als ich ihnen sagte: „Io niente fascista! Noi desertori!“ (Ich bin kein Faschist, wir sind Deserteure), schlug ihr Hass in Begeisterung um und man brachte uns Blumen!
Amerikanische und englische Gefangenschaft in Nordafrika (1943/44)
Es war Ende September/Anfang Oktober 1943, wir kamen in ein GefangenenLager. Nach und nach kamen immer mehr Gefangene, der StacheldrahtVerhau füllte sich zusehends. Auch wir Antifaschisten wurden immer stärker und bestanden nun schon fast aus 20 Mann. Einige Deserteure kamen sogar in Zivilklamotten! Die italienische Bevölkerung hatte sie bei ihrer Flucht wunderbar unterstützt und ihnen Zivilsachen besorgt. Da bestand eben der riesengroße Unterschied zwischen Deutschland und Italien. In Italien war der überwiegende Teil der Bevölkerung gegen den Faschismus. Und in Deutschland marschierte das dumme Volk mit offenen Augen in den Untergang.
Da wir Antifaschisten inzwischen sogar schon mehr als 20 Mann waren, wagten sich die deutschen Gefangenen, die noch immer an den Führer glaubten und die wir offen „Faschisten“ nannten, nicht an uns heran. Der harte Kern von denen bestand auch nicht aus vielen, aber die Mitläufer hielten sich noch mehr an die als an uns.
Als im Lager so rund 110120 Mann waren, wurden wir auf Landungsboote verladen. Mit drei Booten fuhren wir dann nach Afrika hinüber. Mit uns fuhren verwundete amerikanische Soldaten, die dort in die Genesungsstation sollten. Von Neapel ging es an der italienischen Küste nach Süden, dann an der sizilianischen Küste weiter Richtung Tunesien, wo wir erst ausgeladen werden sollten. Schließlich fuhren wir dann aber noch in das fast 1000 Kilometer entfernte Oran in Algerien, kurz vor der Grenze zu Marokko.
Nach der strapaziösen Seereise marschierten wir dann rund 10 Kilometer ins Gefangenlager, einem P.O.W.Camp (Prisoner of War), wie sie es nannten. Das Lager war vielleicht 200 x 200 Meter insgesamt, eingezäunt mit Stacheldraht. Wir „Zwanzig“ blieben vorerst noch zusammen in einer Abteilung des Lagers.
Nun waren wir von den amerikanischen Fronttruppen fort und befanden uns unter dem Kommando der Etappe. Diese amerikanische „Etappe“ kannte nur „Amerikaner“ und „Deutsche“, einen Unterschied zwischen Faschisten und AntiFaschisten konnten sie oder wollten sie nicht sehen. So wurden wir „Zwanzig“ getrennt und kamen willkürlich mit allen möglichen Nazis zusammen in die Unterkünfte. Wir bleiben aber trotzdem eine starke Gruppe und noch wagten die Faschisten es kaum, uns anzugreifen oder zu überfallen. Schließlich ist es diesen verfluchten Verbrechern aber doch gelungen, Leute von uns zu ermorden, wenn sie sie allein oder zu zweit erwischen konnten – sie haben sie dann in der Latrine verscharrt.
Der Aufenthalt in diesem Lager dauerte zum Glück nicht sehr lang. Eines schönen Morgens marschierten wir zum Bahnhof von Oran, von dort ging es per Zug in das ungefähr 350 Kilometer entfernte Algier. Zu unserer Überraschung nahmen uns englischen Truppen in Empfang. Da die Amerikaner uns zwanzig Antifaschisten noch weniger mochten als die restlichen hundert Faschisten, gab es natürlich keinen Schutz für uns. Wir wurden willkürlich aufgeteilt. So landeten wir immer mit drei, vier oder fünf Mann in den Camps mit Nazis, Mitläufern und Indifferenten. Das erschwerte unseren Zusammenhalt sehr.
Am nächsten Morgen, ich traute meinen Ohren kaum, ertönte eine Trillerpfeife und ein ehemaliger Hauptfeldwebel brüllte – Tonfall wie früher – laut über den Platz: „Alles raustreten zum Singen!“ Alle flitzen aus ihren Zelten. Naja, fast alle. Wir vier Antifaschisten lagen – natürlich – in einem Zelt und rührten uns nicht. Von allen Seiten wurden wir angebrüllt: „Das geht auch Euch an! Wenn Ihr nicht freiwillig kommt, machen wir Euch Beine!“ Wir kamen trotzdem nicht. Wie wir beobachten konnten, verlief das „Singen“ so, dass man innerhalb des Stacheldrahtes im Kreis marschierte und dabei heroische Vaterlandslieder sang. Das Ganze endete dann mit dem Absingen des Deutschland und des HorstWesselLiedes.
Wir wurden der deutschen Lagerleitung gemeldet (Kriegsgefangenenlager hatten immer eine innere Leitung). Zu fünft mussten wir vor einem deutschen ehemaligen Offizier und einem ebenso ehemaligen Oberfeldwebel, ich glaube er war das sogar nur „stellvertretend“, erscheinen. Wohlgemerkt, vor deutschen, nicht vor englischen oder alliierten. Der Feldwebel, dieses Saustück, brüllte uns an, als wären wir auf dem Kasernenhof: „“Was fällt Euch ein! Wir repräsentieren hier die ruhmreiche deutsche Wehrmacht! Wir befinden uns immer noch im Kampf für Führer und Großdeutschland, auch wenn wir momentan hinter Stacheldraht sitzen! Der Kampf wird trotzdem weitergehen!“, und lauter solche hohlen Phrasen. Man bedenke: so etwas in alliierter Kriegsgefangenschaft! Wären diese elenden Verbrecher, die sich auf die Genfer Konvention als Kriegsgefangene beriefen, in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gewesen, hätten sie nicht gewagt, ihre großdeutsche Schnauze so weit aufzureißen. Aber hier wurde das ja wohlwollend von den alliierten Offizieren geduldet! Die deutsche Zackigkeit der getrimmten Hitlertreuen und die Feigheit und Unterwürfigkeit der feldgrauen Muskoten imponierten ihnen gewaltig. Zumal in mindestens 50% der angloamerikanischen Offiziere der faschistischantikommunistische Funken glühte und nur darauf wartete, entzündet zu werden. Sie hätten es auch gerne gesehen, wenn ihre Untergebenen so sklavisch und feige gegenüber ihren Vorgesetzten gewesen wären wie die deutschen „Herrenmenschen“.
Dieser hervorragenden deutschen Lagerleitung gegenüber versuchte ich alles so darzustellen, als wäre ich für die Vernunft „für uns alle“: Das Absingen von „Deutschland, Deutschland über alles“ und dann noch des „HortsWesselLiedes“ müssten die Engländer doch als Provokation ansehen, und deshalb hätte ich mich geweigert mitzumachen. Da war dann alles aus. Die sich erst mit mir zusammen verweigert hatten, machten jetzt den Kratzfuß und Kotau. Daraufhin konnten sie gehen. Ich wurde noch mal besonders vorgenommen von den beiden „Lagerleitern“: Ich solle mich nur nicht noch einmal unterstehen und irgendeine Anordnung kritisieren oder gar versuchen andere aufzuhetzen. Sie hätten noch immer die Macht über uns, auch in Gefangenschaft. Und für Ordnung sorgen könnten sie allemal.
Diese feigen Verbrecher hatten vorher aus Angst vor Repressalien ihre DienstgradAbzeichen abgetrennt. Als sie aber sahen, dass ihre faschistische und antikommunistische Saat auch bei den westlichen Alliierten keimte und blühte, formten sie sich aus Silberpapier oder ähnlichen Sachen Litzen und Sterne und befestigten alles schön an ihrer Schanduniform, um der Welt und vor allem auch uns wieder kund zu tun, in welch hohem Rang sie ihrem Führer gedient hatten.
Mit meinen „Kameraden“, die den Kratzfuß besser fanden als den aufrechten Gang, redete ich kein Wort mehr, ich konnte sie ob ihrer Feigheit einfach nicht mehr beachten.
Also konnte mein Bemühen jetzt nur heißen, nichts wie weg aus diesem fanatischen FaschistenHaufen, der sich deutsches Kriegsgefangenlager nannte. Ich hatte Glück. Am nächsten Morgen wurden freiwillige Arbeiter für die englische Armee gesucht. Natürlich meldete ich mich sofort.
Fast wäre es noch schief gegangen, denn die Nazis bekamen Wind von meiner geplanten „Umsiedelung“ und wollten sich noch schnell an mir rächen. Mit den Ausrufen: „Du verdammtes Schwein!“ „Wir wissen schon, wohin Du willst“ und: „So einfach kommst Du uns nicht davon“ fielen sie über mich her. Ich wehrte mich, so gut es ging. Aber ich stand auf verlorenem Posten. Es waren 10 – 12 Mann, die über mich herfielen und es hätte böse für mich ausgesehen, wenn die zwei Soldaten, die uns bewachten, nicht eingegriffen hätten. Die beiden Posten drängten mit vorgehaltener MP die Nazis zurück. Die Arbeit wurde sofort eingestellt und es ging ins Camp zurück, ich packte meine Sachen zusammen und unter dem Wutgeheul der entmenschten NaziHorden verließ ich zusammen mit den beiden Soldaten diesen Teil des NaziLagers. Nun hätte natürlich für andere die Möglichkeit bestanden, sich mir anzuschließen. Aber keiner machte auch nur den Versuch.
Ein Posten brachte mich dann ins englische Lager. Ich staunte nicht schlecht, als ich dort von ungefähr 50 Mann stürmisch begrüßt wurde. Die Engländer hatten – im Gegensatz zu den Amerikanern – ein gesondertes antifaschistisches Lager. Das war schon eine Wohltat, und den „Tommys“ gebührt dafür noch heute mein Dank.
Die Engländer gaben uns viel Unterstützung. Wir bekamen englische Uniformen und waren von den englischen Soldaten nur noch durch die Sprache und dadurch zu unterscheiden, dass wir keine Waffen trugen. Wie gerne hätten die Faschistenschweine uns gelyncht, wenn sie uns erwischt hätten.
Bald kamen noch weitere deutsche Antifaschisten, so dass wir auf ca. 80 – 90 Mann anwuchsen. Von den deutschen Gefangenen aus unserem Lagerkomplex – ich möchte sie nur noch Nazis nennen meldete sich keiner, um in unser Lager zu kommen! Sie wurden immer mehr zusammengepfercht, es befanden sich rund 500 Mann dort. Dieser Kadavergehorsam war nicht zu fassen. Weder jetzt noch in der nächsten Zeit meldete sich auch nur einer dieser blöden Heinis bei uns und wollte raus aus dieser NaziTyrannei. Nichts, einfach nichts. Viele dieser Idioten trauten sich einfach nicht, obwohl sie keine 100%igen Nazis waren, weil sie befürchteten, die Faschisten könnten am Ende den Krieg doch noch gewinnen und dann könnten sie nicht mehr nach Deutschland zurückkommen oder würden gar nach einem Sieg der Faschisten an Deutschland ausgeliefert. Wie dem auch sei, man musste sie einfach als Nazis oder deren Mitläufer bezeichnen und vor allem als solche ansehen. Alles andere wäre gefährlich gewesen. Denn diese verfluchten Mitläufer waren die Schlimmsten. Sie hatten überhaupt keine Meinung, machten alles mit, was die Nazis ihnen sagten, denunzierten jeden und machten es den Faschisten in Deutschland erst möglich, ihr TerrorRegime mit solcher Brutalität und ungeheurer Macht auszubauen.
Wir Antifaschisten unterschrieben eine Order, dass wir keinen Fluchtversuch unternehmen würden, daher konnten wir uns ungehindert bewegen. Unser Lagertor stand Tag und Nacht offen. Morgens zum SiebenUhrAppell mussten wir vollständig antreten. Wir arbeiteten freiwillig für die Engländer – das war unsere Solidarität im Kampf gegen die Faschisten.
Der Alltag hielt wieder Einzug, wir gingen unseren gewohnten Tätigkeiten bei den Arbeitseinsätzen nach. Schließlich stand Weihnachten vor der Tür. Die englischen Posten wollten gern Weihnachten feiern. Also boten wir Antifaschisten ihnen an, die deutschen Kriegsgefangenen zu bewachen – und sie gingen darauf ein. Die englischen Uniformen hatten wir ja schon, nun bekamen wir noch den Stahlhelm und das Gewehr. Bei den englischen Fronttruppen war so was möglich. Sie hatten die Bestialität der Nazis selbst gesehen und verstanden die Unterschiede zwischen den Nazis und uns Antifaschisten ganz genau. Bei ihnen zu Hause in England wurden diese Unterschiede wieder verwischt, und so konnte es auch da, nicht nur in den USA, geschehen, dass Faschistenschweine einzelne Andersdenkende, besonders Kommunisten, in den Gefangenlagern umbringen konnten. Nun, wie dem auch sei, an Weihnachten 1944 standen deutsche Antifaschisten in englischer Uniform, Stahlhelm und Gewehr auf dem Rücken auf Posten und bewachten die deutschen HitlerFaschisten. Das war wirklich einmalig!
Nach diesem netten Weihnachtsfest gingen wir wieder unseren gewohnten Alltäglichkeiten nach.
Im Frühjahr nahte der Tag, der im Leben eines jeden wackeren und aufrichtigen deutschen Faschisten den höchsten Feiertag darstellte: der Geburtstag des auch „Führer“ genannten Totengräbers, der 20. April. Die Nazis hatten an Stöckern, die sie wohl vom Arbeitseinsatz haben mitgehen lassen, „Fahnen“ befestigt, aus Lappen und Lumpen gemacht. Sie hatten das Hakenkreuz darauf befestigt oder, wo der Stoff fehlte, das Hakenkreuz herausgeschnitten. Am Morgen des 20. April veranstalteten sie tatsächlich einen Fahnenappell. Sie sonnte sich in ihrer Machtdemonstration und waren stolz, wie sie es mal wieder den bösen Vaterlandsverrätern und Bolschewisten gezeigt haben, wie sie über sie triumphiert haben!
Uns fiel auch was ein. Ein riesiger Scheiterhaufen wurde errichtet, in dessen Mitte drei Galgen standen. An den Galgen befestigten wir drei riesengroße Strohpuppen, über deren Körper wir längs in großen Buchstaben die Namen „Hitler“, „Himmler“ und „Göring“ angebracht hatten. Wir waren nahe an das NaziCamp herangerückt, so auf etwa 20 Meter Abstand. Das Geschimpfe und die Drohungen wurden immer lauter und schwollen natürlich zu einem infernalischen Geheul an, als wir den Scheiterhaufen bei Beginn der Abenddämmerung in Brand setzten. Wie die Bluthunde liefen die Nazis am Draht entlang, ohnmächtig vor Wut, dass sie uns im Angesicht solcher „Schmach“ nicht ans Leder konnten. Beim Schein des Scheiterhaufens stellten wir uns im Halbkreis darum herum und sangen die „Internationale“. Die italienischen Freunde und Genossen fielen mit Akkordeon ein und sangen das Lied auf italienisch. Es war ein herrlicher Tag!
Einige Tage später teilte uns der englische „Captain“ mit trauriger Mine mit, dass wir zurück müssten nach Oran – zu den „amerikanischen Freunden“. Das Lager wurde aufgelöst. In zwei oder drei Transporten, die Nazis in Viehwaggons, wir in Personenwagen, ging es Richtung Oran. Von nun an unterstanden wir wieder den „Amis“. Von der Bahn marschierten wir unter amerikanischer Obhut wieder in das Camp, das wir noch gut in Erinnerung hatten. Ab sofort gab es für Antifas keine Sonderbehandlung und keine Privilegien mehr, wir kamen mit den Faschisten wieder in ein Lager. So waren sie, die guten, demokratischen amerikanischen „Freunde“! Da wir mittlerweile aber mehr als 100 Mann waren, war es den Nazis nicht möglich, an einem von uns ihr Mütchen zu kühlen. Und die Italiener standen natürlich noch immer voll auf unserer Seite. Weil wir mit den faschistischen VollblutIdioten keine Konfrontation suchten diskutieren konntest Du mit denen in der Gruppe sowieso nicht, höchstens dann, wenn Du Dir mal einen allein greifen konntest und sie angesichts unserer Stärke zu feige waren, etwas zu unternehmen, blieb es zum Glück relativ ruhig im Lager.
Gefangenschaft in Amerika (19441946)
Anfang Mai 1944 hieß es dann, wir werden auf Schiffe verladen, es geht nach Amerika. Die Aufregung war natürlich groß, und ein riesiges Fragezeichen stand vor uns. Wie ist es in Amerika? Was erwartet uns dort? Und wie und vor allem wann kommen wir wieder zurück?
Zuerst ging es wieder auf Schusters Rappen hinunter zum Hafen. Schiffe, nichts als Schiffe! So viele hatte noch niemand von uns gesehen. Mindestens 80 oder gar 100 Schiffe! Ein paar Kriegsschiffe waren auch zu sehen. Wir wurden auf verschiedenen Schiffe verladen und kamen deshalb wieder auseinander! Ich landete mit einer Gruppe Antifaschisten von vielleicht 25 Mann zusammen mit mindestens 300 Nazis auf einem Schiff. Zum Glück hatten sie die Italiener auch so auf die Schiffe verteilt, auf diese Weise befanden sich auch rund 100 antifaschistische “Itaker“ bei uns an Bord.
Zuerst fuhren wir mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 12 14 Seemeilen, also knapp 20 Kilometer in der Stunde. Als wir den Atlantik erreichten, betrug die Geschwindigkeit höchstens noch 5 – 6 Seemeilen in der Stunde, erstens, weil wir fast den ganzen Tag über schweren Sturm hatten und zweitens, weil einige sehr alte und klapprige Schiffe dabei waren und sich alle nach dem langsamsten richten mussten.
Als wir durch die Straße von Gibraltar waren, durften wir das erste Mal an Deck. Bis dahin hatten wir in einem riesigen Lagerraum zusammengepfercht mit 450 Mann gehaust.
Die Flotte von jetzt mindestens 100 Schiffen wurde von einigen Zerstörern und UBootJägern begleitet. Wenn man sich von Deck aus umschaute, war der Anblick wirklich imponierend. Schiffe, so weit das Auge reichte. Schiffe, nur Schiffe!
Wir hatten Sturm und Orkanböen von Windstärke 10 und 11. Fast alle waren seekrank, ich hatte Glück und wurde verschont. Es ist schwierig, das alles zu schildern – 450 Mann in einem Lagerraum und 400 davon sind seekrank!
Nach mehr als drei Wochen AtlantikÜberquerung erreichten wir Norfolk in Virginia, USA. Vor rund 100 Jahren kamen Hunderttausende von Deutschen in die USA, weil sie hier die Freiheit suchten, die sie zu Hause nicht fanden. Nun kamen Deutsche in die USA als Gefangene, weil der größte Teil von ihnen einem verbrecherischem Regime die Treue gehalten hatte. Wie hatte sich das deutsche Volk doch zurückentwickelt und war so geistig verkrüppelt!
Wir wurden ausgeschifft, alle rein in die Hafengebäude. Die Klamotten, die wir anhatten, mussten wir abgeben und dann ging es zur Desinfektion und zum Impfen. Danach bekamen wir neue Sachen, Hosen, Jacken, Hemden und Mäntel, alles dunkelblau. Mit waschfester weißer Farbe war ein großes „P“ und ein großes „W“ draufgemalt: Prisoner of War.
Die „Amis“ taten immer wieder so, als wären wir Antifas ihnen am liebsten, versprachen dies und das, hielten davon aber nichts. Auch in punkto Entlassung wurden wir von den „Amis“ belogen. Wie wir später erfuhren, wurden vor uns offene Faschisten nach Deutschland entlassen, obwohl sie uns gegenüber immer wieder betont hatten, dass wir die ersten sein würden, die nach Deutschland zurückkehren sollten, von wegen Mithilfe beim Aufbau eines neuen, demokratische Deutschland. HaHa! Pustekuchen! Es waren zu viele „kommunistische Elemente“ unter uns Antifaschisten, eines davon war ich.
Sie hätten uns sicherlich für die gute Arbeit, die wir auch hier freiwillig leisteten, und bei dem geringen Lohn, den sie uns zahlten, noch länger da behalten. Aber auf Druck der demokratischen Öffentlichkeit und der Gewerkschaften wurden wir Antifaschisten trotz der Versuche der amerikanischen Reaktion, dies alles zu verhindern, im Frühjahr 1946 zurücktransferiert. Und eine Entschädigungszahlung für unsere „Dienste“ in den USA sollte es auch geben – ausgezahlt über die Behörden im besetzten Deutschland direkt an uns. Zuvor gab es noch „Staatsbürgerkunde“ Marke USA. Anfang 1946, es hieß, wir würden nun entlassen, kamen wir nach Fort Eustis bei Washington. Dort blieben wir ungefähr drei Monate. Die guten amerikanischen Demokraten versuchten hier, unser nach ihrer Meinung „ramponiertes“ Demokratieverständnis (ramponiert nicht durch den Faschismus, sondern durch den Widerstand gegen ihn!) wieder aufzupolieren, indem wir mehr von „Freedom and Democracy“ im AmiStil lernen sollten. Eine kleine Gehirnwäsche konnte da nichts schaden. Jeden Tag Lehrfilme über „Gods Own Country“, jeden Tag Politikunterricht über die Vorteile des kapitalistischen Demokratie, und alles bei der vornehmen Anrede: „Gentleman“.
Aber noch war es lange nicht so weit. Wir sind erst im Juni 1944. Es sollte also noch zwei Jahre bis zu unserer Rückführung dauern. Wir kamen nach Fort Devens. Es war kurz vor meinem 22. Geburtstag, als wir dort ankamen. Wir sollten ganze zwei Jahre hier hinter Stacheldraht und mit viel Arbeit verbringen. Während dieser Zeit starb Präsident Roosevelt, und die neue USAdministration unter Präsident Truman machte gleich der Welt klar, in welche Richtung es ging: sie ließ zwei Atombomben auf japanische Städte werfen!
Wir im Lager schafften es sehr bald dank der Emigrantenkreise des NewYorker Stadtteils Brooklyn eine eigene Lagerdruckerei zu betreiben. Wir konnten eine Lagerzeitung herausgeben! In Fort Devens gab es unter den Gefangenen natürlich viele politische Richtungen. Und natürlich auch gute und schlechte Typen. Es gab Kommunisten, Sozialisten und ausgemachte Sozialdemokraten, die man nicht zu den Sozialisten rechnen konnte. Außerdem gab es Katholiken, Protestanten, Zentrumsparteiler bis hin zu deutschnationalen Idioten, die noch voller Stolz die schwarzweißrote Kokarde an der Mütze trugen. Bei den ehemaligen Angehörigen der Strafdivision 999 waren auch viele kriminelle Elemente, die von den Nazis mit Absicht unter die „Politischen“ gesteckt wurden im KZ und im Strafbataillon. Jetzt im Lager enttarnten sie sich durch ihr kriminelles Gebaren. Der Lagerpfaffe, ein amerikanischer ArmeeGeistlicher und sein Kollege von der anderen Fakultät, also ein deutscher Militärpfaffe, fanden an diesen kriminellen Elementen natürlich großen Gefallen und machten sie zu ihren getreuen Mitstreitern. So kamen sie zu den besten Posten im Lager. Ohne jede politische Einstellung waren sie nur darauf aus, für sich das beste herauszuholen. Sie hatten schon die gleiche Ethik, wie sie heute in der ach so „freien“ BRD gilt.
So verging die Zeit mit politischer Aktivität, mit politischer Schulung und vor allem mit viel Arbeit. Nachdem ich lange in Kühlhäusern und beim SchiffeEntladen eingesetzt war und eine dadurch entstandene Verletzung auskuriert hatte, kam ich in eine Werkzeugschleiferei. Nebenbei bemerkt: Im Hafen und auch in den Fabriken war immer wieder zu erleben, dass selbst Faschisten, also die schlimmsten Konsorten, besser behandelt wurden als farbige USBürger!
Eines Tages hieß es: Ihr bekommt Neuzugänge. Alle waren wir voller Erwartung. Als es dann hieß, die Neuen seien auch alle Antifas, wuchs die Erregung und die Vorfreude. Sie kamen aus einem Lager im Süden der USA, dem absoluten Hort der Reaktion. Ihr bisheriger Aufenthaltsort war Fort Mead in Oklahoma. Die hatten dort so lange für ihre Anerkennung als Antifaschisten gekämpft, bis auch die reaktionären Südstaatlerkreise nicht mehr anders konnten, und ihnen eine besondere Abteilung in dem Gefangenenlager Fort Mead einrichten mussten. Sie erzählten uns dann die haarsträubendsten Dinge, die sich die alten NaziOffiziere gemeinsam mit den amerikanischen Offizieren dort erlaubten. So bastelten sich die deutschen Altnazis Holzgewehre und marschierten mit Gewehr über, an der Spitze die reaktionären amerikanischen OffiziersBanditen, unter dem Gegröle des HorstWesselLiedes und anderer Hetzparolen durch das Lager!
Die Antifas, die zu uns kamen, ungefähr 400 Mann, waren überwiegend ehemalige Mitglieder des Strafbataillons 999. Viele von ihnen hatten schon 1936/37/38 Seite an Seite mit internationalen Antifaschisten gegen die spanischen, die deutschen und die italienischen Faschisten in Spanien gekämpft. Es war ein großer Freudentag, als sie endlich kamen. Alte Freunde und Genossen sahen sich wieder.
Aber unter ihnen waren auch einige üble kriminelle Elemente. Diese Kriminellen hatten sich schnell das vertrauen der Amis erschlichen und bekamen – selbstverständlich mit Unterstützung der Pfaffen – die besten Arbeiten, auch außerhalb des Lagers, so z.B. beim „Ash and Trash“Kommando, also der Müllabfuhr. Alle mussten, wie zuvor auch bei den Engländern, feierlich unterschrieben, keinen Fluchtversuch zu unternehmen und für die Alliierten zu arbeiten. Durch die günstigen Arbeiten auch außerhalb des Lagers hatten diese Kriminellen natürlich schnell Kontakte zur Bevölkerung – und nutzen diese zur Flucht. Nach einiger Zeit wurden sie gefasst und zurück ins Lager gebracht. Wir Antifaschisten weigerten uns, sie wieder aufzunehmen und protestierten und legten die Arbeit nieder, bis die AmiMilitaristen diese Elemente in das NaziLager transferierten – nach langen Auseinandersetzungen und langem Palaver.
Ab Mai 1945, also nach Kriegsende, lebte buchstäblich das Vieh in den USA besser als die Insassen des AntiLagers in Fort Devens. Laut Beschluss des „War Departements“ und eines anderen hohen militärischen Amtes durften die „prisoners of war“, also die Kriegsgefangenen, als die wir ja noch immer galten, kein Fleisch, nur noch Innereien und Gedärm, keine Butter und kein Weißbrot erhalten. Die Rationen wurden allgemein verkleinert. (So lange Krieg war, gab es alles im Überfluss.) Wir wurden genauso wie die Nazis behandelt. Angeblich war das angeordnet worden als Repressalie für die ungeheuren Gräueltaten von deutschen Faschisten in ganz Europa, die die Amis jetzt „entdeckten“. Als aber die Genossen und Kameraden, die zum Teil Jahre in den Folterhöhlen der Nazis, den KZs, gesessen hatten, davon berichtet hatten, hatte man sie als „liar“ (Lügner), „son of a bitch“ (Hundesohn) oder „bull shit“ (Sch…haufen) beschimpft.
Ich persönlich hatte das Glück, in der Abteilung „Messe und Küche“ zu arbeiten, zwar mit einer Arbeitszeit von 60 bis 65 Stunden die Woche, aber dafür gab es ausreichend zu essen. Ich habe unglaubliche Verschwendung gesehen. Zum Beispiel wurden vom europäischen Kriegsschauplatz zurückkehrende GI’s, die noch eine weitere Reise bis zu ihrem Heimatort vor sich hatten, bei uns verpflegt. Waren dann dreihundert oder vierhundert gemeldet, kamen meist kaum die Hälfte. Aber für alle wurde eingedeckt und alles bereitgestellt, pro Person zwei gekochte Eier, 56 Scheiben Wurst, Käse, Butter und vieles mehr, mittags Roastbeef, sonstiges Fleisch, Speck, Bratwurst, Koteletts usw. Nach der Mahlzeit wurden die Reste in eine riesige Weißblechtonne geschüttet, auch die Unmengen der nicht angerührten Portionen, hunderte Eier, kiloweise Wurst, Käse, Fleisch, Butter und sonstige wertvolle Lebensmittel. Alles für die Schweinemast! Und nur wenige Kilometer entfernt saßen deutsche Antifaschisten, die unter Lebensgefahr Widerstand gegen den Hitlerfaschismus geleistet hatten und teils nach jahrelanger Kerker oder KZHaft den Häschern und Henkern des deutschen Faschismus entkommen waren, und schoben Kohldampf! Wie gesagt, die Schweine wurden besser ernährt als die Kameraden und Genossen im Lager!
Natürlich schmuggelten wir, indem wir das Futter der Mäntel auftrennten oder Lebensmittel zwischen Schuh und Innensohle der großen Regenschuhe versteckten, ins Lager, was wir konnten. Aber größere Mengen waren es nicht, da wir am Ende des Arbeitstages immer kontrolliert wurden und deshalb nichts in den Taschen transportieren konnten.
Und dann hieß es plötzlich wieder: „Es kommen Neuzugänge!“ Wir denken: „Prima, es haben sich wieder welche aus der NaziBarbarei befreit“, aber Pustekuchen. Unsere amerikanischen „Freunde“ überraschten uns mit etwas ganz besonders „Schönem“. Da im „land of the free“, im Land der Freien, ja alles möglich ist, hätte uns das eigentlich nicht überraschen dürfen: Eines schönen morgens, so Ende 1943, ergötzte uns herrlicher Gesang, ganz herzerfrischend ausgestoßen aus rauen Soldatenkehlen. Wir trauen unseren Augen nicht. Eine zackige deutsche Einheit marschiert in unser Lager ein – in voller deutscher Uniform und mit einigen OffiziersHeinis vorneweg. Bei uns sind natürlich alle sprachlos. Die älteren und erfahreneren Freunde und Genossen wussten natürlich sofort, was unsere lieben amerikanischen „Freunde“ damit bezweckten. Wir Jüngeren wollten uns diese Provokation nicht gefallen lassen und sofort Streit mit diesem Idiotenpack beginnen. Aber die Erfahreneren hielten uns zurück: „Kein Streit, keine Konfrontation mit diesem Faschistenpack. Die Amis, diese „guten Demokraten“, wollen ja nur, dass wir uns mit denen anlegen, damit sie uns als „trouble maker“, als Unruhestifter, hinstellen und dann auch disziplinieren können. Nach einiger Zeit wurden die Zustände auch außerhalb des Lagers publik – durch Emigrantenkreise und andere fortschrittliche Kräfte. Es gab politische Unterstützung für uns und schließlich mussten die amerikanische Militärbehörde die Idiotenbrut wieder abziehen.
Und das war noch immer nicht der letzte Streich, den wir abzuwehren hatten. Eine nette Überraschung hielten diese antikommunistischen „demokratischen Menschenfreunde“ der USAdministration noch für uns bereit. Jedenfalls wie sie dachten. Aber sie schnitten sich ins eigene Fleisch. Plötzlich hieß es zum dritten Mal: „Wir bekommen Zuwachs!“ Nanu, wer kommt denn da an? So um die 100 Gestalten in erdfarbenen Sowjetuniformen! Sie waren so genannte „Hiwis“, also „Hilfswillige“ bei der deutschen Wehrmacht. Sie waren in deutsche Gefangenschaft geraten und hatten erlebt, dass die deutschen Faschisten eine Wagenfuhre voll Gras bei ihnen im Lager abluden: „So, das ist Eure Verpflegung! Wenn Ihr für uns etwas tut, bekommt Ihr etwas Besseres.“ Den Hungertod vor Augen sind sie darauf eingegangen und „Hiwis“ geworden und sind nun beim Vormarsch der Amis gemeinsam mit deutschen Soldaten in amerikanische Gefangenschaft geraten.
Und nun dachten die amerikanischen „fighters for human rights“, die Kämpfer für das Menschenrecht – Menschenrecht ist ja im gesamten kapitalistischen Sprachgebrauch der am meisten verwendete Slogan, auch wenn er von Militärstiefeln in den Grund und Boden getreten und durch rücksichtslosen Sozialabbau und durch Entlassungen Lügen gestraft wird –, dass es jetzt bestimmt „Trouble“ geben würde und sie die Akten über uns und das Lager Fort Deven schließen könnten. Aber sie hatten sich geirrt. Trotz ihrer zeitweiligen erzwungenen Kollaboration betrachteten wir die sowjetischen Soldaten als Opfer des Faschismus und schlossen Freundschaft mit ihnen. Das passte unseren liebenswürdigen amerikanischen Herren und Volksbeglückern nicht. Nach kurzer Zeit wurden diese Kameraden wieder aus dem Lager entfernt.
Das blieb dann der letzte direkt/indirekte Versuch, uns zu diffamieren und uns den Status als Antifaschisten zu nehmen.
Danach wurden wir auf unterschiedliche Kompanien aufgeteilt. Ich war in der KKompanie. Unser Kompanieführer war ein politischer 999er, der Kommunist Peter Klingen aus Düsseldorf, vormals Häftling in Buchenwald. Es war ein prima Genosse. Als überzeugter Kommunist stand er jedermann mit Rat und Tat zur Seite. Wenn es Schwierigkeiten gab, der „Klingens Pitter“ wusste eine Lösung. Neben ihm erinnere ich mich noch an viele Namen erstklassiger Genossen aus der damaligen Zeit, die uns Jüngeren sehr viel von ihrem Wissen und von ihren Erfahrungen aus dem Kampf gegen die Nazis, von ihren Erfahrungen aus den Konzentrationslagern und über die ganze Brutalität und Unmenschlichkeit des Faschismus und des Kapitalismus vermittelten. Durch diese hervorragenden Genossen wurden viele von uns, vor allem wir Jüngeren, erst zu wirklich bewussten Antifaschisten, auch wenn wir das braune Regime schon vorher entschieden abgelehnt hatten. Jetzt lernten wir die Zusammenhänge besser verstehen. Die uns so schulten waren die Genossen Werner Knauthe aus Dresden, er war in der DDR später Parteisekretär in Sachsen, Bodo Gerstenberg aus Berlin, H. R. Greulich aus Brandenburg, Oskar Holewa aus Mecklenburg und auch Oskar Wintergerst. Er war Regieassistent bei dem faschistischen Regisseur Veith Harlan gewesen, der ihn wahrscheinlich ins KZ brachte. Jedenfalls äußerte dieser Harlan ihm gegenüber: „Junger Mann, es wird Zeit, dass Sie mal gesiebte Luft atmen, bei Ihren Reden!“
Die Tage, die vorher mit Arbeit an den Wochentagen und mit Sport und Freizeit am Wochenende verbracht wurden, bekamen nun eine neue, wichtige Beschäftigung:
das Lernen.
Die Zeit verging und es wurde Frühjahr 1946.
Zurück in Europa (1946)
Wir sollten nach Europa zurückgeführt werden. Endlich war es so weit! Etwas besseres gab es nicht, denn jeder wollte nach Hause. Wir konnten die Zeit kaum abwarten bis zur Einschiffung.
Und wir hatten Glück, die Überfahrt über den Atlantik dauerte diesmal nur neun Tage.
Auch wenn die Zeit auf dem Schiff lang war, wir landeten viel früher als wir dachten an der französischen Kanalküste in Le Havre.
Vom Schiff ging es mit der Bahn ins 30 Kilometer entfernte Bolbec. „Alles aussteigen!“, dann Fußmarsch mit Gepäck ins ungefähr 3 Kilometer entfernte „Lager Bolbec“.
Als wir ins Lager einrückten, gab es die größte Überraschung. Was hatten sich unsere netten, demokratischen amerikanischen „Freunde“ jetzt wieder ausgedacht. Wir waren nicht vorbereitet auf die Schweinerei, die uns jetzt die amerikanischen „Freunde“ und ihre Kumpane, die französischen Militaristen, hier boten: Fast ein Jahr nach der Zerschlagung des deutschen Faschismus durch die Rote Armee wurden wir im Lager Bolbec von der deutschen Lagerleitung empfangen – in voller NaziUniform mit Orden und Ehrenzeichen. Sie waren in dem festen Wahn, wir marschierten jetzt gemeinsam mit den „Westmächten“ gegen die Sowjetunion! Wie konnten wir aber auch so naiv sein, nicht vorbereitet zu sein auf solche Schmutzigkeiten der „Amis“! Auch wenn inzwischen Mai 1946 war!
Wir kamen mit diesen Verbrechern in ein Lager. Was wir in den USA peinlich vermieden hatten, das passierte dann doch noch in Bolbec: Wir prügelten uns mit diesem braunen deutschen Gesindel. Sie fielen über unser Gepäck her, forderten ihren „Anteil“, ohne dass wir wussten, an was. Nach einigen Tagen wurde klar, was hier gespielt wurde. Die NaziProvokateure waren keine Kriegsgefangenen mehr, sondern inzwischen wohl die „Fremdenlegion“, die „Légion d`étragères“ und abkommandiert, uns in Werbermanier in Empfang zu nehmen. Auf diese Weise dachten die Verfechter von „freedom and democracy“ gemeinsam mit ihren französischen Helfershelfern, uns doch noch davon abzuhalten, am demokratischen und antifaschistischen Aufbau eines neuen, anderen Nachkriegsdeutschlands mitzuwirken.
Wir erfuhren, dass schon mehrere Transporte durch dieses Lager gegangen waren und dass es den braunen Banditen gemeinsam mit den französischen Militaristen schon oft gelungen war, Leute für die Fremdenlegion anzuwerben.
Bei uns Antifaschisten holten sie sich nur blutige Köpfe.
Als die amerikanischen und französischen Betrüger merkten, dass bei uns nichts zu machen war und das Ganze anfing, für sie bedrohlich zu werden, weil es schon mehrere Schlägereien gegeben hatte, verluden sie uns nach ein paar Tagen auf die Bahn. Wir wurden nach Deutschland verfrachtet, Bestimmungsort: Marburg an der Lahn.
Nach drei Tagen kamen wir dort an. Ein Zug fuhr Richtung Thüringen, ein zweiter nach Munsterlager in Westfalen. Dorthin sollte auch ich. Wir sollten dort angeblich „Zivilklamotten“ und die endgültigen Entlassungspapiere bekommen. Darauf verzichtete ich. Wer wusste denn, was die „Freunde“ in Munsterlager noch für Überraschungen bereit hielten!? Entlassungspapiere hatten wir schon, als wir die USA verließen.
Wieder in Köln (1946/47)
Unterwegs stieg ich aus und ging zu Fuß nach Haus. Fast drei Jahre nach meinem damaligen Urlaubsaufenthalt kam ich wieder in Köln an.
Als ich meine Eltern wiedertraf, erfuhr ich so einiges über ihre Erlebnisse. Ich will hier nur eins schildern, weil es so typisch für die beiden ist.
Gegen Ende des Krieges waren meine Eltern, meine Schwester und ihr kleiner Sohn nach Hohenstein evakuiert, wegen der Bombenangriffe auf Köln. Hohenstein ist in der Sächsischen Schweiz. Mein Schwager war auch so einer. Der hat sich geschworen: ich werde nie Soldat, und der war auch nie Soldat gewesen. Der hat gelebt in Hohenstein in Sachsen, war aber angemeldet hier in Mauenheim. Den haben sie nicht gefunden. Stellungsbefehl lag hier in Mauenheim im Briefkasten. Der kommt nach Haus, guckt in den Briefkasten, setzt sich in den nächsten Zug und fährt wieder nach Hohenstein. Den haben sie nie gekriegt.
Dann haben die Engländer irgendwann in der Gegend von Hohnstein Flugblätter abgeworfen, dabei Lebensmittelkarten und 100MarkScheine. Die hat meine Mutter eingesammelt, schön gebügelt, und dann sind meine Eltern nach Pirna gefahren – einkaufen. Kaum standen die vor einem Geschäft, wurden sie schon von zwei Männern angesprochen:
„Geheime Staatspolizei. Was haben sie gerade gekauft? Woher sind die Lebensmittelkarten? Mitkommen!“
Der eine der beiden Verbrecher sagte gleich: „Was sollen wir mit dem Volk. Sollen wir die noch mitnehmen? Direkt, komm, gleich aufhängen, zack! Das sind Volksschädlinge, das sieht man doch.“
Der andere sagte dann: „Nee, das muss ordnungsgemäß untersucht werden, was da los ist.“
Zum Glück haben die dann meine Eltern erstmal auf die Polizeiwache gebracht und da eine kurze Zeit allein gelassen. Da hat mein Vater die Lebensmittelkarten zerrissen, in den Mund gestopft und aufgegessen, Kügelchen gemacht, in die Pfeife gestopft und geraucht.
Der Polizist fragte meinen Vater: „Mensch, was rauchen Sie da für ein fürchterliches Kraut?“
Und mein Vater frech: „Soll ich Ihnen auch eine Pfeife stopfen?“
Der sagte: „Nein, ich danke sehr.“
So waren dann keine illegalen Lebensmittelkarten mehr da. Dann haben die noch eine Hausdurchsuchung gemacht, aber auch da war nichts zu finden. So konnten sie nichts machen, sie mussten meine Eltern laufen lassen.
Und dann wurde mein Vater zum Volkssturm eingezogen und musste sowjetische Kriegsgefangene bewachen. Und dann hat er immer geguckt, ob die Luft rein war und hat ihnen gesagt: „Da hinten ist eine Kartoffelmiete. Ich passe auf, geht Euch holen, was Ihr braucht.“
Heute mag man darüber lachen, aber damals war es todernst, wirklich todernst. Meine Alten standen immer mit einem Fuß im KZ oder unter’m Strick, also im Grab. Und ich selber auch. Ich bin nicht fromm, aber wir hatten einen Schutzengel. Es ist wirklich wahr.
Und als dann endlich die Rote Armee ankam, da ist mein Schwager auf die Burg von Hohenstein hoch und hat die weiße Fahne gehisst. Und meine Mutter, das Kind meiner Schwester auf dem Arm, hat sich auf den Marktplatz gestellt und die Rote Armee empfangen. Davon erzählte sie mir:
„Dann kam ein Offizier: `Ach, Babuschka´, nahm das Kind auf den Arm, dann musste ich mit ihm eine Zigarre rauchen, und dann habe ich ihm verklickert: Mein Mann kann jetzt einen Trupp Soldaten mitnehmen und dann holen wir die Nazis aus den Verstecken.“
Und dann gingen die, haben den Ortgruppenleiter hochgenommen, ein anderer hatte sich schon selber umgebracht, einer war von der Burg gesprungen, aber es gab noch genug Nazis, die verhaftet wurden.
Aber jetzt wieder Köln 1947: Die Lage war schwer. Einige Zeit verging. Man musste erstmal wieder ankommen, wieder in die Gesellschaft hineinkommen, das Überleben sichern, Geld verdienen.
Natürlich wollte ich die „Entschädigungszahlung“, die uns in den USA in Aussicht gestellt wurde, jetzt haben. Ich versuchte zu erfahren, was aus den schwer erarbeiteten und guten Dollars geworden war.
Also setzte ich mich hin und schrieb an den christlichen Konrad Adenauer. Aber der gutchristliche, humanistische und pazifistische spätere Kanzler Adenauer ließ mir antworten, dass kein Geld aus Amerika für mich vorhanden sei.
Ich schrieb ihm daraufhin, welche negative Meinung ich von ihm und seiner Clique habe, bezeichnete ihn als Militarist und Kriegstreiber. Weiter schrieb ich ihm, dass mit dem Geld, das ich mit schwerer Arbeit in den USA verdient hatte, einer Arbeit, die mit dazu beitrug, den Sieg der Alliierten über die braune Barbarei zu ermöglichen, nun wohl eine neue deutsche Wehrmacht aufgebaut und alten NaziOffizieren wieder die deutsche Jugend ausgeliefert würde. Ich wusste mich zu wehren, denn ich war durch die Schule der „democracy“ gegangen und hatte so allerlei nützliche Dinge gelernt.
Die Antwort war dann nicht anders, als ich sie erwartet hatte: Deutschland sei natürlich nur noch dem Frieden verpflichtet, von Deutschland gehe natürlich keine Kriegsgefahr mehr aus, im übrigen sei ich voreingenommen und falsch informiert.
Was sollte ich nun machen?
Ganz einfach, ich schrieb ans „War Departement“ Washington, DC. Mittlerweile war es schon Sommer 1947. Die Antwort aus Washington ließ sehr lange auf sich warten. Endlich kam die Bestätigung, dass die AdenauerAdministration das Geld auf Antrag der USMilitärbehörden aus der Schweiz erhalten hätte. Danach wieder Hin und Hergeschreibsel mit der AdenauerClique. Erst wieder Verneinung, dann Eingestehen, ja, es wäre Geld eingegangen und in Bälde sei mit der Auszahlung zu rechnen. Dann plötzlich, ein oder zwei Wochen vor der Währungsreform, stand der Geldbriefträger vor der Tür und überreicht mir gegen Quittung 1.000 alte Reichsmark. Wertloses Zeug! Und das für 9.000 harte Dollar! Hiermit sei alles abgegolten und es gebe keinen Einspruch mehr.
Anfang der 50er Jahre – Ich soll mithelfen beim Aufbau der Bundeswehr
Wieder verging einige Zeit, inzwischen waren wir in den 50er Jahren, also am Anfang der 50er Jahre.
Plötzlich bekomme ich ein Schreiben des Bundesverteidigungsministers wir waren nun „Bundesrepublik“ und schickten uns an, die „wahren“ Nachfolger des faschistischen Großdeutschlands zu werden. Franz Josef Strauß hieß dieser „liebe“ Mensch, der mir da schrieb. In seinem Auftrag und mit seiner Unterschrift erhielt ich ein Schreiben, ich hätte mich dann und dann „unverzüglich“ beim BundeswehrErsatzamt zwecks „Registrierung“ zu melden! Ich solle im „Johannishaus“ mit allerlei Unterlagen und auch einem Passbild erscheinen.
Zuerst schmiss ich das Schreiben in den Ofen. Das durfte doch nicht wahr sein! Nach einiger Zeit wurde mir ein gleiches per Einschreiben geschickt. Jetzt musste ich etwas unternehmen, denn sie belästigten mich ja weiter mit diesem Unrat! Somit war ich gezwungen, etwas gegen diese militärischen Unmenschen zu tun. Ich schrieb der lieben bayrischen Wildsau namens Franz Josef Strauß einen netten und liebenswürdigen Brief. Der war noch etwas ausführlicher als der vor ein paar Jahren an Herrn Adenauer. Adresse: An den Kriegsminister Franz Josef Strauß. Der Schluss des Briefes gipfelte dann etwa in folgendem: Ich würde ihm einen Radiergummi schicken zum Ausradieren der Sowjetunion und der „Roten Ratten“, wie er beliebte sich auszudrücken. Ansonsten gelte: „Für diesen Staat keinen Mann und keine Mark.“ Und als Schluss: „Ansonsten verbitte ich mir, von Leuten Ihres Schlages weiter belästigt zu werden!“
Aber diese schwarzbraune Haselnuss gab keine Ruhe. Ich bekam ein ganzes Paket vaterlandstreuer Broschüren und Flugblätter zugesandt, die mich fast zu Tränen gerührt haben. Nun wusste ich doch endlich, wo der Feind stand. Nicht in Washington oder Bonn, wie ich immer geglaubt hatte, nein, er stand in Moskau! Wie man sich doch irren kann!? Welch ein Glück für ein Volk, das einen solch weit blickenden Kriegs Entschuldigung „Verteidigungs“Minister hat! Das ließ ich dann auch den so genannten „Verteidigungsminister“ wissen. Außerdem tat ich ihm noch kund, was für ein störrischer Esel ich doch sein müsste, dass ich mich solch hehrem Gedankengut verschließen würde und noch ein paar ironische Bemerkungen und Liebenswürdigkeiten mehr. Außerdem hätte ich ihn ja in meinem Unverständnis als „Kriegsminister“ und „Militaristen“ bezeichnet, das täte mir ja soooo leid, nachdem ich die schönen Sachen nun alle gelesen hätte.
Na ja, das muss ihm dann doch in den „falschen Hals“ gekommen sein. Er drohte mir jetzt in seinem nächsten Scheiben mit einer Geldstrafe bis zu 10.000, DM oder Haftstrafe und Zwangsvorführung. Was sollte ich nun tun? Abholen lassen, wahrscheinlich zum Gaudi der antikommunistischen Nachbarschaft, die dann darüber feixen konnten, dass die Kommunisten schon wieder abgeholt würden, da ich ja aus meiner Gesinnung keinen Hehl machte?
Also ging ich mit leeren Händen zum Ersatzamt. Nichts wie rein in den Vorraum. Was soll ich sagen, da sitzen an die 10 Mann und mehr und warten auf die Abfertigung.
„Wir werden aufgerufen!“, sagten sie mir. „Und dann in diesem Raum“, sie zeigten auf eine Tür, „registriert.“
Ich sage nur: „Was seid Ihr doch Schwachköpfe und Idioten! Habt die Nase noch immer nicht voll! Lasst Euch schon wieder wie preisgekrönte Ochsen registrieren, nummerieren, militarisieren. Jetzt könnt Ihr mal sehen, wie schnell das bei mir geht.“
Ich sofort auf die Tür los, rein wie ein Donnerwetter, meine ganze Wut legte ich hinein – und natürlich ohne anzuklopfen. Ein lautes und zorniges Rufen: „Kein Eintritt ohne Aufforderung! Draußen warten!“
„Männchen, halt nur die Schnauze! Bilde Dir nur nicht ein, das wäre hier schon der Kasernenhof!“
Darauf natürlich betretenes Schweigen, sprachloses Anstarren – im übrigen auch der Idioten, die brav auf ihre Abfertigung warteten. Dann kam vom Schreibtisch die zaghafte Frage: „Wie ist Ihr Name?“
Ich sage meinen Namen, die Überraschung ist perfekt: „Sind sie der Herr Kever, der an unseren Verteidigungsminister geschrieben hat?“
„Ganz genau der bin ich.“
„Oh je, wie konnten Sie das denn tun? Kommen Sie doch bitte mal mit.“
Da geht es eine Etage höher zum Chef des ganzen Vereins. Zuerst dieselbe Frage:
„Wie konnten Sie denn so an den Herrn Verteidigungsminister schreiben?“
„Da staunen Sie wohl! Und wenn Sie nicht ganz schnell machen, werden Sie erleben, dass ich noch was ganz anderes kann! Rechnen Sie mich nicht zu diesen Trotteln da unten!
Der Chef darauf: „Regen Sie sich nicht auf, wir werden das alles schnell hinter uns haben. Ich hoffe, dass Sie alle Unterlagen, die wir benötigen, mitgebracht haben, dann ist alles in ein paar Minuten erledigt.“
Oh, diese Schmierfinken, wie sie jetzt schon krochen und dienerten! Nun wusste ich, wo ich dran war, wie ich sie einschätzen musste. Das sollte ein Fressen werden! Ich sagte:
„Mein lieber Mann, bevor wir hier mit dem Kukulores anfangen, möchte ich erstmal Ihren Namen wissen.“
„Was wollen Sie denn mit meinem Namen?“
„Den werde ich mir gut merken, und dann kommen Sie auf unsere Schwarze Liste.“
„Wieso Liste? Welche Liste?“
„Da kommen alle die hinein, die sich schon wieder zum Werkzeug der Kriegstreiber und der Faschisten machen lassen. Später, nach dem Umschwung, haben Sie dann wieder von nichts gewusst und beteuern wie üblich Ihre Unschuld.“
Der Kerl wird weiß wie eine Leinwand.
„Nein, meinen Namen sage ich Ihnen nicht!“
Wie musste ich lachen über diese feige Kreatur. War doch nichts einfacher, als den Namen zu erfahren.
„Also, wo sind die Unterlagen“, geht das Spielchen wieder los.
„Wie ist der Name? Ohne Namen keine Unterlagen.“
„Haben Sie denn wenigstens ein Bild dabei?“
„Mann, Sie spinnen doch, genügt Ihnen das Bild Ihrer Frau oder Freundin nicht? Wenn Sie mir Geld geben, lasse ich mir zu Ihrer Freude sogar ein Bild machen.“
„Also kein Bild, keine Unterlagen, nichts?“
„Also kein Name, nichts?“
Es machte mir richtig Freude, mit einem solch netten Kollegen zu plaudern.
„Was soll ich denn da schreiben?“
„Schreiben Sie doch, was Sie Lust haben!“
„Da kann ich ja nur schreiben, Herr Leo Kever macht keine Angaben.“
„Sehr richtig. Kein Name, keine Angaben.“
Meine Unterschrift unter dieses tolle Dokument verweigerte ich dann auch noch. Was mag dieser armselige Trottel wohl alles zu hören bekommen haben? Er hat mich dann mit aller Freundlichkeit entlassen. Am liebsten hätte er mich noch gebeten, ihn von der Liste zu streichen. Ich ging voll befriedigt wieder runter, wo die Hohlköpfe noch immer auf ihre Abfertigung warteten.
Sie wollten uns vom Jahrgang 1922 werben für den Wiederaufbau des deutschen Militärs, jetzt unter dem Namen „Bundeswehr“.
Nach diesem Intermezzo mit Franz Josef Strauß und seinen Knechten hörte ich dann nichts mehr von diesen militaristischen Volksbetrügern.
Das waren die Erfahrungen, die ich als Kind, als Jugendlicher und als junger Erwachsener mit der bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaftsordnung gemacht habe.
Leo Kever, Köln
Anhang |
Delegation nach „Wolgograd“ (Stalingrad) mit dem deutschen
Friedensbildungswerk als Gesandter der „Partnerstadt“ Köln
Wir fliegen nach Wolgograd, Delegation von Köln, 13 Personen, in die Partnerstadt von Köln. Das war 1988, da war ja der Gorbatschow, dieser Verräter, der aufgehende Stern. Wir sind erst nach Moskau geflogen und dann von Moskau runter nach Stalingrad, dem heutigen Wolgograd. Nebenbei: das Friedensbildungswerk kannst Du in der Pfeife rauchen. Das ist durch und durch bürgerlich, ja gut, pazifistisch, eben bürgerlichpazifistisch. Aber da brauchen wir ja nicht weiter drüber zu reden.
Also, wir wurden eingeladen zur stellvertretenden Bürgermeisterin. Der Harald war der so genannte „Leiter“ der Delegation, aber der Harald kam immer auf mich zu: „Leo, komm hilf mir, Du musst da mitsprechen.“
„Gut“, sage ich, „Harald, ich helfe Dir.“
„Aber dass Du da auch die Ansprache hältst!“
„Ja, Harald, ist in Ordnung, wir machen das schon.“
Wir waren ja insgesamt 13 Personen, aber wer ging mit zum Bürgermeister? Höchstens fünf Mann, die anderen hatten keine Lust, wollten in die Markthalle oder dies und das gucken, also gingen der Harald, der Hans K., genannt Ömmes, ich und noch zwei Mann. Und ich sollte sprechen. Da sage ich dann, dass wir aus Köln kommen, der neuen Partnerstadt.
„Und wir sollen vom Oberbürgermeister schöne Grüße bestellen, dass so was nie wieder passiert, dass nie wieder passiert, dass der deutsche Imperialismus die Sowjetunion überfällt“.
Und dann hatte ich in Köln lauter Unterschriften gesammelt: Ich habe immer gesagt: „Ich fahre in die Partnerstadt Wolgograd. Und wir wollen da Freundschaft schließen. Gib mir mal Deine Unterschrift, dass die Leute in Wolgograd sehen, dass ich nicht allein bin, sondern dass die Bevölkerung hier auch dafür ist.“ „Oh, ja, natürlich, machen wir.“
Da waren die alle direkt begeistert hier.
Sage ich da also in Wolgograd:
„So, Frau Bürgermeisterin, hier sind die Unterschriften, die habe ich selber noch persönlich gesammelt, damit sie sehen, dass auch die Bevölkerung bei uns so ist, für Völkerfreundschaft, nicht nur ich alleine.“ Dann haben wir Tee getrunken und einen Imbiss genommen, war alles ganz nett.
Dann bin ich zum Parteibüro in Wolgograd gegangen, habe Grüße von der DKP überbracht. Da haben die sich gefreut. Aber das musste ich schon ganz allein machen, da ist gar keiner aus der Delegation mehr mitgekommen.
Dann waren wir vom Friedensbildungswerk Wolgograd eingeladen. Groß geschmückt und alles. Und habe dort dann als alter Russlandveteran gesprochen:
„Ich habe damals leider auf der falschen Seite gestanden, aber ich konnte nicht anders.“ Und habe dann auch von meiner Selbstverwundung und späteren Desertation erzählt. Da haben die mich dann da hochleben lassen.
Und dann kam ein Interview, erst waren die anderen dran, dann riefen sie mich. Ich sagte:
„Stellt erstmal das Mikrophone ab, ich muss Euch vorweg mal was sagen. Wir sind hier zur gleichen Zeit wie unser dicker Bundeskanzler.“ (Das war 1988, Kohl war bei Gorbatschow in Moskau.) „Genau jetzt ist dieser Sack in Moskau und macht da schön Wetter, obwohl er in unserer Republik die Faschisten schützt und honoriert. Aber bei Euch hier will er sich als Demokrat und Antifaschist aufspielen. Und er bringt eine Tasche voll Geld mit, voll DM, und kauft das schmutzige Gesindel von Wolgadeutschen frei, die sich damals im Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjetunion gestellt haben. Jetzt holt er gegen Geld dieses Gesocks zurück – nur weil er es als Wahlvolk für die CDU braucht.“
Da gab es natürlich ein bisschen Unruhe, aber schließlich sollte es auch ein Fernsehinterview geben. Da habe ich im Fernsehen dann gesagt, dass wir so was wie im Zweiten Weltkrieg nie wieder zulassen dürfen, dass die Sowjetunion und Deutschland am besten eine Einheit wären und dass wir das am besten schon viel früher hätten machen sollen, in den 20er Jahren. Dann wäre der Zweite Weltkrieg verhindert worden. Der Dolmetscher war einer von der GorbatschowClique, der wurde immer nervöser und sagte dann plötzlich: „Das Interview ist beendet.“
Und dann waren wir noch drei Tage in Moskau. Und dort wurden wir eingeladen auf einen Philosophenkongress in Moskau. Was soll ich sagen, wir waren ja 13 Personen, aber wer ist hingegangen? Vier Mann! Wozu die anderen überhaupt hingefahren sind, das weiß ich nicht. So ein reaktionäres Mistvolk. Nur Driss! Die gingen dann lieber in die Ausstellung der abstrakten Kunst.
Wir vier gingen also zum Philosophenkongress. Ich muss noch eine kleine Anekdote schildern. Als wir auf dem Weg sind, rutscht einer aus – es war Winter, also Schnee. Als wir ihm aufhelfen, finden wir eine Geldbörse, rund 120 Rubel drin und ein Bild von einem Mann, sonst aber nichts, keine Adresse oder so. Wir geben die Geldbörse beim Hotel an der Rezeption ab. Fragen die uns da:
„Und wenn wir den Besitzer nicht finden, was sollen wir dann mit dem Geld machen?“
„Dann stiften Sie das dem Friedensbildungswerk.“
„Wieso Friedensbildungswerk?“
„Na ja, Eurem Friedensbildungswerk stiften wir das dann.“
„Ja, das hat hier ja noch nie ein Deutscher gesagt.“
„Dann sind wir eben die ersten! Wir wollen das Geld nicht.“
„Ja, das ist ja gut.“ Und so weiter.
Schließlich waren wir dann auf dem Philosophenkongress.
Da sind wieder nur der Ömmes, also der Hans K., der Harald, ich, noch einer und eine Reporterin von Radio Köln mitgekommen.
Da fingen dann nun die so genannten Philosophen an zu reden. Alles GorbatschowLeute! Und dann sage ich:
„Ich will mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Leo Kever, ich bin Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei – aber ich bin kein Anhänger von Gorbatschow.“
„Ja, was denn?“
Da habe ich geantwortet: „Mit Gorbatschow hätte die Sowjetunion den Krieg gegen NaziDeutschland verloren. Der Sieg war nur durch Stalin möglich.“
Da sind die hochgegangen.
Und Ömmes quatschte mich immer von der Seite an: „Mensch, halt’ Deine Schnauze mit Stalin hier, nachher lassen die uns nicht mehr raus!“
Ich sage:„Das wagen die Lumpen nicht!“
Schließlich hat der Ömmes dann auch gesagt: „Jawohl, ich schließe mich ihm an: Mit Gorbatschow wäre der Krieg verloren gegangen.“
Und ich dann noch: „Die Faschisten wären bis zum Ural durchmarschiert bei Eurem Gorbatschow. Der Sieg war nur durch die Politik Stalins möglich.“
Und die so genannten Philosophen dann:
„Was, Stalin!? Der Verbrecher!“
Und wir: „Nein, Stalin war kein Verbrecher. Aber Gorbatschow ist ein Verräter!“
Da war dann richtig Stimmung. Und sie waren sehr bemüht, unseren Auftritt dann bald zu beenden.
Es war zum Kotzen, wenn ich das mal so sagen darf, und es ist noch immer zum Kotzen.
Austritt aus der DKP
1992 bin ich aus der DKP ausgetreten. Da habe ich gesagt: „Mit Euch Revisionisten will ich nichts mehr zu tun haben. Feierabend.“ Das war in Köln ja besonders schlimm. Im Ruhrgebiet, da gibt es ja noch gute Zellen, aber hier in Köln, das war ein Sumpf und ein Dreck! Der Kreisvorsitzende, der Hennes, der freute sich, dass die DKP pluralistisch wurde, das ist doch schön so als Kreisvorsitzender. Der Humbach, der Bezirksvorsitzende, ist aus der DKP ausgetreten, weil die DKP ihm nicht klar genug auf dem Kurs von Gorbatschow und Jelzin war. Es war einfach ein herrlicher Sumpf in Köln hier. Da will ich nichts mehr mit zu tun haben.
Diese Revisionisten verleumden Stalin und nennen ihn einen Verbrecher und Mörder. Diese dummen Antistalinisten begreifen nicht, dass der Antistalinismus die stärkste Waffe in der Hand des Klassenfeindes ist. Mit der Antistalinismuskeule hat der Imperialismus/das Kapital es geschafft, die fortschrittliche, revolutionäre Bewegung zu zerstören. Was hat der „böse“ Stalin getan? Er hat es gewagt, das Privateigentum an den Produktionsmitteln in Staats und Volkseigentum umzuwandeln und damit den ehemaligen Besitzern, diesen Volksschädlingen, die Möglichkeit genommen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen weiter zu betreiben und weiter Eroberungs und Aggressionskriege zu führen. Das wird das Großkapital und die Finanzoligarchie dem Genossen Stalin nie verzeihen!
Und diese revisionistischen, antistalinistischen Schwachköpfe unterstützen unsere Klassenfeinde noch! Da kann man nur sagen: Wer gegen Stalin ist, der ist auch gegen Lenin. (Denn Lenin hätte in dieser Lage oder Situation, in der Stalin sich befand, von der Konterrevolution im Innern und von äußeren Feinden bedroht, nicht anders gehandelt.) Die Sowjetunion stand auf dem Spiel!
Aber dazu mehr in den Sonderheften der Genossen Ulrich Huar und Kurt Gossweiler.
Rundfunkinterview mit Radio Köln,
12.11.1992
Thema: „Deserteure im II. Weltkrieg“
Leo Kever: Zunächst möchte ich eine Erklärung abgeben. Es ist eine Schande für unser Land, 47 Jahre nach dem Ende des Faschismus ziehen wieder rechte Terrorbanden brandschatzend und plündernd und mordend durch unser Land. Bei diesem Tatbestand ist es eine Provokation, wenn Leute wie Kohl und seine Mannen sich in eine Demonstration gegen Faschismus und Ausländerhass einreihen. Sie, die durch ihrer Politik diesen Nazihorden den Boden bereiten! Sie stürzen doch die Menschen vor allem im Gebiet der früheren DDR – in völlige Hoffnungs und Perspektivlosigkeit durch ihr Lügen und großmäuligen Versprechungen. Kohl war es doch, der sich in Bitburg vor den Größen der SSMörder verneigte – mit seinem Freund aus Übersee, um seinen Frieden mit dem Faschismus zu machen.
Radio Köln: Das gehört jetzt aber nicht hierher!
Leo Kever: Und ob das hierher gehört! Die braunen Unmenschen waren doch gerade die Ursache, dass Menschen wie ich desertieren mussten. Die heute Herrschenden biedern sich diesen Verbrechern schon wieder an, so dass die Gefahr besteht, dass sich so etwas wiederholt. Deshalb müssen die Ursachen erforscht werden.
Nun möchte ich weiter ausführen. Kohl war es doch, der von seinem „Freund“ Michail Gorbatschow, den er kurz vorher noch mit Göbbels verglichen hatte (übrigens hat er diese Beleidigung bis heute nicht zurückgenommen), bei seinem Besuch in Moskau 1988 eine lange Liste mit Namen von braunen und schwarzen Massenmördern und Kriegsverbrechern erhalten hat, die alle noch in der BRD ihre unberechtigten Renten und Pensionen verzehren. Wie war nun Kohls Reaktion? Wurde nun jemand verhaftet und vor Gericht gestellt? Nein! Absolut Nein! Kohl und seine Regierung waren es doch, die dem Kriegstreiber Bush 18 Milliarden DM, noch zwei mehr, als der haben wollte, ins Maul stopften.
Radio Köln: So lange können Sie aber nicht reden. So viel Zeit haben wir nicht.
Leo Kever: Soll nun ein Interview stattfinden oder nicht? Wenn Ihr keine Zeit habt, hören wir auf und gehen nach Haus.
Radio Köln: Aber bitte jetzt etwas kurz fassen!
Leo Kever: Gut, in zwei Minuten bin ich zu Ende. Ich möchte nur jedem sagen: traut diesen Politikern nicht, nehmt den Kampf gegen die braune Pest in die eigenen Hände. Diese Politiker sind nicht fähig und vor allem nicht willens, etwas dagegen zu tun. Es darf nie wieder geschehen, dass Menschen aus diesem Grunde flüchten müssen, wegen ihrer politischen Einstellung oder ihrer nichtarischen „Rasse“ oder unter Lebensgefahr wieder desertieren müssen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass das neue Deutschland nicht wieder das alte, braune wird.
Radio Köln: Nun müssen wir aber zum eigentlichen Interview kommen! Es gibt sicherlich verschiedene Gründe zur Desertation. Wie waren Ihre Gründe?
Leo Kever: Dazu möchte ich folgendes sagen: Ich komme aus einer antifaschistischen Familie. Eltern, Geschwister, verschiedene Onkels und Tanten waren NaziGegner und mussten jederzeit mit Verhaftung rechnen. In einem solchen Kreis aufgewachsen war für mich klar: für dieses System keine Unterstützung und bei erstbester Gelegenheit desertieren.
Radio Köln: Also war es eine politische Desertation?
Leo Kever: Einzig und allein eine politische!
Radio Köln: Haben Sie keine Angst, sich öffentlich dazu zu bekennen?
Leo Kever: Warum sollte ich? Ist es denn schon wieder so weit, dass man Angst haben muss, wenn man die Wahrheit sagt?
Radio Köln: Als wir Sie noch nicht kannten, wollten wir einen Deserteur aus dem Ruhrgebiet interviewen. Er stand schon vorher unter Druck, weil seine Desertation bekannt war. Er hatte Angst, uns ein Interview zu geben und abgesagt.
Leo Kever: Ich habe keine Angst. Das könne sie auch schriftlich nachlesen in Briefen, die ich an Blüm, Stoltenberg, ScharzSchilling und andere Herren der schwarzen Hierarchie geschrieben habe. Ich desertierte, als verschiedene dieser Herren noch auf den braunen Endsieg hofften.
Radio Köln: Was halten Sie von den jetzigen Politikern?
Leo Kever: Nicht viel, wahrscheinlich überhaupt nichts. Damit meine ich nicht nur die Politiker der momentanen Regierung. Bei der Opposition sieht es nicht viel besser aus. Im übrigen siehe meine vorher gegebene Stellungnahme.
Radio Köln: Was schlagen Sie vor gegen das Wiedererstarken des Rechtsradikalismus?
Leo Kever: Erstens: Konsequent die bestehenden Gesetze, die ja schon vorhanden sind, anwenden. Zweitens: Das heißt konkret in diesem Fall, striktes Verbot aller faschistischen oder ähnlichen Organisationen. Drittens: Anwendung der Alliierten Kontrollratsbestimmungen über den Umgang mit faschistischen Organisationen. Bei Nichbefolgung harte Bestrafung.
Radio Köln: Worin sehen Sie die Ursachen für das starke Anwachsen der rechtsradikalen Bewegung?
Leo Kever: Die Hauptursache liegt in der Hoffnungs und Perspektivlosigkeit, in die die jungen Menschen der DDR gestoßen wurden durch die Rücksichtslosigkeit der so genannten „sozialen“ Marktwirtschaft und die Lügen und die skrupellosen Versprechungen der nun in ganz Deutschland Herrschenden, die nie eingehalten wurden. Das ist der Nährboden der braunen Rattenfänger.
Radio Köln: Was könnte Ihrer Meinung nach getan werden, um diese Unsicherheit zu beheben?
Leo Kever: Vor allem klage ich die Treuhandanstalt an, eine der Hauptschuldigen zu sein. Sie versuchte nicht Betriebe zu sanieren, Arbeitsplätze zu sichern. Im Auftrag westdeutscher Konzerne bestand und besteht ihre Aufgabe darin, ihnen die erwachsene OstKonkurrenz vom Leibe zu halten – ohne Rücksicht auf die Menschen. Die Räuber aus dem Westen verdienten etwa 600 Milliarden DM an der Wiedervereinigung.
Dieses Geld in die DDR zurückgeführt.
Geschätzte 60 – 70 Milliarden DM direkte und indirekte Rüstungskosten, die ja nun nicht mehr gebraucht werden, in der DDR investiert!
Die zur Zeit der Landreform aus der DDR geflüchteten Haus und Landbesitzer, im Westen größtenteils entschädigt über das Lastenausgleichsgesetz, bekommen jetzt alles kostenlos zurück, obwohl die ehemalige DDR in vielen Fällen hohe Summen aufbringen musste, um diese Häuser zu erhalten und zu sanieren. Sie können die Häuser zurückkaufen zu angemessenen Preisen. Das Geld ebenfalls zurück in die DDR.
Das sind nur einige Beispiele, es gibt sicher noch viele andere.
Radio Köln: Damit möchten wir das Interview beenden.