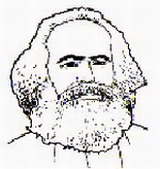Zeitschrift für Sozialismus und Frieden 07/09
Herausgeber: Verein zur Förderung demokratischer Publizistik (e.V.)
Spendenempfehlung: 3,00 €
Ausgabe November / Dezember 2009
Inhalt
- Redaktionsnotiz
- Unsere Konferenz zum 60. Jahrstag der Gründung der DDR vom 10./11. 10. 2009
- Konferenz am 7. 11. 09 in Prag
- Kommunistische Einheit
- Frank Flegel: Erlebnisse mit kommunistischen und linken Organisationen während der letzten sechs Monate
- Dieter Hainke: Kommunistische Einheit
- René McDavis: Quebecisches Tagebuch im Herbst 2009
- Ervin Rozsnyai: War es noch zu früh?
- Gerhard Feldbauer: Zwischen Revisionismus und flexibler Außenpolitik - Nikita S. Chruschtschow
- Otto Bruckner: "Die große Revolution der kleinen Leute ist tot" Referat MASCH der KI Österreich
- ZK der KPD: Brief an die Redaktion offen-siv
- Redaktion offen-siv: Brief an das ZK der KPD
- ZK der KPD: Brief an die Redaktion offen-siv
- Debatte in der DKP
- Politische Ökonomie des Sozialismus
- Cuba
- Nächster Durchgang des Fernstudiums – März 2010
- Aus der Leser/innenpost
- offen-siv-Lesertreffen
- KI-Regionaltreffen
Redaktionsnotiz |
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Leserinnen und Leser, wir müssen an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt über Finanzen reden.
Es liegt eine inhaltlich, politisch und finanziell aufwendige Konferenz hinter uns. Zwar stehen wir nicht vor dem Ruin, aber das mühsam zusammengesparte Polster ist dramatisch geschrumpft. Und die nächste große finanzielle Herausforderung steht vor der Tür: Der Protokollband unserer Veranstaltung „…und der Zukunft zugewandt…“ muss herausgebracht werden. Druck und Vertrieb werden uns zunächst rund 5.000,- Euro kosten, wovon ein Teil durch die Verkäufe in Buchläden und die Nachbestellungen bei uns wieder zurückfließen wird. Diese Gewissheit ist zwar schön, hilft uns aktuell jedoch nicht weiter.
Anmerken wollen wir an dieser Stelle, dass alle diejenigen aus unserem Umfeld und direkt von der offen-siv, die uns bei der DDR-Konferenz unterstützt haben, ihre Reisekosten nach Berlin und ihre Unterkunft und Verpflegung vor Ort aus eigener Tasche bezahlt haben. Zur Konferenz eingeladen und in Berlin auf unsere Kosten versorgt wurden nur die ausländischen Genossinnen und Genossen, wobei auch sie für die Reisekosten selbst aufkommen mussten.
Trotz dieser Sparsamkeit müssen wir Euch eindringlich um Spenden bitten.
Spendenkonto Offensiv:
Inland: Konto Frank Flegel, Kt.Nr.: 30 90 180 146 bei der Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80, Kennwort: Offensiv
Ausland: Konto Frank Flegel,
Internat. Kontonummer(IBAN): DE 10 2505 0180 0021 8272 49,
Bankidentifikation (BIC): SPKHDE2HXXX; Kennwort: „Offensiv“.
Redaktion Offensiv
Hannover
Unsere Konferenz vom 10./11.10.2009 |
Anna C. Heinrich und Frank Flegel
Und der Zukunft zugewandt!
Orientierung der Veranstaltung
Wir wollten ganz bewusst das Andenken an die DDR verbinden mit einer Perspektive für die Zukunft. Damit hat die Konferenz zwei wichtige Funktionen bekommen: die DDR gegen die Jauchekübel der bürgerlichen Medien zu verteidigen und aus den Lehren der Niederlage und den seitdem vergangenen 20 Jahren konkrete politische, handlungsorientierte Schlüsse zu ziehen.
Selbstverständlich kann man auch in einer zweitägigen, dichten und inhaltsvollen Tagung die DDR nicht in allen ihren Funktionen, Einflüssen und Wirkungen beleuchten. Trotzdem aber haben wir mit den vier Themenfeldern „Die DDR selbst“, „Die internationale Solidarität“, „die DDR in Europa“ und „Die militärische Sicherheit der DDR im Kalten Krieg“ einen tiefgehenden und differenzierten Blick auf den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden gerichtet. Gerade für die zahlreich anwesenden jungen Genossinnen und Genossen war dieser sehr genaue, analytische Rückblick ausgesprochen lehrreich.
Doppeltes Wagnis
Mit dem zweiten und dritten Teil der Konferenz sind wir ein nicht geringes Wagnis eingegangen. Selbstverständlich sind wir uns in der kommunistischen Bewegung in Deutschland alle einig darüber, dass man die Ursachen für die Niederlage aufdecken muss, um daraus zu lernen. Wenn es dann konkret wird, zeigen sich aber unvereinbare Gegensätze, die ich hier ganz grob zuspitzen will auf zwei Alternativen, um die sich alles dreht: War der Revisionismus die Ursache der Niederlage oder waren es die so genannten Verfehlungen, Entstellungen und Verbrechen Stalins? Wir haben in den letzten beiden Jahren umfangreiches Material zur Niederlagenanalyse vorgelegt, bereits davor war die Taubenfußchronik von Kurt Gossweiler erschienen. Unsere Forschungsergebnisse sind bisher nicht widerlegt worden, ganz im Gegenteil, mit dem Band „Unter Feuer“, den wir anlässlich dieser Konferenz der dreiköpfigen Delegation der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) offiziell übergeben konnten, gehen sie inzwischen auch in die Grundlagenanalysen der KKE ein. Trotzdem werden sie hier in Deutschland noch immer totgeschwiegen, für „linksradikal“ gehalten, mit dem Bannstrahl von Dogmatismus und Stalinismus belegt usw. Wir konnten aber unter dem Gesichtspunkt der Redlichkeit auf diesen ganz wesentlichen inhaltlichen Punkt bei unserer Konferenz nicht verzichten und mussten deshalb das Wagnis eingehen, uns erneut mit Ab- und Ausgrenzung sowie den Versuchen des Totschweigens auseinandersetzen zu müssen. Es kam dann auch genau so, wir sind inzwischen aber stark genug, trotz der Blockadehaltung der DKP, des ehemaligen MfS, schließlich auch der KPD eine solche Konferenz mit mehr als 150 Teilnehmern/innen durchzuführen und zu einem Erfolg zu machen.
Wir hatten uns aber entschieden, auch hier, also bei der Niederlagenanalyse, nicht stehen zu bleiben, sondern konkrete, handlungsorientierte Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen – nämlich die Kommunistische Initiative als Resultat der und Konsequenz aus den vorangestellten Analysen vorzustellen.. Dies Anliegen, das war uns selbstverständlich bewusst, verstärkte das Risiko der Ausgrenzung um ein Vielfaches, denn wenn es praktisch wird, wenn, wie man bei uns sagt „Butter bei die Fische“ muss, dann zeigen sich die Differenzen schneller und schärfen als bei einer reinen, am besten noch konsequenzlosen Diskussion. Wir waren also sehr gespannt und auch ein wenig nervös.
Verlauf und Nachklang
Um so größer war unsere Überraschung sowohl über die große Teilnehmerzahl als auch die konstruktive und freundschaftliche Atmosphäre des ersten Tages. Aber gut, noch waren wir im historischen und analytischen Teil. Die brisanteren Dinge warteten am nächsten Tag auf uns. Deshalb war unsere Anspannung noch längst nicht der Entspannung gewichen.
Als aber am zweiten Tag, dem Sonntag, morgens um 9.00 Uhr der Saal noch voller war als am ersten Tag, da ahnten wir, dass unser Konzept angenommen würde. Der gesamte Tag verlief konstruktiv, klar und freundlich, das Streben nach Einheit der Kommunisten war Konsens (nachdem Heinz Keßler dies in seiner Rede energisch angemahnt hatte, erhob sich der gesamte Saal!), die Vorstellung der Kommu-nistischen Initiative wurde mit großem Applaus bedacht und mehrere Dutzend Genossinnen und Genossen meldeten sich danach zur Unterschrift und Mitarbeit am Stand der Kommunistischen Initiative.
Nach der Konferenz erreichten uns zahlreiche Dankesbekundungen und inzwischen rund 100 Vorbestellungen für den Protokollband der Veranstaltung, der auch den Titel „Und der Zukunft zugewandt“ tragen wird. Tief bewegt waren auch die auslän-dischen Genossinnen und Genossen, und zwar sowohl von der inhaltlichen Qualität und Breite der Beiträge wie auch vom zahlreichen und aufmerksamen Publikum.
Durch diese Konferenz wird sich die internationale Zusammenarbeit merklich vertiefen.
Politische Einschätzung
Der offen-siv und der Kommunistischen Initiative wurden von den Genossen der Kommunistischen Partei Großbritanniens/Marxisten-Leninisten, der Bewegung für den Sozialismus aus dem Tschad, der Zeitschrift „Marxismus und Gegenwart“ aus der Ukraine, der Kommunistischen Partei der Türkei, der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens und der Kommunistischen Partei Griechenlands direkt bei der Konferenz solidarische Grüße überbracht. Schriftlich übermittelten uns die Genossen der Kommunistischen Partei Polens und die Genossen vom Palästinensischen Jugend-verband der PFLP sowie die Genossen vom Rat für Freundschaft und Solidarität mit dem Sowjetischen Volk aus Kanada ihre Grüße. Diese internationale Verankerung eröffnet natürlich viele interessante Möglichkeiten, die wir nach unserer Konferenz noch intensiver nutzen können und nutzen werden als zuvor. So sind wir zum Beispiel von den tschechischen Genossen zum 7. November nach Prag eingeladen gewesen, um im Rahmen einer von ihnen durchgeführten internationalen Konferenz über sehr interessante Kooperationsmöglichkeiten mit ihnen und anderen kommu-nistischen Kräften in Europa zu beraten. Unseren Beitrag dazu findet Ihr direkt nach diesem Schwerpunkt.
In Deutschland haben unsere Konferenz und die Diskussionen davor und danach zur weiteren Klärung der Lage beigetragen. Es gibt zum Teil hektische Aktivitäten bei denjenigen Kräften, die offensichtlich mit dem gegenwärtigen Zustand der kommu-nistischen Bewegung in Deutschland zufrieden sind und ihn bewahren wollen, die die Kommunistische Initiative als Bedrohung ihrer selbst empfinden und sich mit allen Mitteln gegen diesen neuen Einheitsversuch der Kommunisten sperren, sprich bei der DKP-Führung (Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die KI), bei der KPD-Führung (Rücknahme der Unterstützung der DDR-Veranstaltung und interner Boykottaufruf) und beim Chefredakteur des RotFuchs (KI als „fragwürdiges Unterfangen“, als „Irreführung redlicher Genossen und deren Missbrauch“, offen-siv als „seit langem mit dem Auseinanderdividieren linker Kräfte befasst“). Bedauerlich ist, dass der „Berliner Anstoß“, Zeitung der DKP Berlin, den Abdruck eines Artikels ihres eigenen Redakteurs, Hartwig Strohschein, über die DDR-Konferenz ablehnte.
Selbstverständlich ist es tragisch, dass sich diese Gruppierungen im wesentlichen in Abgrenzung ergehen. Aber die Kommunistische Initiative ist ja auch gerade deshalb ein neuer, ein anderer Versuch der Einheit, weil sie nicht auf die überlieferten Parteien und ihre Führungen setzt, sondern auf Personen, auf Genossinnen und Genossen, die die Einheit auf marxistisch-leninistischer Grundlage wollen.
Danksagung
Ohne die Zusammenarbeit von rund 40 Genossinnen und Genossen wäre diese Konferenz nicht möglich gewesen. Wir wollen ihnen herzlichen Dank aussprechen.
Wir danken den 26 Genossinnen und Genossen, die die Veranstaltung inhaltlich ausgestaltet haben. Das waren: Hans Bauer, Harpal Brar aus Großbritannien, Erich Buchholz, Hans-Werner Deim, Jens Focke, Radim Gonda aus der Tschechischen Republik, Kurt Gossweiler (als Autor), Dieter Hillebrenner, Ingo Höhmann, Dieter Itzerott (als Autor), Tamila Jabrowa aus der Ukraine, Heinz Keßler, Martin Kober, Michael Kubi, Heinz Langer (als Autor), Hermann Leihkauf, Robert Medernach aus Luxemburg, Ley Ngardigal aus dem Tschad, Michael Opperskalski, Fanis Paris aus Griechenland, Achim Reichardt, Ali San aus der Türkei, Josef Skala aus der Tsche-chischen Republik, Monika van der Meer, Thomas Waldeck, Heiderose Weisheit.
Wir danken der GRH, der KPD(B) und der Jugendbibliothek Gera für die Unterstützung unserer Konferenz.
Wir danken den Genossen Michael Kubi, Robert Medernach, Thorsten Reichelt und der Genossin Andrea Schön dafür, die Vortragsübersetzungen aus dem Englischen, Französischen und Russischen und die Betreuung unserer ausländischen Gäste gewährleistet zu haben
Wir danken den Genossen Benjamin Blümlein, Axel Galler, Jens Focke, Martin Kober, Patrick Naske und Alexander Sadegh für Aufbau, Umbau und logistische Hilfe.
Wir danken der Genossin Andrea Vogt, den Genossen André und Robert Vogt sowie der Genossin Antje Mahle für die Sicherstellung der hervorragenden Versorgung für alle Gäste unserer Konferenz
Wir danken den Genossen Hans Fischer und Michael Geipel für die Hilfe während der Vorbereitung, für die Ausstattung der Veranstaltung und die Betreuung der Bühnentechnik.
Wir danken ganz besonders dem Genossen Michael Opperskalski, der mit uns das Organisationszentrum bildete.
Und wir danken allen Genossinnen und Genossen, die bei der Konferenz anwesend waren für ihre Konzentration, ihre Konstruktivität, für die kameradschaftliche Atmosphäre, die interessanten Gespräche in den Pausen und vor allem für ihre Begeisterung für die Sache.
Protokollband und Subskription
Wir werden die Resultate diese Veranstaltung selbstverständlich in einem Protokollband veröffentlichen. Bei 26 Referaten dauert das seine Zeit – der Band wird erst im Januar 2010 erscheinen, rund 300 Seiten umfassen und 15,00 Euro kosten. Alle Abonnenten der offen-siv bekommen ihn im Rahmen ihres Abos automatisch zugesandt – und wir werden Euch bitten, uns mit 5,00 Euro bei den Druckkosten zu helfen.
Für diejenigen Abonnenten/innen, die mehr als einen Band brauchen, empfehlen wir die Subskriptionsfrist: Bis zum 24.12.2009 gibt es die Möglichkeit der Subskription. Wer den Band bis zu diesem Zeitpunkt bei uns bestellt, bekommt ihn sofort nach Fertigstellung im Januar 2010 für den Sonderpreis von 12,00 Euro portofrei von uns zugesandt. Bestellungen an: Redaktion offen-siv, Frank Flegel, Egerweg 8. 30559 Hannover, Tel.u.Fax: 0511-52 94 782, Mail: redaktion@offen-siv.net
Anna C. Heinrich und Frank Flegel
Hannover
Redaktion „Trotz Alledem“ (KPD(B))
Beeindruckende Konferenz zum 60. Jahrestag der Gründung der DDR
In Berlin fand am 10. und 11. Oktober eine wissenschaftliche Konferenz aus Anlaß des 60. Jahrestages der Gründung der DDR statt. Organisiert von „offen-siv“, unterstützt von der Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung (GRH e.V.), der Kommunistischen Initiative, der Kommunistischen Partei Deutschlands – Bolschewiki sowie von der Jugendbibliothek Gera.
Die zweitägige Konferenz war die bedeutendste und umfassendste Veranstaltung, die zum 60. Jahrestag der Gründung des ersten Arbeiter- und Bauernstaates in Deutschland stattfand. Die zur Verfügung stehenden Einladungen waren rasch vergeben, das Interesse groß und dank der inhaltsreichen Diskussion auf hohem Niveau, zu der eine große Zahl von Referenten aus dem In- und Ausland wertvolle Beiträge lieferten, wurde die Konferenz für alle Teilnehmer zu einem Erlebnis und außerordentlichen Erfolg. Redebeiträge zur Konferenz hielten Hans Bauer, Harpal Brar aus Großbritannien, Erich Buchholz, Hans-Werner Deim, Frank Flegel, Jens Focke, Radim Gonda aus der Tschechischen Republik, Hans Fischer, Kurt Gossweiler als Autor, Dieter Hillebrenner, Ingo Höhmann, Dieter Itzerott als Autor, Tamila Jabrowa aus der Ukraine, Heinz Keßler, Martin Kober, Michael Kubi, Heinz Langer als Autor, Hermann Leihkauf, Robert Medernach aus Luxemburg, Ley Ngardigal (genannt Djim) aus dem Tschad, Michael Opperskalski, Fanis Paris aus Griechenland, Achim Reichardt, Ali San aus der Türkei, Josef Skala aus der Tschechischen Republik, Monika van der Meer, Thomas Waldeck und Heiderose Weisheit.
Das Besondere an der Konferenz war, daß sie sich nicht nur dem Gedenken an die DDR widmete, sie leistete umfangreiche analytische Beiträge zum Aufbau und der Entwicklung der DDR, der nationalen und internationalen Bedeutung ihrer Existenz, sie befaßte sich sowohl mit den Erfolgen als auch mit den Ursachen für Zerstörung der DDR durch die Konterrevolution 1989/90. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – dies miteinander zu verbinden und die Fragen dazu auf wissenschaftliche Weise zu beantworten, das war das hohe Anliegen der Konferenz und das ist ihr wohl gelungen. An beiden Tagen folgten über viele Stunden die weit über 100 Teilnehmer der Konferenz den Ausführungen mit großer Aufmerksamkeit und dank der nicht nur „trocken“ wissenschaftlichen, sondern auch lebendigen, menschlich anrührenden Beiträge mit großem Vergnügen und innerer Bewegung. Die Atmosphäre und das Gefühl der solidarischen Verbundenheit, die die Teilnehmer der Konferenz mit-einander verband, das alles war bemerkenswert und konnte in den angeregten Pausen der Veranstaltung überall gehört werden. Unter den Teilnehmern waren alte Kämpfer wie Heinz Keßler, der sein Leben lang für die Ideale des Sozialismus gearbeitet hat und der Sache unerschütterlich treu geblieben und für uns alle ein Vorbild an Mut, Aufrichtigkeit und Standhaftigkeit ist, aber auch sehr junge Genossen und Freunde, die die DDR nur als Geschichte kennen.
Daß hier eine junge Generation nachfolgt, die die DDR und jene, die für sie lebten und arbeiteten auch in der Zukunft verteidigen werden, auch das war ein guter, optimistischer Eindruck, den wir aus der Konferenz mitnehmen.
Auch die Genossen unserer Partei, der KPD(B), die die Konferenz nicht nur mit ihren Redebeiträgen, sondern auch technisch-materiell unterstützte, angereiste Gäste betreute und dolmetschten, kehrten mit großer Begeisterung und frischem Elan von der Konferenz zurück. Die KPD(B) war zudem mit Informationsmaterial und einem Stand vor Ort, der auf sehr großes Interesse stieß. Zahlreiche Exemplare unserer Druckerzeugnisse fanden ihre Abnehmer, viele Gespräche wurden am Infostand der KPD(B) geführt. Mit Freude können wir feststellen, daß die Konferenz auch zur Folge hatte, daß unsere Partei bekannter wurde, neue Abonnenten für unsere Zeitung wurden gewonnen, neue Anträge auf Mitgliedschaft in unserer Partei sind bei uns eingegangen. Zudem wurden neue Verbindungen zu ausländischen Organisationen und Genossen geknüpft, bestehende aufgefrischt. So wurden noch während der Konferenz konkrete Absprachen mit Genossen der französischen URCF getroffen, gegenseitige Treffen in Berlin und Paris sollen stattfinden.
Bei den abendlichen gemeinsamen Essen wurden nicht nur die Ereignisse des Tages und der Verlauf der Konferenz besprochen, es waren auch Treffen, die von großer Herzlichkeit, tiefer gemeinsamer Verbundenheit und Freude über eine gelungene Veranstaltung geprägt waren. Alle zusammen werden wir viel Schwung mitnehmen für unsere künftige Arbeit. Die Konferenz hat gezeigt, daß verschiedene kommunistische, antiimperialistische und progressive Organisationen zu den wichtigen Fragen unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgezeichnet und erfolgreich zusammenarbeiten können und daß sie sich dabei nicht von Störmanövern, gleich von welcher Seite, beeindrucken lassen. Auch das ist ein wichtiges Ergebnis der DDR-Konferenz.
Zu den Unterstützern der DDR-Konferenz gehörte auch die Kommunistische Initiative (KI). Im Laufe der Konferenz war in den Diskussionen auch gute Gele-genheit, die Ziele und Inhalte der KI den Teilnehmern zu erläutern. Die Perspektiv-konferenz der KI, die am 5. Dezember in Berlin stattfindet und dort über die nächsten Schritte der KI berät, wird mit Sicherheit auch beflügelt werden vom so erfolgreichen Verlauf der Konferenz zum 60. Jahrestag der DDR.
Wir können hier die Fülle der Reden und Diskussionen, die Vielzahl der diskutierten Themen nicht annähernd wiedergeben, nicht alle Referate abdrucken, aber es wird sicher eine Dokumentation zur Konferenz geben, wo man das alles noch einmal nachlesen kann.
Ein großes Dankeschön gehört allen, die die Konferenz organisiert, durchgeführt und mit ihren Beiträgen, ob als Referent oder bei der technischen Unterstützung, zum Erfolg gemacht haben!
Redaktion „Trotz Alledem“
Berlin
Konferenz am 7. 11. 09 in Prag |
Michael Opperskalski
Beitrag zur Konferenz „20 Jahre danach – Der Kampf um die Zukunft
hält an“ in Prag
Liebe Genossinnen und Genossen,
Zunächst einmal möchte ich mich im Namen der marxistisch-leninistischen Zeitschrift „offen-siv“ sowie des „Vorläufigen Organisationskomitees“ der „Kommu-nistischen Initiative in Deutschland“ (KI), die ich hier beide vertreten darf, für Eure Einladung zu dieser wichtigen theoretisch-ideologischen Konferenz bedanken. Sie trägt den Titel „20 Jahre danach – der Kampf für die Zukunft hält an“ Was ist der Schlüssel für den Kampf um die Zukunft? Wo liegt er?
Gültigkeit des Marxismus-Leninismus bewiesen
Die vergangenen 20 Jahre haben die Gültigkeit des Marxismus-Leninismus in all seinen Aspekten bewiesen. Dies betrifft insbesondere die tatsächlichen Hintergründe der Konterrevolution in den sozialistischen Ländern Ost-Europas, aber auch die Entwicklung der so genannten Neuen Weltordnung, die nichts anderes als ordinärer Imperialismus ist. Die Konterrevolution konnte sich entwickeln und sich zeitweilig durchsetzen, weil ihr der Revisionismus seit dem XX. Parteitag der KPdSU in der kommunistischen Weltbewegung den Weg geebnet hatte.
Die so genannte „Neue Weltordnung“ bestätigt die Leninsche Imperialismustheorie
2005 analysierte das ZK der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) in seinen Thesen zur Vorbereitung ihres 17. Parteitages die imperialistische so genannte „Neue Weltordnung“ und die aktuellen Herausforderungen für die Kommunisten: „Die Veränderung der Machtbalance verändert nicht den Charakter unserer Epoche als Epoche des Übergangs zum Sozialismus. Die Entwicklung der letzten vier Jahre (Entfesselung imperialistischer Kriege unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus, Beseitigung von Rechten, die von den Völkern mit Blut Opfern errungen wurden, neue Methoden des Raubes des von den Werktätigen geschaffenen Reichtums, massenhafte Ausbreitung von Armut und Elend, neue Fesseln von Abhängigkeit und Unterwerfung der Völker, Anheizen nationalistischer Widersprüche und Konflikte, neue Formen der Manipulation, katastrophale Ausbeutung der Umwelt etc.) bestätigen, dass der Imperialismus, indem er die Produktion in schnellem Tempo und gewaltigem Umfang vergesellschaftet, ständig den Grundwiderspruch des Kapitalismus verstärkt, den Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privaten Aneignung der Produkte. Umso stärker machen sich daher Erscheinungen des Verfalls und Parasitismus bemerkbar. (…) Die Imperialisten sind sich einig beim Abgriff auf die Werktätigen und die rivalisieren gegeneinander um Märkte und Einflusszonen. Im Rahmen der vereinheitlichten Strategie des Imperialismus entwickeln sich die inner-imperialistischen Widersprüche und Rivalitäten um die ersten Plätze bei der Aufteilung der Märkte und Einflusssphären in Asien, dem Mittleren Osten und Afrika. Sie äußern sich direkt oder indirekt in den Frontenstellungen der Kriege, den Brennpunkten der Nationa-litätenkonflikte und in den Auseinandersetzungen zwischen Nachbarländern. Die kapitalistischen Zentren, die mächtigsten imperialistischen Kräfte konkurrieren untereinander sowie mit den USA, die versuchen, ihre Vorherrschaft zu erhalten und auszuweiten.“
Der Revisionismus ist hauptverantwortlich für die Spaltung, Schwächung und Zersplitterung der kommunistischen Bewegung
Der XX. Parteitag der KPdSU markierte einen Wendepunkt nicht nur bei der Entwicklung des Revisionismus bei de sowjetischen Kommunisten, sondern auch innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung. Das erste Ergebnis war die Spaltung der internationalen kommunistischen Bewegung, als die chinesischen Genossen den entscheidenden revisionistischen Grundorientierungen des XX. Parteitages nicht folgen wollten. Was danach folgte, war die schleichende, wenn auch sehr widersprüchliche Unterminierung der internationalen kommunistischen Bewe-gung, die schließlich fast in einer Implosion, auf jeden Fall in der Konterrevolution in den sozialistischen Ländern Ost-Europas mündete.
Angesichts der sich verschärfenden imperialistischen Barbarei – national wie international – ergibt sich die Herausforderung an die Kommunisten, sich auf nationaler wie auch internationaler Ebene zu reorganisieren. Es geht um die Schaffung eines kämpfenden, militanten, marxistisch-leninistischen Pols. Dies geht jedoch nicht auf der Basis von Beliebigkeiten oder diplomatischen Manövern, sondern nur mit klaren marxistisch-leninistischen Orientierungen, die ich in drei wesentlichen Punkten zusammenfassen möchte:
I) ein eindeutiges Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus als Einheit und damit auch zu seinen Grundelementen wie der Leninschen Staats-, Imperialismus-, Partei- und Revolutionstheorie sowie zur glorreichen Geschichte der kommunistischen Bewegung
II) ein eindeutiges Bekenntnis zum Vermächtnis wie auch der Rolle der sozialistischen Ländern, insbesondere der Sowjetunion als größte Errungenschaften der internationalen Arbeiterbewegung. Für uns deutsche Kommunisten bedeutet dies zudem, dass der Prüfstein für jeden deutschen Kommunisten sein Verhältnis zur DDR als größter Errungenschaft der deutschen Arbeiterbewegung
III) ein eindeutiges Bekenntnis zum Kampf gegen jede Form des Revisionismus, der die Basis für die siegreiche Konterrevolution sowie die Spaltung, Zersplitterung sowie bis an die Implosion gehende Schwächung der kommunistischen Bewegung war und ist
Das dies alles möglich ist, erfolgreich sein kann, belegt täglich, lebendig und aktuell die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE)!
Schaffung des kommunistischen Pols im imperialistischen Deutschland
Die aktuelle Situation, die sich auch im imperialistischen Deutschland nach innen wie außen verschärfende imperialistische Barbara verlangen nach und fordern eine Kommunistische Partei, die in der Lage ist, das deutsche Proletariat in den Klassenkämpfen zu führen, und die Voraussetzung zur Schaffung einer breiten, demokratischen, anti-imperialistischen Volksfront und schließlich der proletarischen, sozialistischen Revolution zu erkämpfen. Diese einheitliche, marxistisch-leninistische Partei gibt es derzeit im imperialistischen Deutschland nicht. Noch sind unter-schiedliche Formen des Revisionismus in der zersplitterten kommunistischen Bewegung in der BRD dominant.
Deshalb hat sich vor knapp einem Jahr die „Kommunistische Initiative“ gefunden, die bisher und erfolgreicher als gedacht, Kommunistinnen und Kommunisten, seien sie organisiert oder unorganisiert, zu sammeln und zu organisieren, um auf diesem Weg langfristig die Bedingungen für den Aufbau dieser so dringend benötigten einheit-lichen, marxistisch-leninistischen Partei zu schaffen.
Am 10./11. Oktober unterstütze die „Kommunistische Initiative“ eine von der marxistisch-leninistischen Zeitschrift „offen-siv“ organisierte wissenschaftliche Konferenz in Berlin, die in ihrem Erfolg die Erwartung der Veranstalter übertroffen hat. Ziel dieser Konferenz war nicht nur die Ehrung des 60. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) sowie auch die Diskussion der Schlussfolgerungen, die wir als Kommunisten aus dem revolutionären Erbe der DDR für unsere Zukunft ziehen. Einige der hier anwesenden Genossinnen und Genossen hatten die Möglichkeit, dies vor Ort mitzuerleben. Diese Konferenz verdeutlichte einen wichtigen weiteren Schritt in der Entwicklung der „Kommunistischen Initiative“, die am 5. Dezember in Berlin eine Perspektivkonferenz abhalten wird, um die weitere Entwicklung taktisch wie auch strategisch zu diskutieren, vorzubereiten und umzusetzen.
Konkrete Vorschläge
Ich möchte an dieser Stelle einen Vorschlag aufgreifen und unterstützen, die die tschechischen Genossen auf unserer Konferenz am 10/11. Oktober in Berlin gemacht haben und der sich aus Diskussionen stützt, der schon seit Jahren auf internationalen wie auch bilateralen Treffen von Kommunisten diskutiert wird: die, in welcher Form auch immer, Organisierung eines wissenschaftlichen kommunistischen Zentrums, zunächst auf europäischer Ebene, das in der Lage ist, sowohl grundsätzliche marxistisch-leninistische Analysen zu erarbeiten, wie auch gemeinsame Aktivitäten zu initiieren. Dieses Zentrum könnte zum Beispiel ein gemeinsames theoretisches Magazin herausgeben und zum Beispiel auch auf dieser Ebene zu einem weiteren Instrument unseres gemeinsamen Kampfes gegen die imperialistische EU werden. Das kann jedoch nur wirklich funktionieren, wenn sich diese Arbeit als wichtiges Element bei der Entwicklung des kommunistischen Pols erweist und auf klaren marxistisch-leninistischen Positionen basiert. Diese habe ich vorhin kurz skizziert.
Wir, Kommunistinnen und Kommunisten aus der BRD, die marxistisch-leninistische Zeitschrift „offen-siv“ wie auch die „Kommunistische Initiative“, sind bereit, die Initiative zu ergreifen und zu einem Treffen im Februar des kommenden Jahres in die BRD einzuladen, wo Form, Basis sowie Taktik und Strategie eines solchen Projektes mit dem Ziel diskutiert werden könnten, es auch umzusetzen! Näheres können wir im Rahmen dieses Treffens hier in Prag besprechen…
Sozialismus oder Barbarei!
Michael Opperskalski
Köln
Kommunistische Einheit |
Frank Flegel
Erlebnisse mit kommunistischen und linken Organisationen während der letzten sechs Monate
Wir berichten hier etwas ungewohnt, weil völlig offen, von den Vorgängen hinter den Kulissen. Es geht um die Vorbereitung unserer Konferenz zum 60. Jahrestag der Gründung der DDR und die vielen demoralisierenden und die wenigen aufbauenden Momente dabei.
Wir haben die GBM, die GRH, die DKP Berlin, die Jugendbibliothek Gera, die junge Welt, die KAZ, das Kommunistische Aktionsbündnis Dresden, die KPD, die KPD(B), das OKV, den RFB, den RotFuchs und die Zeitschrift Theorie und Praxis eingeladen, sich entweder als Mitveranstalter, als Unterstützer oder als Aufrufer an der Konferenz zu beteiligen. Die Reaktionen auf unsere Anfrage waren sehr interessant.
Nicht geantwortet haben die GBM, die KAZ und das OKV.
Telefonisch abgesagt hat der Vorsitzende der DKP Berlin („Es wird keine Zusammenarbeit geben.“).
Der RotFuchs sagte uns brieflich ab mit der Information, dass man eine eigene Veran-staltung durchführe.
Theorie und Praxis wollte, ohne als Unterstützer oder Aufrufer aufzutreten, einen Redebeitrag halten. Nach unsere Antwort, dass wir uns sehr über das Interesse freuen, wir eine reine Teilnahme aber nicht mit einem privilegierten Rederecht honorieren können, meldeten sich die Genossen nicht mehr.
Die junge Welt lehnte eine Unterstützung wegen Zeitmangels ab, wünschte uns aber viel Erfolg. Unsere Anfrage nach einem Interview oder einem redaktionellen Hinweis auf die Konferenz blieb unbeantwortet.
Mit dem KAD, konkret mit Wolfram Triller entwickelte sich ein spannender Briefwechsel, den wir hier wegen des Datenschutzes natürlich nicht wörtlich abdrucken können. Es ging dem Genossen Triller zunächst darum, die Konferenz inhaltlich herunterzufahren: weniger Beiträge, mehr Pausen, inhaltlich und vom Ablauf der Veranstaltung her müsse man den Bedürfnissen der älteren Genossen nachkommen. In einem weiteren Schreiben regte er dann an, die Veranstaltung nur auf den letzten Teil, die Präsentation der Kommunistischen Initiative, zu beschränken. Wir antworteten wie folgt:
„Lieber Wolfram!
Vielen Dank für Deine Nachricht.
Nun hatten wir ja um Unterstützung für DIESE Veranstaltung angefragt.
Du möchtest aber gern eine ANDERE, nämlich eine, die
- weniger inhaltliche Dichte hat (wie auch schon Deine erste Reaktion zeigte) und die sich
- auf die Präsentation der Kommunistischen Initiative ausrichten soll (wie Deine/Eure jetzige Reaktion zeigt).
Das würde den Charakter der von uns geplanten Veranstaltung vollständig verändern und den Inhalt jeder Bodenhaftung berauben.
Es geht uns nämlich um einen logischen Faden:
- Die DDR war Sozialismus auf deutschem Boden und damit das Beste, was hier bisher hervorgebracht wurde (die größte Errungenschaft der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung).
- Der Sozialismus in Europa und damit auch die DDR waren in der internationalen Klassenauseinandersetzung nicht grundsätzlich und auch nicht zufällig unterlegen, sondern haben sich durch das schleichende Gift des Revisionismus Stück für Stück geschwächt - bis zum Desaster.
- Diese Tatsache hat Konsequenzen für die kommunistische Bewegung heute. Ein Neuanfang mit revisionistischer Ausrichtung ist nämlich keiner - und grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Die Wiederherstellung des wissenschaftlichen Gehaltes unserer Weltanschauung, des Marxismus-Leninismus, ist notwendig.
- Die Lage der kommunistischen Bewegung weltweit, in Europa und in Deutschland ist mehr als beklagenswert. Verwirrung, Opportunismus, Revisionismus und damit Zersplitterung sind fast allgegenwärtig. Aus dem Vorherigen ergibt sich, dass die Zersplitterung nicht aufzuheben ist, indem man sich mit Opportunisten und Revisionisten vereint.
- Das ist der Grund, warum wir den Versuch der Kommunistischen Initiative wagen wollen.
An diesem logischen Faden wollen wir festhalten. Wir werden jedenfalls keine Veranstaltung über Punkt 5 machen (so verstehe ich Euren Vorschlag), ohne die vorherigen vier Punkte mitzubehandeln.
Ich verstehe nicht so recht, warum Ihr dieses Konzept für so abwegig haltet.
Bitte erläutert uns Eure Vorbehalte etwas genauer, damit wir vielleicht doch noch zu einer Einigung kommen können.
Mit kommunistischen Grüßen! Frank“
Die nächste Reaktion war, den logischen Faden zu akzeptieren, aber jetzt Vorbehalte zu äußern dahingehend, dass die Veranstaltung zu belehrend ausfallen würde, dass es sektiererische Tendenzen gäbe usw. Dazu ein kurzes Zitat aus dem Brief: „In dem Prinzip `Klarheit vor Einheit´ steckt die Gefahr einer sektiererischen Abgrenzung. Muß man erst eine Aufnahmeprüfung bei der KI bestehen, um für kommunistische Positionen kämpfen zu können, oder entwickeln sich kommunistische Positionen auch, indem man an der Seite von Kommunisten in den Kampf zieht?“
Unsere Antwort war:
„Lieber Wolfram, 22.5.09
Dank für Deine Zeilen vom 19.5.09.
Es freut uns sehr, dass Du keine Einwände gegen unser Konzept des „logischen Fadens“ hast und unsere Auffassung bestätigst, indem Du schreibst, dass „mit der geplanten Konferenz und der Krise des Imperialismus die Zahl derer wachsen (wird), die ein Zurück zum Marxismus für dringend erforderlich halten“.
Aber trotz dieser grundsätzlichen Übereinstimmung hast Du unendlich viele Fragen.
Ich will versuchen, sie zu beantworten. Dazu benutze ich Deine Nummerierung.
- Die Entwicklung der KI ist ein Versuch, die Marxisten-Leninisten in unserem Lande Schritt für Schritt zusammenzufassen mit dem Ziel einer einheitlichen Partei. Ob das der einzige oder der Hauptweg ist, zeigt die Geschichte. Alle, die sich nicht im Revisionismus suhlen oder dem Opportunismus anheim fallen, sind herzlich willkommen. Diejenigen, die Obiges tun, allerdings nicht.
- Die KI will sich in alle Kämpfe einbringen, indem sie den Versuch unternimmt, in Deutschland eine Kommunistische Partei zu schaffen. Aktionsprogramme entstehen immer; erst wenn es eine wahrnehmbare kommunistische, also marxistisch-leninistische Kraft gibt, können auch marxistische Aktionsprogramme entstehen. Zu Deiner Frage zur KKE: Zur Teilnahme der KKE an den Europawahlen stehen wir positiv, die Teilnahme der DKP an den Europawahlen lehnen wir ab. Das liegt nicht an den Europawahlen, sondern an den jeweiligen politischen Ausrichtungen. Um alle Missverständnisse auszuschließen: Hätte die DKP das Programm der KKE, würden wir ihren Wahlkampf tatkräftig unterstützen. Wäre das so, dann wäre die DKP eine andere Partei und wahrscheinlich die gesamte Anstrengung der KI überflüssig.
Zu Deinen weiteren Bemerkungen:
Im Prinzip Klarheit vor Einheit steckt vor allem die Abgrenzung vom Reformismus und Revisionismus; was das mit sektiererischer Abgrenzung zu tun haben soll, musst Du mir noch mal in Ruhe erklären.
Des weiteren geht es auch nicht um „Aufnahmeprüfungen“, sondern um Gesellschaftserkenntnis. Natürlich sind Kommunisten auch Menschen und können irren, natürlich ist unsere Theorie manchmal zu allgemein, natürlich haben wir viel zu wenig Kräfte für eine solide Theoriearbeit der kommunistischen Bewegung, natürlich gibt es immer wieder Fehler und falsche Einschätzungen, aber eins muss klar sein: wir müssen daran arbeiten, dass diese Irrtümer, Fehler und falschen Einschätzungen so selten wie möglich werden, dass wir also mittels der Theorie die Wirklichkeit so weit durchdringen, dass wir uns in die Lage versetzen, heute schon, auf unsere Wissenschaft gestützt, wissen und natürlich auch sagen zu können, was morgen in diesem imperialistischen System geschehen wird (siehe Thälmann: Hindenburg-Hitler-Krieg). Deine These, dass die Praxis der Prüfstein für die Wahrheit sei, ist äußerst gefährlich und müsste genauer erörtert werden.
Zum Schluss zu Deinem Wort über das „Belehren“: Wir wollen, dass die von uns geplante Konferenz keine Plauderveranstaltung, sondern eine Lehrveranstaltung wird. Es geht uns, wie schon vorher dargestellt, um den logischen Zusammenhang von Aufbau, Niederlage, aktueller Situation und Zukunftsperspektive. Das Not-wendige, was Menschen tun müssen, ist lernen. Das darauf folgende Wichtigste ist Handeln. Meistens erwächst allerdings anders herum aus dem Zwang zur Handlung das Erkenntnisinteresse zum Lernen. Wenn dann alles gut geht, wird aus der Einheit beider Pole die Vernunft. Wenn die Kommunistische Partei dies organisiert, ist sie gut. Man sollte den Anfang dieses Prozesses nicht als „Belehren“ verunglimpfen.
Die Frage, die übrig bleibt, ist: Unterstützt Ihr unsere Veranstaltung oder nicht?
Mit besten Grüßen, Frank“
Darauf erfolgte keine weitere Reaktion.
Der RFB schloss sich weitgehend der Argumentation des Genossen Triller an und verschärfte sie insofern, als er uns schrieb, dass im Aufruf der KI „Sektierertum zum Ausdruck kommt“ und dass der RFB vom Angebot der Unterstützung dieser Konferenz „keinen Gebrauch“ mache[1].
Die KPD, die KPD(B), die GRH und die Jugendbibliothek Gera reagierten positiv auf unsere Anfrage und erklärten sich zu Unterstützern bzw. zum Aufrufer (Jugendbibliothek). Die GRH beteiligte sich zu unserer Freude sogar mit einem finanziellen Beitrag an der Konferenz. Der Genosse Hans Bauer von der GRH und der Genosse Jens Focke von der KPD(B) hielten Referate bei unserer Konferenz.
Mit der KPD wurde das Ganze kurz vor der Konferenz schwierig. Wir hatten in der September-Oktober-Ausgabe der offen-siv einen Leitartikel des KPD-Zentralorgans „Die Rote Fahne“ öffentlich kritisiert. Dies war für die KPD-Führung der Anlass, die zugesagte Unterstützung für die Konferenz aufzukündigen und auch ihren Rede-beitrag (Weltfestspiele der Jugend in Berlin) zurückzuziehen. Den Brief der KPD und unsere Antwort findet Ihr in diesem Heft in dieser gleichen Rubrik „Kommunistische Einheit“. Interessant war in der Folge, dass die KPD intern die Parole ausgab, man habe beschlossen, die Konferenz zu boykottieren und mit Mails und Telefonaten versuchte, ihre Mitglieder vom Besuch der Konferenz abzuhalten.
Frank Flegel
Hannover
Dieter Hainke
Kommunistische Einheit
Wir stehen vor der Tatsache, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gelungen ist, dass die zersplitterte kommunistische Bewegung in Europa, und natürlich auch in Deutschland, zu einer besseren organisatorischen und ideologischen Zusammenarbeit gelangt.
Der Grundwiderspruch unserer Epoche ist eigentlich klar. Er liegt im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Die Trennlinie geht zwischen Arbeitskraft kaufenden und Arbeitskraft verkaufen müssenden. Aber so einfach ist das offensichtlich nicht.
Unsere Welt ist geopolitisch zweigeteilt in die führenden Industriestaaten und die weniger entwickelten oder unterentwickelten Staaten. In stark vereinfachter Form könnte man sagen, die Trennlinie geht zwischen dem nördlichen Amerika, Kern-Europa und einigen asiatischen Staaten einerseits und dem Rest der Welt andererseits.
Die soziale Trennlinie geht anders, sie geht zwischen Arm und Reich. Nun sind diese Begriffe sehr relativ und werden subjektiv sehr unterschiedlich empfunden. Es lässt sich schwer mit ihnen operieren. Man muß zurück zum Kernwiderspruch, zum Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit.
Es ist Karl Marx zu verdanken, dass heute ein gesichertes Wissen über die Gesetzmäßigkeiten kapitalistischer Produktionsweise vorliegt. Ich möchte diese nicht wiederholen. Wem es zu anstrengend ist, sich durch das Lebenswerk von Karl Marx, durch sein Werk „Das Kapital“ durchzuarbeiten, dem sei das Studium des Sonderheftes „Kompendium unseres marxistisch-leninistischen Fernstudiums“ der Zeitschrift „offen-siv“ empfohlen. Einige junge Genossen haben hier eine her-vorragende Arbeit geleistet und diese Gesetzmäßigkeiten in einer Form dargestellt, wie es fast nicht einfacher und klarer möglich ist. Diesen Genossen gilt großer Dank.
Ich selbst möchte mich der Frage nähern, dass es trotzdem in der Praxis so viele differierende Auffassungen in den sich kommunistisch verstehenden Parteien und Bewegungen gibt.
Es gibt keinen Streit darüber, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung inhuman ist. Es gibt auch noch Konsens darüber, dass diese Gesellschaft durch eine bessere, eine sozialistische Gesellschaft, abgelöst werden muß. Aber über das Wie und ob es überhaupt in absehbarer Zeit möglich ist, gibt es fast so viele unterschiedliche Auffassungen wie es sich als kommunistisch verstehende Parteien gibt. Und die unterschiedlichen Auffassungen bestehen nicht nur zwischen den verschiedenen Parteien, sonder sie gehen quer durch die Parteien selbst.
Es ist weit verbreitet, eine Partei nach dem Erscheinungsbild ihrer Führung zu beurteilen. Das scheint logisch, denn schließlich bestimmt die Führung die Politik der Partei. Aber Führungen können wechseln, mehrheitlich vertretene Auffassungen können sich ändern. Parteien verschwinden und neue entstehen. Ich denke nur an den politischen und moralischen Niedergang solcher einst so stolzen kommunistischen Parteien wie die Kommunistische Partei Frankreichs oder die Kommunistische Partei Italiens oder die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Viele der einstigen Mit-glieder haben sich ihre kommunistische Gesinnung bewahrt und irren im Durcheinander der Vielzahl der inzwischen entstandenen Splitterparteien umher. Und viele haben den Mut und den Glauben verloren, dass ihre einstigen Ideale, von denen sie überzeugt waren und noch immer davon überzeugt sind, auf Grund der zur Zeit anscheinend unüberwindbaren Machtfülle des Kapitals je realisierbar sind..
Unter diesen Bedingungen sich als Kommunist zu bekennen und unbeirrt für die Überwindung dieses inhumanen kapitalistischen Systems zu kämpfen erfordert ein hohes Maß an politischem Wissen, eine zutiefst humane Grundhaltung und ein hohes Maß an Standvermögen. Man wird nicht als Kommunist geboren. Kommunist wird man im Verlauf eines Prozesses. Dieser kann bereits im Elternhaus beginnen, andere finden den Weg durch gute Freunde, wieder andere wurden es durch das Erlebnis gesellschaftlicher Katastrophen wie Kriege, Wirtschaftskrisen oder andere soziale Erschütterungen. Es ist kein Zufall, dass die kommunistische Bewegung gerade nach Kriegen einen Aufschwung erfährt. Und einige werden zu Kommunisten durch das Studium marxistischer Literatur. Aber immer ist es notwendig, dass ein Kommunist mit de r Theorie des Marxismus/Leninismus vertraut ist. Und hier liegt die große Schwäche unserer heutigen kommunistischen Bewegung. Viel Subjektivismus ist eingekehrt in viele der heutigen kommunistischen Parteien. Anpassungsbemühungen, Unglaube, Vorstellungen, den Kapitalismus besser machen zu können, und andere subjektive Ideen lähmen den notwendigen Kampf für die Überwindung des kapitalistischen Systems und damit für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, ohne verheerende Kriege, ohne Differenzierung der Gesellschaft in Arm und Reich. Ich meine nicht primitive Gleichmacherei, sondern echte Chancengleichheit unabhängig von der sozialen Herkunft, eine Gesellschaft in der die ganz persönliche Leistung über die realisierbare Lebensqualität entscheidet. Und das geht nur durch die Überwindung des privaten Besitzes an Produktionsmitteln, und was gleichbedeutend ist, durch die Beseitigung des privaten Besitzes an den von der Natur gegeben Recourcen.
Man wird mir sagen, das sind alles alte Kamellen. Warum haben sie sich nicht durchgesetzt. Die Frage ist berechtigt, wenn auch von äußerster Primitivität, denn sie enthält nicht den geringsten Bezug zu einer Analyse der jeweilig gegebenen gesellschaftlichen Situation.
Trotzdem möchte ich versuchen, einige Gedanken in die Diskussion zu bringen, zu denen ich gern auch die Auffassungen anderer Genossen erfahren würde.
Kommen wir wieder zurück zum Kernwiderspruch unserer Epoche, dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Diesen Widerspruch können objektiv nur die lohnabhängig Beschäftigten lösen. Darunter verstehe ich all jene, deren Existenz auf Gnade und Erbarmen vom Verkauf ihrer Arbeitskraft abhängt, denn mehr können sie auf dem kapitalistischen Markt nicht anbieten. Ich möchte sie nachfolgend verein-fachend Arbeiter nennen. Wenn sie in den hochentwickelten Industriestaaten vom Kapital durch sogenannte sozialpolitische Maßnahmen ruhig gestellt werden, ändert das nichts an ihrer ökonomischen Rechtlosigkeit.
Vom Kapital zu erwarten, dass es menschlicher wird, ist eine Träumerei. Die Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft und das damit zwingend verbundene Streben nach Maximalprofit schließen eine Humanisierung des Kapitalismus aus. Andererseits ist ein revolutionärer Umsturz in den führenden Industriestaaten in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten. Viele Arbeiter glauben etwas zu verlieren zu haben, nicht wissend, dass ein Teil dessen, was über dem Neveau armer Länder , aus der brutalen Ausplünderung ihrer Klassenbrüder in den weniger entwickelten Ländern resultiert. Sie sind nicht bereit, für die Überwindung des kapitalistischen Systems zu kämpfen. Es ist anzunehmen, dass der nächste revolutionäre Anlauf nicht in den führenden Industriestaaten stattfindet, sondern an der Peripherie der kapitalistischen Machtzen-tren.
Wie also muß man unter diesen Bedingungen sozialistische Arbeit machen. Es ist sicher das untauglichste Rezept, wenn die einzelnen kommunistischen Parteien oder einzelne Genossen sich gegenseitig vorwerfen, sie würden eine falsche Politik betreiben. An die Stelle des Suchens nach Unterschieden muß die Suche nach Gemeinsamkeiten treten. Damit verschwinden die Unterschiede nicht, aber man nähert sich ihnen von einer anderen Seite.
Da hat es eine Initiative gegeben, sich selbst nennend „Kommunistische Initiative“. Und schon sind sie da, die Abgrenzer. Was soll das? Nach meiner Kenntnis streben die Initiatoren nicht die Bildung einer neuen Partei an. Das wäre auch eine völlig überflüssige Aktion. Was notwendig ist, ist die Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse. Nichts, aber auch nichts anderes ist die Aufgabe der Stunde.
Was schmerzlich empfunden wird ist das Fehlen einer Kommunistischen Internationale als Gegenpol gegen die objektiv vorhandene kapitalistische Inter-nationale. Aber wie soll das passieren, wenn die Kommunisten nicht einmal in der Lage sind, sich national zu organisieren?
Da kann der Rotfuchs nicht mit Offensiv, da grenzt sich die DKP von der Kommunistischen Initiative ab, KPD und KPD (B) können anscheinend auch nicht zueinander finden. Die kommunistische Plattform bei der Partei Die Linke klammert sich an diese Partei, obwohl deren Führung eindeutig Kurs auf eine Vereinigung mit der SPD nimmt. Jeder macht sein eigenes Ding. Das Kapital wird es freuen.
So darf es nicht weiter gehen. Wir müssen wieder zu mehr Kooperation kommen, müssen wieder gemeinsame Veranstaltungen organisieren. Wir waren in Deutschland in Fragen der Zusammenarbeit schon einmal weiter. Konsultationen und gemeinsame Veranstaltungen beseitigen natürlich noch nicht den Tatbestand unterschiedlicher Positionen Das darf aber nicht dazu führen, dass man gegeneinander kämpft, sondern muß Anlaß sein, miteinander zu reden. Die Diskussion sollte sich um die Sache drehen, nicht um Personen. Sie sollte in der Form nicht verletzend sein. Wir sollten in dem Andersdenkenken zunächst den Klassenbruder sehen. Manchmal resultieren abweichende Auffassungen aus mangelndem politischem Wissen. Nicht unwesentlich sind die Biographien der einzelnen Agierenden. Jeder schleppt seine Vergangenheit mit sich herum. Sich anzunähern ist immer ein Prozess.
Die Diskussion mit einem Andersdenkenden führt nicht selten auch dazu, dass man seine eigenen Auffassungen in einem anderen Licht sieht. Und manchmal kommt man zu der Erkenntnis, dass man sie präzisieren muß, vielleicht sogar korrigieren.
Nun hilft natürlich Reden , bzw. Diskutieren, als solches noch nicht weiter. Wenn es nicht gelingt, in diesen Diskussionen den Marxismus/Leninismus als wissenschaftlich fundierte Anleitung zum Handeln verständlich zu machen, dann haben wir etwas falsch gemacht oder der Diskussionspartner verfolgt ganz anderes als die Über-windung des inhumanen kapitalistischen Systems. Im letzteren Fall ist eine sach-bezogene Diskussion nicht möglich und ist verschwendete Zeit und Kraft.
Worauf sollten sich Kommunisten meiner Meinung nach konzentrieren.
Zunächst sollten Kommunisten ständig an der Vervollkommnung ihres politischen Wissens arbeiten und die Theorie des Marxismus/Leninismus beherrschen. Ein Kommunist muß in der Lage sein, bei sich ändernden Bedingungen und unerwarteten Ereignissen ohne auf Anleitung von den führenden Organen warten zu müssen richtig zu entscheiden und zu agitieren und zu handeln.
Als zweites sollte ein Kommunist überall zur Verbreitung marxistischen Wissens beitragen, dabei besonnen argumentieren und nicht als Schulmeister auftreten. Er sollte auch zuhören können.
Drittens sollte Solidarität mit anderen Angehörigen seiner Klasse eine Selbst-verständlichkeit sein. Das betrifft insbesondere auch die Solidarität mit den Kämpfen der Arbeiter und Bauern in den von den führenden Industriestaaten in kolonialähnlicher Abhängigkeit gehaltenen Ländern.
Viertens sollten Kommunisten sich in den Gewerkschaften engagieren. Wenn auch die Gewerkschaften in unserem Lande nicht für die Überwindung des kapitalistischen Systems kämpfen, so sorgt doch ihr Wirken dafür, dass die Willkür des Kapitals sich nicht ungebremst austoben kann. Außerdem sind die Gewerkschaften die Organisation, in der noch die meisten Arbeiter organisiert sind. Und was ganz wichtig ist, ihre Organisation erfolgt auf betrieblicher Basis. Hier kann das Verbot parteilicher Tätigkeit in den Betrieben umgangen werden.
Fünftens müssen sich Kommunisten unbedingt für die Überwindung der organisatorischen Zersplitterung engagieren. Das ist ein äußerst diffiziler Prozess, der auf viele historisch sich herausgebildete Vorbehalte stößt. Aber er ist unumgänglich. Die äußere Form ist nicht entscheidend. Dieser Prozess kann durch den Zusammenschluß mehrer Parteien und Organisationen zu einer neuen Partei geschehen. Er kann durch das Aufgehen einiger in einer anderen geschehen. Und er kann durch Bildung einer Dachorganisation geschehen, in der die einzelnen zur Zeit bestehenden Organisationen gleichberechtigt vertreten sind und aus der heraus durch kameradschaftliche Zusammenarbeit sich schließlich eine wirkliche Einheit entwickelt. Das alles ist ein mühsamer Weg, auf dem es viele Stolpersteine gibt. Aber es gibt keinen anderen.
Lassen wir uns nicht beirren. Die Perspektive der Menschheit kann nicht im Kapitalismus liegen, einfach schon deshalb nicht, weil er die lohnabhängig Beschäftigten von der Entscheidung über die für den Menschen wichtigste Funktion ausschließt, die ihn vom Affen unterscheidet, nämlich über die Arbeit .
Dieter Hainke
Magdeburg
René McDavis
Quebecisches Tagebuch im Herbst 2009
Fitch-Bay, QC, Oktober 2009
Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, es kömmt aber darauf an, sie zu verändern. (Karl Marx)
Es ist finstere Nacht in Fitch-Bay. Schwerer Regen fällt unermüdlich und verdüstert den heuer rasch verglühenden kanadischen Indianersommer. Stürmischer Wind kommt auf.
Pierre Falardeau, der populäre quebecische Filmemacher und Polemiker, ist tot. Die Stimme des separatistischen Sprechblasenjongleurs ist verstummt.
Pünktlich zum 8. Jahrestag des Kriegsbeginns gegen Afghanistan verkündet das francophone Abendprogramm „Obamas Dilemma“. Ihm drohe ein neues „Vietnam“. „Mission Impossible“ lautet jetzt das neue Leitmotiv. Die Kanadier lehnen das „Engagement“ am Hindukusch schon lange ab. Aus Popularitätsgründen sieht sich die hiesige Rechts-Regierung daher gezwungen, einen Truppenabzug bis 2013 anzuvisieren. Da muss die Schweinegrippe (H1N1) den Menschen nochmals dringend als Besorgnis Nummer 1 ans Herz gelegt werden. Der Pharmaindustrie kommt die Impfkampagne der Regierung sehr gelegen. Gegen den Antikriegsvirus hilft am Ende allerdings kein Impfstoff mehr. Er wird sich weiter ausbreiten, weltweit. Weder der um sich greifende Drogenkonsum, der derzeit noch unsere Jugend lähmt, noch die schlimmen Ausmaße der I-Pot-Seuche, die schon die Vorschulkinder ihrer natürlichen Neugier beraubt, noch die Faszination der Netze können auf Dauer den aufkeimenden Widerstandswillen brechen. Im Gegenteil, sie werden ihn blitzschnell um die Welt tragen helfen. Wissen ist „in“, Entertainment ist „out“ - Pädagogik ist gefragt, aufklärende Propaganda dringend von Nöten.
Das frankophone Regionalblättchen „Le Devoir“ verkündet dagegen, statt aufzuklären über die wahre Bedeutung des EU-Vertragsungetüms, das herbeigezwungene „Ja“ von über 67% der Iren beim zweiten Votum über den Lissabon-Vertrag sei ein „positives Signal für Europa“. Vermeldet wird allerdings auch erleichtert, dass sich ein „unkriegerischer Fortgang in Sachen Iran“ abzeichne. Vom Militarisierungsgebot der „EU-Verfassung“, ist auch in dieser Zeitung keine Rede. Viele Bürger stellen sich hier wie andern Orts das geeinte Europa noch immer als Gegenpol zur Übermacht USA vor, sie ahnen nicht die von jenseits des Atlantik heraufziehende Gefahr.
Die „Globe and Mail“, Zeitung des „ROC“, des restlichen Kanada also, ist trotz ihres üppigeren Formats noch dürftiger an informativem Gehalt. Bildzeitungsartiger Tenor: „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch gleichgeschlechtliche Avancen bei Frauen im Kommen“ und „Präsident Harper punktet durch einen Auftritt als Sänger und Pianospieler“.
Dank globaler Vernetzung erreichen uns hier am Memphre-Magog-See, in der Provinz der Provinz, ab und an recht halbherzige Nachrichten aus der dem Frieden verpflichteten Szene in Good Old Germany. Nur vage scheint man sich in deutschen Landen an den Jahrestages des Kriegsbeginns im Oktober 2001 gegen ein armes ausgeblutetes Land in Asien zu erinnern oder an die Umstände, die vor nunmehr acht Jahren schon das kriegerische Vorgehen haben durchsetzen helfen. Obwohl doch auch dort die Antikriegstimmung sich zumindest in Meinungsumfragen deutlich prononciert.
Der Ausgang der Bundestagswahl in der Bundesrepublik, ein deutliches Erstarken der Rechten, verharmlosend „Tigerente“ genannt, trägt damit dem Wollen der Bürger kaum Rechnung. Ein solches Ergebnis ist eben, wie über all, der Schwäche und Zersplitterung der Opposition geschuldet. Woran es eben fast überall mangelt, ist eine klarsichtige Analyse und der damit einhergehende, notwendige Mut, die Dinge bei ihrem wahren Namen zu nennen. Die Bereitschaft, Namen zu nennen und Partei zu ergreifen, ist die erste große Grundvoraussetzung für einen echten Wandel.
In Griechenland manifestiert sich dies gerade in einer nur scheinbar paradoxen Manier, nämlich in einem überwältigenden Sieg der sozialdemokratischen PASOK. Dort gibt es aber auch eine wegweisende, kämpferische Partei, die immerhin drittstärkste Kraft im Lande ist und bleibt. An ihrer Spitze steht eine kleine Frau mit Namen Aleka Papariga. Es handelt sich um die kommunistische KKE. Diese Partei ereichte immerhin 7,5 Prozent der Wählerstimmen. Trotz ihrer zahlenmäßigen Schwäche ist ihr der Wahlerfolg der Sozialdemokraten zu verdanken. Es ist zu hoffen, dass die Menschen dies begreifen. Das überraschende Ergebnis ist vor allem den griechischen Kommunisten geschuldet, gerade weil diese den Sozialdemokraten der PASOK ihre Schwächen nicht durchgehen ließen, sondern sie heftig darob attackierten. Der griechische Wahlerfolg der gemäßigten Linken ist gegenläufig zum Rechtstrend im übrigen Europa, auch weil die Griechen ein politisiertes, aufgeklärtes Volk sind. Sie wählten allerdings pragmatisch. Sie wollen die kleinstmöglichen Besserungen jetzt. Aber wie die Geschichte lehrt, kann die Politik der kleinen Schritte unter gewissen Umständen auch Großes befördern helfen. Voraussetzung dafür ist, das eine Kraft vorhanden ist, die Klarheit ausstrahlt und die orientierend wirkt.
Bevor aber in globalem Ausmaß die heilsamen Kräfte wieder erstarken können, bedarf es nicht nur einer solchen neuerlichen Klarheit in der Analyse weltweit, sondern noch stärkerer Erschütterungen, als wir sie bereits zu verzeichnen haben..
In der Ruhe und Wohlhäbigkeit der kanadischen Provinz Quebec äußert sich dazu der autonome kanadische Forscher und Gallilei-Experte am Centre Interuniverstitaire de Recherches sur la Science et la Technologie (CIRST) Raymond Fredette folgendermaßen: In der gegenwärtigen Bedrohung der Umwelt durch den Menschen und in der unkontrollierten demografischen Entwicklung liegt eine Hauptgefah-renquelle für das Überleben der Gattung, das gleiche gilt für das wahnsinnige Wüten des herrschenden, völlig unkontrollierten Finanzkapitalismus. Grundsätzlich sieht er die Menschheit in der Lage, sich aus der Sackgasse zu befreien, in die diese sich selbst hinein manipuliert hat. Der Mensch verfügt über die technischen und wissenschaftlichen Mittel für eine erfolgreiche Umkehr, die das Schlimmste verhindern kann. Woran es derzeit mangelt, sind die dafür erforderlichen sozio-politischen Voraussetzungen.
Was also tun? Oder anders, persönlicher gefragt, was tut der nach einer Wende zum Guten hin gierende ältere Mensch in solch schwieriger Lage? Er behält seinen Humor, er bewahrt seinen humanistischen Optimismus und er betätigt sich zum Beispiel künstlerisch und spiegelt so den Zustand des Menschengeschlechts. So etwa die Malerin Monique Girard und so manche ihrer Kolleginnen und Kollegen in Kanada. Hierzulande wird Kunst immerhin noch mit humanistischem Gehalt in Beziehung gebracht. Oder der Mensch vertieft sich in seine Spezialstudien, er meditiert und betätigt sich humanitär, etwa bei „ATD/Quart Monde“* Er raisonniert und sammelt all sein akkumuliertes Wissen, er publiziert, um die jungen Generationen nicht ganz schutzlos der Gier der Wenigen auszuliefern. Letztere sind schließlich im Begriff die Erde endgültig zu ruinieren. Davor fürchtet man sich in einem so naturreichen und schönen Land wie Kanada vielleicht noch mehr denn anderswo, gerade weil es sich hier noch ganz gut leben lässt.
Welche Wege aber führen aus der Gefahr, vor der man sich eben auch in den kanadischen weiten Wäldern nicht mehr verkriechen kann?
Erforderlich dafür sind die Aneignung von Wissen, eine moralische Sensibilität und die Bewusstheit darüber, dass die zerstörerischen Vorgänge in der Natur und in der Gesellschaft vom Menschen gemacht und damit reversibel sind.
Kundige, moralisch zuverlässige Fährtenleser sind erforderlich! Alte Karten müssen neu studiert werden. Die Zuversicht darüber, dass ein Ausweg möglich ist, muss bewahrt bleiben.
Hoffnungsschimmer dringen bis in die Waldeinsamkeit. Sie überwinden auch die dichteste Regenwand. Sie sind verkörpert etwa im revolutionären Lateinamerika. Während hier der Herbst verglüht, herrscht dort schon der Frühling.
Während hier Behäbigkeit regiert, spitzt sich die Situation auf der südlichen Hälfte des Kontinents im Augenblick dramatisch zu. Sieben neue Militärbasen plant das Imperium in Kolumbien, seinem letzten treuen Vasallen im einst komplett beherrschten Hinterhof. Die Rede des venezuelanischen Präsidenten Hugo Chavez vor der 64. Generalversammlung der Vereinten Nationen ist das Beste, das dieser Herbst außer der herrlichen Farbenpracht bis dato hierher gezaubert hat.
Die Rede will studiert sein. Sie macht Mut. Zeugt sie doch von einem außergewöhnlichen kreativen Denkansatz, der die Massen zu inspirieren vermag und fordert damit heraus, aktiv zu werden.
Ähnliches gilt auch für Michael Moores neuen Film „Kapitalismus – eine Liebesgeschichte“. Der Streifen ist ein „Muss“ für alle, die nach Wegen aus der Gefahr suchen.
Noch sind es allerdings vor allem die Völker in der südlichen Hemisphäre des amerikanischen Kontinents, die definitiv nicht mehr bereit sind, ihr Schicksal klag- und fraglos den internationalen Konzernen und Finanzmagnaten auszuliefern. Das kubanische Beispiel wirkt dabei inspirierend. Ein neuer Anlauf zu einer sozialeren Gesellschaftsordnung wird auf dem lateinamerikanischen Glacis derzeit ernsthaft beschritten. Michael Moores Film zeigt im Übrigen auf überzeugende Weise, dass auch im Norden, in „The Belly Of The Beast“, in der Höhle des Löwen also, die Verhältnisse herangereift sind, die den Willen zum Widerstand neu entfachen. Moore fordert entschieden dazu auf, dem Kapitalismus überall da Paroli zu bieten, wo er uns am Härtesten trifft. Er tut dies auf eine kreative, liebevolle Weise. Organisation und Mobilisierung sind dabei seine neu-alten Schlüsselideen. Roosevelt ist sein Held. Jesus Christus, die Bibel, aber selbst Stalin und Mao tauchen auf in seinen Bildern, die auf die Historie zurückgreifen. Geht hin, informiert und amüsiert euch und werdet aktiv, wie es euch Michael ans Herz legt.
Noch brennt nicht ganz Südamerika und noch springt das Feuer nicht wirklich über auf den wohlstandsgesättigten Norden, wo die Menschen das Kämpfen für ihre Belange weitgehend verlernt haben. Aber der Funke ist gelegt und kann sehr schnell einen Flächenbrand auslösen.
Warum sonst sollten die Oberen den aggressivsten Antikommunismus aller Zeiten schüren? Warum vor allem in Europa, der einstigen Wiege des Sozialismus, dort wo das macht-und einflußlose Parlament jubiläumsgerecht den „23. August zum Gedenktag an die Opfer totalitärer Regime“ erklärt hat.
Zur Erinnerung: An diesem Tag wurde vor 70 Jahren der Nichtangriffspakt zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschland abgeschlossen, ein Abkommen, das nach dem Münchener Verrat von 1938 der Sowjetunion noch eine Gnadenfrist einräumte, die sie zur Beschleunigung ihrer Verteidigungsanstrengungen zu nutzen wusste. Heute will man die Aggression vergessen machen, die von NAZI-Deutschland ausging und weltweit 60 Millionen Menschenopfer forderte, indem man Opfer und Täter gleichsetzt. Da aber der Schoß noch fruchtbar ist, aus dem das kroch, wird man die globale Erinnerung an die Verursacher der Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht durch eine Resolution des Europäischen Parlaments außer Kraft setzen, ein Parlament, das sich bei einer Wahlbeteiligung von rund 40% kaum einer Legiti-mierung durch die Nationen Europas rühmen kann und das darüber hinaus völlig zahnlos ist, ja das noch nicht einmal über das „Königsrecht“ aller demokratischen Parlamente, das Budgetrecht verfügt.
Immerhin ist es dem kriegslüsternen NS-Deutschland posthum gelungen, zumindest eines seiner Ziele vorübergehend doch noch zu realisieren: Die Beseitigung des ersten sozialistischen Staatengefüges. Die Demütigung und Entmutigung seiner einstigen Bürger und seiner Anhänger weltweit durch eine der entsetzlichsten Niederlagen der Menschheitsgeschichte wirkte lange niederschmetternd. Das „Scheitern“ des Sozialismus und der ihm zugrunde liegenden Ideologie hat in Europa, aber nicht nur dort, die furchtbarsten Wunden gerissen, die allerdings allmählich abheilen.
Zwar ist das Zeitalter der Aufklärung längst überschritten, aber dennoch liegt allein in der Aufklärung auch über in der Vergangenheit begangene Verbrechen die Möglichkeit zu deren Überwindung. Ein Verständnis der historisch-politisch-ökonomischen Zusammenhänge, die zu dem „großen Scheitern“ geführt haben, ist darüber hinaus erforderlich. Nicht postmoderne Beliebigkeit liefert den Schlüssel zur Befreiung aus dem Elend des Menschengeschlechts. Die große Chance auf unser Überleben als Gattung liegt allein in der wirklichen radikalen Aufklärung: „Seien wir Realisten, Versuchen wir das Unmögliche“ (Che).
Die Zersetzung der einst wegweisenden, wenngleich in großen Teilen der Erde schon einmal erfolgreich umgesetzten Theorie der Arbeiterbewegung und die Unterminie-rung aller Organismen, die sie im Laufe eines Jahrhunderts hervorgebracht hat, ist und bleibt der vorerst schwerste Schlag, den ihr Gegner hat austeilen können. An dessen Verfeinerung wird natürlich weiter gearbeitet. Solange aber die ausgebeuteten Massen ihre Lage nicht erkannt haben, solange sie geschichtslos, die gängigen Rechtfertigungsmuster für ihre Niederhaltung noch zu schlucken bereit sind, solange ist wenig Hoffnung. So lange sich daran nichts ändert, sind wir der weiteren Militarisierung, der Entdemokratisierung, Umweltverheerung, der Ausweitung der Kriege in globalem Maßstab ausgeliefert. So lange, aber eben nur so lange, werden wir die mit den Militärinterventionen täglich einhergehende Verschlechterung unseres Lebensstandards ertragen müssen. Erst wenn genügend junge Menschen aufwachen und wirklich aufbegehren, wenn sie sich auf die Suche machen nach Rezepten für ein neues Menü, entsteht wieder neue Hoffnung und auf globale Besserung. Bei solcher Suche werden die intelligenten jungen Leute unvermeidlich auch auf historische Vorbilder stoßen. Wenn sie beharrlich genug vorgehen, werden sie entdecken, wie sehr man uns Alte genasweist hat. Sie werden, falls die Zeit dann noch reicht, entdecken, welch raffinierte Methoden angewandt werden mussten, um das einst großartige und erfolgreiche Modell der Sowjetgesellschaft in Grund und Boden zu denunzieren und es schließlich mit Hilfe trojanischer Pferde von innen heraus zu zerstören, um es am Ende zu beseitigen. Es handelt sich bei dem Wissen darum, wie solches geschehen konnte, um eine unendlich wichtige Goldader, die es auszuschöpfen gilt. Anhand von diesem Gold nämlich werden die nachkommende Generationen lernen, auf welche Weise es schon einmal innerhalb kurzer Zeit gelungen ist, ein großes Land vom Mittelalter in die Neuzeit zu führen und damit den Lebensstandard und vor allem das geistige Niveau seiner Bürger beträchtlich anzuheben. Kuba, China und auch Nordkorea können einiges lehren, aber längst nicht alles, was es darüber zu wissen gibt. Zumindest müssen wir damit aufhören, diese alternativen Ordnungsansätze anzuprangern, anstatt ihre Bemühungen zu unter-stützen.
Die Begeisterung junger Menschen beim Aufbau einer neuen Ordnung in den 20iger und 30iger Jahren des vorigen Jahrhunderts war anders als es später je wieder der Fall sein sollte, außerordentlich groß. Der Heldenmut schließlich, mit dem die Bürger der Sowjetunion ihr Land gegen den Aggressor Nazi-Deutschland und seine Verbündeten (Italien und Japan) erfolgreich verteidigt und die Völker angrenzender Staaten vom Faschismus befreit haben, war vermutlich historisch einmalig. Um so mehr Grund hatten jene Kräfte, die den Erfolg des Sozialismus um den Preis ihres eigenen, von der Geschichte vorgegebenen, Untergangs nicht dulden konnten, Listen auszutüfteln, mithilfe derer sie das sowjetische Volk und damit die Erdenbürger um diesen opferreichen Erfolg würden bringen können.
In Deutschland haben diese Kräfte bekanntlich im revolutionären November 1918 die Parole ausgegeben: „Schlagt ihre Führer tot“. Die „aus dem Felde unbesiegt“, aber geschwächt heimkehrenden Totschläger brachten es immerhin noch fertig, vielen Humanisten, Demokraten und Kommunisten genau wie den unvergessen, mutigen Kriegsgegnern Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, einen verfrühten, gewaltsamen Tod zu bescheren. Im Frühjahr 1933, als die revolutionäre Linke schon wieder bedrohlich erfolgreich bereit stand, entfachten die, von gewissen Industriekonzernen großzügig finanzierten Nazis ein Reichstagsfeuer und beschuldigten daraufhin ihre Gegner der Brandstiftung. Das war der Auftakt nur für ihr entsetzliches Wüten, das schließlich in ein zweites Völkermorden führen sollte und das sechs Jahre lang währte.
Die ersten KZs wurden für „politisch unzuverlässige Elemente“ errichtet. Zehntausende „Schutzhäftlinge“ wurden an solchen Orten oder in Zuchthäusern gemartert. Viele wurden trotz der Einsprüche aus aller Welt nach jahrelangem Martyrium schließlich doch ermordet, wie etwa der Reichstagsabgeordnete Ernst Thälmann oder die jüdische Internationalistin und junge Mutter, Olga Benario. Und dennoch trotz Auschwitz und trotz der Drohungen mit Atom- und Wasser-stoffbomben, die auf Japan nieder geworfen der Sowjetunion galten, trotz alledem, das bessere Gesellschaftssystem siegte. Weltweit waren die Menschen durch den Sieg über den Faschismus ermutigt und widersetzten sich in Scharen den Imperatoren. Die jetzt legalisierten kommunistischen Parteien erstarkten überall, nicht nur in Osteuropa. In Frankreich etwa traten sie in die Regierung ein. Die Befreiungs-bewegungen waren weltweit auf dem Vormarsch. Nur der Einsatz brutalster Gewalt vermochte sie mancherorts eine große Weile niederzuhalten.
Währenddessen wurden die Vereinten Nationen 1945 aus der Taufe gehoben, an deren bis heute wertvollen Charta die SU maßgeblich mitgewirkt hat. 1949 wurde die Volksrepublik China gegründet, das arme angrenzende Land Korea aber zur Hälfte in die Steinzeit zurück bombardiert. Solches geschah im Namen der Freiheit (des Kapitals) von Seiten der „demokratischen“ Amerikaner, die sich dazu durch die UN ermächtigt fühlten. Die SU hatte aus Solidarität mit Rotchina vorübergehend ihre Mitarbeit im Sicherheitsrat eingestellt und so auf ihr Vetorecht verzichtet. Die anderen wussten ihre Chance gut zu nutzen. Aber der „heiße“ Krieg gegen die „dirty commies“, auch Roosevelt galt ihnen als ein „dreckiger Kommunist“, war auf diese Weise nicht zu gewinnen. Überall erstarkte unaufhaltsam der Widerstand. Die UdSSR begann rasch mit dem Wiederaufbau ihres durch den Krieg verheerten Landes. Dank internationaler Solidarität und mithilfe fähiger Wissenschaftler war man schneller als das vom eben noch alliierten Gegner erwartet wurde, bald in der Lage, auch die bedrohlichen Bomben zu bauen und einen neuerlichen Angriff damit abzuschrecken. In dieser Situation musste der antisowjetische Block anders vorgehen, wollte er das verhasste Sowjet-„Regime“ stürzen. Der „Kalte Krieg“ wurde erfunden und mit harten Bandagen geführt, wie gesagt, auch mit Bomben und Bajonetten in gewissen Teilen der Erde. Solange aber die Fronten klar erkennbar blieben, solange hatten die Gegner des Menschengeschlechts keine Chance zu siegen. Genau dieses galt es also zu ändern. Davon Kenntnis zu haben, scheint unerlässlich für jeden zum dauerhaften Erfolg führenden Neubeginn.
Im Laufe der Anfangsjahre des Kalten Krieges starben erneut rasch hinter einander nicht nur bedeutende Führungspersönlichkeiten einen verfrüht Tod. Es gelangten Persönlichkeiten in Führungspositionen, die weder die intellektuelle, noch die ethische Reife dafür besaßen, noch über die nötigen Kenntnisse verfügten, um den Anforderungen, die die Zeit und ihr Amt an sie stellten, gerecht zu werden. Die Leistungen von Menschen, die das Volk liebte und erehrte, weil sie Wegweisendes hatten schaffen helfen, wurden nicht nur herabgewürdigt, sie wurden nachgerade dämonisiert. Ihre Anhänger wurden in Lager verbracht, vormals Verurteilte wurden ohne Neuüberprüfung der gegen sie erhobenen Anschuldigungen freigelassen. Es wurden wissenschaftliche und juristische Standards preisgegeben, gravierende Fehl-entscheidungen administrativ verfügt. Die Meinung des Volkes war immer weniger gefragt. Am schlimmsten aber war, dass man auf Seiten des Sozialismus die Gefahren, die vom gegnerischen Gesellschaftssystem ausgingen, allmählich immer mehr verharmloste, eine notwendige Folge der Preisgabe einer am wissen-schaftlichen Sozialismus orientierten Analyse.
Das diskursive Niveau verarmte, Tabus wurden errichtet, Demagogie und damit Sprechblasen ersetzten die genaue Befassung mit Realitäten. Mitte der 50iger Jahre gab es bekanntermaßen in der Bundesrepublik Deutschland an die Zehntausend Ermittlungsverfahren gegen wirkliche oder vermeintliche Kommunisten. Menschen, die schon zu NS-Zeit wegen ihres Widerstandsgeistes eingesessen hatten, wurden erneut kaserniert, während völkerrechtlich verurteilte NS-Übeltäter schon wieder auf freiem Fuße waren und gegen andere die Ermittlungen gar nicht erst aufgenommen wurden, ja manche bekleideten wie der Rassenkommentator Globke bereits wieder hohe Staatsämter. Die repressiven Maßnahmen richteten sich vor allem gegen die konsequentesten Gegner der Wiederausfrüstung der Bundesrepublik und ihrer Eingliederung in die NATO.
Der Antikommunismus wurde überall, aber vor allem in Westdeutschland und in den Vereinigten Staaten von Amerika, zur alles beherrschenden Staatsdoktrin.
Der Nobelpreisträger für Literatur, der bürgerliche Schriftsteller Thomas Mann, hatte ihn einst im amerikanischen Exil „die Grundtorheit der Epoche“ genannt, weshalb man auch ihn ins McCarthy-Visier nahm. Vom Betrachterwinkel der Herrschenden aus, war die Doktrin aber alles andere als töricht. Mit seiner Hilfe gelang es nämlich im Laufe von Jahrzehnten das große humanitäre Erbe der Arbeiterbewegung, ihr Gedankengut, ihre Errungenschaften in den Schmutz zu treten, sie als anti-demokratisch, den Menschenrechten feindlich, darzustellen, Das Erbe wurde perver-tiert und ins Gegenteil verkehrt. Solches zu erreichen, bedurfte es natürlich enormer finanzieller und personeller Anstrengungen, aber wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg, zumal bei denen, die nicht mehr wissen, wo sie ihren Surplusprofit noch gewinnbringend anlegen können.
20 Jahre nach dem Ende der DDR erleben ein wir ein neuerliches Aufflammen des aggressivsten Antikommunismus. Pünktlich zum Jubiläum erscheint etwa der Streifen „Katyn“ des polnischen Regisseurs Wajda. Wer bis dato noch an die Mär glaubte, dass die Rote Armee die ihr zur Last gelegten Massaker begangen hat, dem sollten jetzt angesichts solcher Propagandaorgien ernsthafte Zweifel kommen. Auch Geschichte ist schließlich käuflich in einer Zeit, wo alles zur Ware geworden ist.
Der Regen hat aufgehört. Draußen tagt es. Vor meinem Fenster glüht rot der Ahorn.
Michael Moores Film endet mit einer modernen Version der „Internationalen“, ein Impuls, der junge Menschen vielleicht ermutigen wird, zu googeln oder tiefer zu recherchieren und sich der großen Geschichte der „Internationalen“ und ihrer Helden neugierig geworden zuzuwenden.
P.S. Der eben annocierte Friedensnobelpreis für einen gerade ins Amt gelangten US-Präsidenten, ein Land das der Welt seine Kriege aufzwingt, löst hier ungläubige Zweifel, ja Entsetzen darüber aus, wie weit Eliten der Realtitätsblindheit verfallen können. Es gilt daran zu erinnern, dass eine ganze Weile lang dieser Preis nicht verliehen wurde, während des 2.Weltkriegs nämlich.
René McDavis,
Kanada
•Die NGO/ „Aide a Toute Detresse“, dt. Hilfe in allen Notlagen, gegr. 1957, hat ihren Ursprung in Frankreich und wurde vom Priester Joseph Wrsesinksi, einem Antifaschisten, gegründet. Zusammenarbeit mit UNESCO und UNICEF sind eine ihrer Säulen.
Ervin Rozsnyai
War es noch zu früh?
Aus Ervin Rozsnyai: Warum man es beim rechten Namen nennen muss. (Miért kell nevén nevezni?, Budapest 2007). Aus dem Ungarischen übersetzt von E. Kornagel
War es noch zu früh ?
Den Fall des „real existierenden Sozialismus“ schreiben Widersacher und Feinde des Sozialismus der Lebensunfähigkeit der sozialistischen, gesellschaftlichen Einrichtung zu. Andere geben dafür subjektive Faktoren als Gründe an: „die Verbrechen Stalins“, „der Verrat des Gorbatschow“ usw. Wären der Charakter, die Psychologie, die Moral, die Denkweise der führenden Person oder Gruppe eine andere gewesen, wenn unwürdige Hände den Sozialismus nicht verderbten und beschmutzten, nähme die Geschichte einen anderen Verlauf. Viele nennen objektive Faktoren als Gründe für den Sturz: Wirtschaftliche und kulturelle Zurückgebliebenheit, internationale Isolation, die Bedingungen der Unreife und ungünstigen Konjunktion. Also, war der Fall unvermeidlich? Aber was hätte man dann tun sollen: die Revolution in reifere Zeiten aufzuschieben? Sollen die Soldaten nur in den Schützengräben ohne Sinn umkommen, solange weiter zu Millionen verwesen, solange nicht mit geeichten Instrumenten das Vorhandensein aller Bedingungen für die Revolution nachgewiesen ist? Solange aber soll die Macht Kerenski, Koltschak, den Weißen gehören? Natürlich können wir die Sache auch so auffassen, dass man zum Zeitpunkt des Ausbruchs der russischen Revolution auf ähnliche Bewegungen der Arbeiter der westlichen Länder zählen konnte, auf den gemeinsamen entscheidenden Sturm auf den Kapitalismus der Mehrheit des europäischen Proletariates oder seiner bestimmenden Abteilungen; in einem solchen Zusammenhang war die russische Revolution als Teil der gleichzeitig in mehreren Ländern aufflammenden Weltrevolution durchaus eine weder zu frühe noch eine von vornherein zum Durchfall(en) verurteilte Unternehmung. Nachdem jedoch im Westen die erwartete Revolution erlosch, blieb für Räterußland eine einzige Alternative: Entweder sich freiwillig den nach Rache dürstenden Bourgeois und Grundherren auszuliefern, oder alle innere Kraft zusammennehmend allein mit dem sozialistischen Aufbau zu beginnen. Eine Aufgabe ohne Aussicht auf Erfolg behaupteten Viele vom Letzteren. Aber dann hätte man sich entweder der abenteuerlichen Politik des Exportes der Revolution (mit den bewaffneten Kräften des in den Interventions- und Bürgerkriegen ausgebluteten Sowjetlandes den sich stabilisierenden Weltkapitalismus anzugreifen) oder aber der Waffenstreckung zuwenden müssen, damit anerkennend, dass die Revolution verfrüht war, man sie gar nicht erst hätte beginnen dürfen. Damit sind wir wieder zurück am Ausgangspunkt des Gedankenganges.
War es doch zu früh? Sie erblickte das Tageslicht in einem zurückgebliebenen, halbfeudalen Land – im Gegensatz zu den entwickelten westlichen Ländern – die materiellen Produktionsbedingungen des Sozialismus waren kaum vorhanden. Aber in gewisser Beziehung bot selbst die Zurückgebliebenheit für die Revolution bessere Aussichten auf Erfolg als der entwickeltere Westen. In Rußland existierte keine beachtenswerte Arbeiteraristokratie, es gab eine revolutionäre Partei (damals einmalig in der Welt!), die Bauern aber, welche mehrfach ausgebeutet und bereits im dritten Jahre sinnlos in die Schützengräben getrieben, schlossen sich der Revolution an. Die Konjunktion der Bedingungen zum Beginn der Revolution war also außerordentlich günstig. Ein anderes Thema ist, daß später bei der Aufbauarbeit die Zurückgebliebenheit und die Einkreisung des Landes unverhältnismäßig große Schwierigkeiten verursachten.
Deshalb sagte Lenin, daß in Rußland der Anfang leichter war, die Fortsetzung aber schwerer sein wird, anderwo, in den entwickelten Ländern wird der Anfang schwerer, die Fortsetzung leichter sein. Vom Gesichtspunkt des Anfanges war die russische Revolution durchaus nicht verfrüht: Sie begann im rechten Augenblick; fortsetzen wiederum kann man nur das, was begonnen wurde. [2](1)
Die zu beweisende Lebensunfähigkeit wird häufig mit dem Hinweis darauf verbunden, daß die einstigen sozialistischen Länder in Bezug auf Produktivität und Effektivität weit hinter den führenden kapitalistischen Ländern zurückblieben. Indes in weiterem Zusammenhang und aus größerer Zeitperspektive betrachtet verhält es sich nicht ganz so mit der Sache. Das Kapital entwickelt sich in blutigen Widersprüchen: Je glänzender seine technischen Siege bei der Unterwerfung der Natur sind, desto so weniger gelingt es ihm, die von ihm selbst in der Gesellschaft und in der Natur verursachten Katastrophen zu beherrschen. Die Ergebnisse der Arbeitsproduktivität sind wirklich überwältigend, wenn wir die Produktivität allein als technisches Verhältnis der Natur gegenüber auslegen und die während einer Einheitszeit hergestellten Gebrauchswerte mit ihren quantitativen und qualitativen Kennziffern messen. Wirtschaftliches Tun erfolgt aber unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen und kann nicht von diesen abstrahiert, allein vom technischen Gesichtspunkt her beurteilt werden. Wir hätten ein realeres Bild von der durchschnittlichen Produktivität und vom Wirkungsgrad unter kapitalistischen Verhältnissen verrichteter Arbeit, wenn wir die vom Gesichtspunkt der Massen der Bevölkerung, also vom Gesichtspunkt der Volkswirtschaft, nicht der Betriebs-wirtschaft unproduktiven Kosten von Profitjagd, Konkurrenz, Marktbeherrschung usw. vom Ergebnis der gesellschaftlichen Gesamtleistung abzögen bzw. zu seinen Kosten dazurechneten. Das Ergebnis der Gesamterzeugung bezögen wir nicht einfach nur auf die von den tatsächlichen Teilnehmern der Produktion verbrauchte Arbeitszeit, sondern berücksichtigten die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung zusammen mit den Arbeitslosen, deren potentielle Arbeitszeit und Arbeitskraft mit Nullleistung vergeudet wird, die aber ohne Zweifel Teil der gesellschaftlichen Arbeitszeit, des Arbeitskraftfonds sind. Ein noch realeres Bild erhielten wir dann, wenn wir die so ermittelte Durchschnittsleistung auf längere Zeitabschnitte bezögen, die Verluste von Rückfällen oder Krisen dabei nicht außer Acht ließen; ein wirklich reales aber dann, wenn wir die Kriegszerstörungen, die Zeitkosten für den Wiederaufbau, das Elend, die Diskriminierungen, die Umweltverschmutzung und die von vielerlei Verbrechen und Gemeinheiten verursachte Zerstörungen ebenfalls mitrechneten. Was haben wir von der hohen Produktivität der kapitalistischen Zentren, wenn diese Verhältnisse hervorrufen, die blutig in Weltkriege ausartende imperialistische Zusammenstöße zur Reife bringen und ganze Kontinente lebendig verwesen lassen? Die Vorteile und die Nachteile können nur in historischer und systembetrachtender Annäherung beurteilt werden; aus ihren Zusammenhängen herausgerissene Einzeldaten ergeben keine objektive Information.
Bei der Abwägung der Vorteile und Nachteile darf man nicht die paradoxe, widersprüchliche Natur der kapitalistischen Akkumulation außer Acht lassen. Das Kapital revolutioniert die Produktivkräfte unaufhörlich; aber es steht auch ihrer Entwicklung im Wege, weil es dem größeren Profit zuliebe die lebendige Arbeit vermindert, das verhältnismäßige Gewicht der alleinigen Quelle des Profites im Arbeitsprozeß, die Profitrate mit wachsender Kraft herunterdrückt (das Verhältnis des Profites zum angelegten Gesamtkapital). Der Zwang zur Akkumulation, der Wettbewerb, der nie zu befriedigende Profitbedarf spornen das Kapital zur wiederholten Steigerung der Produktivität an – was wiederum Arbeitskraft von neuem überflüssig macht und weiter die fallende Tendenz der Rate verstärkt. Zum Ausgleich der ungünstigen Tendenz zerrt das Kapital immer neue proletarisierte Massen in die Erzeugung von Profit, mit der Ausweitung und Verschärfung der Ausbeutung hält es sich selbst für den Verlust schadlos, den es sich selbst verursachte bei der Jagd nach dem Profit mit dem Hinauswurf überflüssig gewordener Arbeitskräfte. Auf diesem widersprüchlichen Wege gelangte es bis zur wissenschaftlich-technischen Revolution unserer Tage, bis zu seiner die Produktivität ohne Beispiel beschleunigenden und stabilisierenden Revolutionierung, welche mit der Automatisierung, mit der engen Verbindung von Wissenschaft und Produktion die Lücke zwischen den verschiedenen Gebieten der Arbeitsteilung und ihren Niveaustufen verengt, aber als Instrument der Monopole erweitert es zur gleichen Zeit diese Lücke, weil es die Arbeitskraft massenhaft entwertet, und zur Einverleibung billiger Arbeitskraft die äußeren und inneren Peripherien zur fortwährenden Ausweitung anspornt. Die traditionelle großbetriebliche Arbeiterschaft an den Peripherien wächst, in den Ländern des Zentrums vermindert sie sich in absoluten Zahlen: Ihre abgestoßenen Elemente vermehren größtenteils das Lager der chronischen Arbeitslosen, oder sie zerstreuen sich auf den von der Arbeiterbewegung schwer organisierbaren Gebieten der Heimarbeit und der Dienstleistungen. In diesem sich gesetzmäßig beschleunigenden Verfall, welchen wir eben nur vereinfacht andeuteten, paart das Kapital schandvoll seine glänzenden wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften mit bar-barischer Gewalt, Verbrechen, Drogenkonsum, den stinkenden Tümpeln des moralischen Verfalls, erstickt es fast im eigenen Fett und kann sich auf nichts anderes gründen als auf das an der Baumrinde nagende Elend. Je mehr man geschichtlich die proletarische Revolution auf später verschiebt, in einem desto elenderen Zustand werden die von der Fäulnis angesteckten verkrüppelten Massen sein, mit welchen man dereinst wird beginnen müssen, gemeinschaftliche, auf dem gesellschaftlichen Besitz der Produktionsmittel gegründete Verhältnisse zu bauen.
Und dabei haben wir noch nicht mal davon gesprochen, daß im Zeitalter nuklearer Waffen um die Neuaufteilung der Welt geführte Kriege das Leben auf der Erde auslöschen könnten, noch bevor eine Revolution die Wurzeln des Imperialismus ausmerzen kann.
War es zu früh? Hätte man es auf später verschieben sollen? Die Geschichte stellte im Jahre 1917 nicht diese Frage. Sie fragte auch nicht, sondern befahl: Jetzt! Jetzt sofort, weil es morgen schon zu spät sein wird!
Ervin Rozsnyai
Budapest
Gerhard Feldbauer
Zwischen Revisionismus und flexibler Außenpolitik - Die schillernde Karriere des Nikita S. Chruschtschow
Am 14. Oktober 1964 wurde Nikita S. Chruschtschow (1894 -1971) als Partei- und Staatschef abgesetzt. Am 13. September 1953 war er an Stelle des bis dahin amtierenden Georgi M. Malenkow (1902-1988) zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU und damit zum Nachfolger des am 5. März des Jahres verstorbenen Josef W. Stalin (1879-1953) als Parteichef gewählt worden. Seine elfjährige Amtszeit war von einer widersprüchlichen, bis heute umstrittenen Entwicklung gekennzeichnet. Er versuchte, die starren Fronten des kalten Krieges durch flexible Methoden in der Außenpolitik zu durchbrechen, verabsolutierte dabei die Politik der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen, höhlte sie als Form des Klassenkampfes aus. Damit einher ging die Verallgemeinerung eines friedlichen parlamentarischen Weges zum Sozialismus.
Zur Begründung seiner Absetzung wurden der sich verschärfende Konflikt mit der VR China und eine verfehlte Wirtschaftspolitik bekannt. Die Auswirkungen seiner elfjährigen Amtszeit waren jedoch bedeutend tiefgreifender und wurden umfassend erst mit dem Untergang der UdSSR und des von ihr angeführten Sozialistischen Blocks in Osteuropa sichtbar. Chruschtschow ebnete Erscheinungen des Revi-sionismus in den an der Regierung befindlichen kommunistischen Parteien Ost-europas als auch in den kapitalistischen Industriestaaten den Weg. Lassen wir die Fakten sprechen.
Versöhnung mit Titos Revisionismus
Josip Broz Tito (1892-1980), der als Generalsekretär der KPJ an der Spitze des Widerstandes gegen den Faschismus und für die Befreiung Jugoslawiens stand, schlug nach 1945 einen revisionistischen Kurs ein. Unter den Bedingungen des einsetzenden kalten Krieges schloss er mit den USA ein „Abkommen über gegenseitige Verteidigungshilfe“. Während des Bürgerkrieges in Griechenland sperrte Jugoslawien 1949 die Grenze für die Partisanen, ließ sie für die reaktionären Truppen Athens dagegen offen. 1952 wurde die KPJ in einen Bund der Kommunisten Jugoslawiens umgewandelt. 200.000 Mitglieder, die sich auf marxistisch-leninistischen Positionen widersetzten wurden ausgeschlossen, 30.000 verhaftet Im August 1953 bildete Jugoslawien mit den NATO-Staaten Türkei und Griechenland den gegen die UdSSR und die sozialistischen Staaten Osteuropas gerichteten militärischen Balkanpakt (1958 erklärte Jugoslawien seine Mitgliedschaft als erloschen). Obwohl die revisionistische Linie Titos in der kommunistischen Weltbewegung auf heftige Kritik stieß, nahm Chruschtschow während eines Besuches im Mai 1955 in Belgrad alle Anschuldigungen gegen Tito zurück und begab sich damit auf dessen Positionen. Während der Ereignisse im Herbst 1956 in Ungarn bezog Tito Position zugunsten der konterrevolutionären Kräfte.
Verheerende Auswirkungen auf die kommunistische Weltbewegung hatte 1956 der XX. Parteitag der KPdSU. Das betraf nicht nur die Art und Weise wie Chruschtschow in seiner Geheimrede am Ende des Parteitages zur Rolle Stalins Stellung nahm. Dass unter Stalin massenhaft Unrecht geschah und oft nicht zu rechtfertigende Gewalt angewandt wurde, musste zur Sprache gebracht und dazu eine Bilanz gezogen werden. Das wurde von Chruschtschow jedoch ohne jeden historischen Bezug und ohne eine generelle Einordnung in revolutionäre Prozesse und ihre Entartungen, in Sonderheit der Entwicklung seit der Oktoberrevolution vorgenommen. In keiner Weise wurde berücksichtigt, dass in allen Revolutionen der Terror immer von den Verteidigern der bestehenden Ordnungen begonnen wurde und sich gegen die Revolutionäre richtete. In ausgezeichneter und sehr verständlicher Weise hat das H. H. Holz in seinem Essay „Die revisionistische Wende“ (jW, 13. Dez. 2007) dargelegt. In der KPdSU-Führung war Chruschtschows Rede weder kollektiv erörtert noch beschlossen worden. Sie wurde auch nicht als offizielles Parteidokument anerkannt und weder zu Chruschtschows noch Breshnews Zeiten veröffentlicht. Der XX. Parteitag führte zum Konflikt mit der KP Chinas, welche die Vorgehensweise Chruschtschows ablehnte, und bewirkte Deformierungen und Fehlentwicklungen in den sozialistischen Staaten.
Die Wirtschafts- und Sozialpolitik wurde von Voluntarismus und Wunschdenken geprägt: Verkündung des Aufbaus der Grundlagen des Kommunismus bis 1980, Überholung der höchstentwickelten kapitalistischen Staaten in der Pro-Kopf-Produktion, Orientierung an den konsumorientierten und parasitären Wertvor-stellungen des Kapitalismus. Es wurde der abenteuerliche Kurs eingeschlagen, die Auseinandersetzung mit ihm auf dem Feld der Warenproduktion, auf dem dieser eine entscheidende Überlegenheit besaß, zu führen.
Im Herbst 1959 reiste Chruschtschow auf Einladung Präsident Dwight D. Eisenhowers (1890-1969) zu einem zwölftägigen Besuch in die USA. In den Gesprächen spielte die Deutschlandfrage eine zentrale Rolle. 1958 hatte Chruschtschow mit der Forderung einer Entmilitarisierung Berlins und der Aner-kennung der DDR faktisch den Viermächtestatus über die Stadt aufgekündigt. Obwohl er das Berlinultimatum fallen ließ, erbrachten die Gespräche keine Annähe-rung. Die Ereignisse entwickelten sich in der Folgezeit in Richtung 13. August 1961.
Gipfeldiplomatie scheiterte
Für den 16./17. Mai 1960 war ein Gipfeltreffen der vier Großmächte in Paris anberaumt. Am 1. Mai wurde ein tief in den Luftraum der UdSSR eingedrungenes USA-Spionageflugzeug U2 bei Swerdlowsk in über 20.000 Meter Höhe abgeschossen. Im Pentagon hatte man nicht damit gerechnet, dass die Sowjetunion inzwischen über Bodenluftraketen dieser Reichweite verfügte. Chruschtschow wollte dennoch an seiner Politik der Verständigung mit den USA festhalten, forderte dazu jedoch vergeblich eine Entschuldigung Eisenhowers. Der Gipfel platzte. Mit Eisenhowers Nachfolger John F. Kennedy (1917-1963) traf Chruschtschow ein Jahr später in Wien zu einem Meinungsaustausch über Abrüstungsfragen und die Berlinfrage zusammen. Trotz herausgestellter freundlicher Atmosphäre gab es keine Ergebnisse.
Nach der USA-Niederlage 1961 in der Schweinebucht auf Kuba hielten die Drohungen zur Liquidierung des Sozialismus auf der Karibikinsel an. Die sowje-tischen Militärs reagierten mit der Entsendung von Mittelstreckenraketen nach Kuba. Nach der Verhängung einer Seeblockade gegen Frachter der UdSSR und ihrer Verbündeten lenkte Chruschtschow ein und zog die Raketen wieder ab. Eine Vereinbarung zwischen der UdSSR, den USA und Großbritannien über eine begrenzte Einstellung der Atomtests im August 1963 konnte Chruschtschow noch als einen Erfolg seiner „Verständigungspolitik“ feiern.
Nach seiner Absetzung wurde Leonid I. Breshnew (1906-1982) Parteichef. Der unter Chruschtschow Fuß gefasste Revisionismus stagnierte zunächst, es wurde jedoch nichts unternommen, ihn zu überwinden. Er bildete den Nährboden, der Michael S. Gorbatschow an die Macht brachte. Dessen Ziel bestand, wie er nach der Niederlage des Sozialismus in Europa 1989/90 offen eingestand, schon lange, bevor er 1985 Generalsekretär wurde, darin, die sozialistischen Gesellschaftsordnungen zu liquidieren und eine kapitalistische Restauration durchzusetzen.
Die Forschungsergebnisse Kurt Gossweilers
Der bereits durch viele Publikationen als brillanter Faschismusforscher bekannte Kurt Gossweiler hat nach der sozialistischen Niederlage in Europa eine zweite Hauptstrecke eingeschlagen: Die Erforschung des Revisionismus in seinen neuen Erscheinungsformen. Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges, der insgesamt die Möglichkeiten für das weitere Voranschreiten des revolutionären Weltprozesses erweiterte, habe zugleich Bedingungen hervorgebracht, die der bürgerlichen Ideologie - vor allem in Gestalt neuer Erscheinungsformen des Revisionismus, auch „moderner Revisionismus“ genannt - Wege des Eindringens nunmehr in die kommunistischen Parteien an der Macht einschließlich der KPdSU eröffneten. Die Antihitlerkoalition habe „in Teilen der Bewegung Illusionen über den Imperialismus genährt; nur der deutsche, italienische und japanische Imperialismus seien ‚böse’ Imperialismen, die imperialistischen Bundesgenossen dagegen repräsentierten einen ‚guten’ Imperia-lismus, von dem keine Gefahr mehr für den Sozialismus ausginge.“ Ein Schwerpunkt seiner Forschungen ist die Rolle Chruschtschows an der Spitze der KPdSU als Wegbereiter des modernen Revisionismus, der Gorbatschow an die Macht brachte und zur entscheidenden Ursache der sozialistischen Niederlage 1989/90 wurde. Sein Vorgehen sei nicht einfach zu durchschauen, da er stets als Marxist-Leninist und Verteidiger dieser Weltanschauung auftrat. Dazu hat Gossweiler zwei Standardwerke vorgelegt: „Wider den Revisionismus“ und „Die Taubenfußchronik oder die Chruschtschowiade“ (Bd. I 1953 bis 1957, Bd. II (1957 bis 1976), erschienen im Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung München 1997 bzw. 2002/2005.
Gerhard Feldbauer
Poppenhausen.
Diese Artikel erschien zuerst im „Berliner Anstoß“, Zeitung der DKP Berlin. Wir danken für die Genehmigung des Nachdrucks.
Otto Bruckner
„Die große Revolution der kleinen Leute ist tot.“
Referat im Rahmen der MASCH der KI Österreich
In einer Geschichte mit diesem Titel lässt der Schriftsteller Erwin Riess 1992 einen alten Kommunisten sagen: "Es ist nicht zu leugnen, dass die kleinen Leute - im Osten wie im Westen -verloren haben. (...) Sie werden jetzt aufs Neue verhöhnt und ausgeplündert. Einige Jahrzehnte lang war dies in Europa nur begrenzt möglich. Nicht mehr aber auch nicht weniger war der Sozialismus der kleinen Leute. Nichts ist dümmer, als zu sagen, es war kein Kommunismus, nichts ist schäbiger, als besserwisserisch zu verkünden, es wäre für ihn zu früh gewesen, der Kommunismus war 1917 höchst an der Zeit - und heute ist er überfällig"./1/[3]
Ich möchte euch, bevor wir uns der weiteren Entwicklung der kommunistischen Weltbewegung seit 1989/90 widmen, ein wenig zurückführen in jene Zeit, in die Debatten in der kommunistischen Bewegung vor, während und unmittelbar nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Länder Europas und dem Zerfall der Sowjetunion. In den Diskussionen, die hier schon stattgefunden haben, wurde unter anderem darauf hingewiesen, es wäre zu vereinfacht, Entwicklungen einfach nur an Personen festzumachen, gute wie schlechte. Das mag schon sein. Dennoch stehen natürlich Personen für eine gewisse Periode in der Entwicklung einer Partei, eines Staates (wenn die Partei an der Macht ist) und für die damit verbundenen Folgen.
Gehen wir zunächst einmal von der KPÖ aus. Ich kam 1980 in die KPÖ und das war eine Zeit, in der eine längere Etappe ideologischer Debatten dann 1982 mit der Beschlussfassung des Programms "Sozialismus in Österreichs Farben" abgeschlossen wurde.
Dass es zu diesem Zeitpunkt schon seit langem keine einheitliche kommunistische Weltbewegung mehr gab, wohl aber einige dominante Zentren, wirft die Frage auf, wo die KPÖ sich damals programmatisch positionierte. Versuchen wir aber zuerst, in groben Zügen darzustellen, in welche Teile die kommunistische Bewegung aufgespalten war.
Aus heutiger Sicht können wir sagen, die KPÖ versuchte damals einen Spagat. Denn die Betonung des "österreichischen" hat zwar die Seite, das eigenständige an der Nation Österreich hervorzustreichen, lehnt sich aber zugleich auch an die damals bereits Jahrzehnte währende und wechselvolle Debatte an, dass es kein allgemeingültiges Modell des Sozialismus geben könne, und jedes Volk, jede Partei, den eigenen, auf den Gegebenheiten des jeweiligen Landes und des Standes der Entwicklung seiner Produktivkräfte beruhenden Weg zum Sozialismus finden müsse. So heißt es denn auch im Programm: "Schon trägt der Sozialismus die Farben vieler Nationen. Je reicher die Vielfalt der Formen des Staates und des politischen Systems mit der Ausbreitung des Sozialismus wird, desto deutlicher treten in der Verschiedenheit Gemeinsamkeiten zutage. So wenig es Gesetzmäßigkeiten `an sich´ losgelöst von konkret-historischen, von nationalen Besonderheiten irgendwo gibt, können nationale Besonderheiten unabhängig von Gesetzmäßigkeiten existieren"/2/
Eine schöne dialektische Klammer also, die hier gebildet wird. Die Vorgeschichte der Debatte über die nationalen Wege zum Sozialismus ist aber eine verschlungene und markiert zugleich einige große Bruchlinien in der Bewegung.
Im Gefolge des XX: Parteitages der KPdSU spricht der letzte noch lebende Komintern-Führer Palmiro Togliatti vom "italienischen Weg zum Sozialismus" und auch davon, dass es kein leitendes Zentrum der kommunistischen Weltbewegung mehr geben könne, sondern die "volle Autonomie der einzelnen kommunistischen Bewegungen und Parteien und diejenige der bilateralen Beziehungen zueinander"/3/
Was Togliatti durchaus als Reaktion auf die von der KPdSU zu diesem Zeitpunkt ausgehende Konfusion und als Kritik an Chruschtschows primitiver Abrechnung mit dem "Personenkult" verstand, erwies sich in weiterer Folge - ob beabsichtigt oder nicht - als Grundlegung des sogenannten Eurokommunismus, deren Zentrum die PCI als stärkste KP Westeuropas bildete.
Ein anderer wichtiger Akteur dieser Zeit, Josip Broz Tito ging da schon wesentlich weiter, und erklärte Jugoslawien nicht nur militärisch, sondern auch politisch als blockfrei, quasi zwischen den beiden Systemen Kapitalismus und Sozialismus stehend und unterstütze nach Kräften jene Figuren in anderen Parteien, die seinem Beispiel folgen wollten, wie Imre Nagy in Ungarn.
Mit der zweiten internationalen Konferenz der KPs und Arbeiterparteien 1960 in Moskau (die erste fand 1957 statt) wurde der Zerfall der Weltbewegung offenkundig, und es können im Großen und Ganzen drei Lager festgemacht werden:
- Die KP Chinas und die KP Albaniens. (Enver Hoxha sprach entgegen den damals üblichen diplomatischen Floskeln ganz unverblümt, und griff Chruschtschow auf der einen und den nicht anwesenden Tito auf der anderen Seite frontal an.)
- Die später als eurokommunistisch bezeichnete Linie, gebildet vor allem von den KPs Italiens, Frankreichs und Spaniens und
- die zentristische Linie, sich scharend um die KPdSU und die Bruderparteien aus den im RGW und Warschauer Vertrag vereinigten sozialistischen Ländern, um die sich auch Parteien wie die KPÖ gruppierten (Wiewohl 1960 der Frontverlauf noch ein wenig anders war, da es zwischen den oben skizzierten Lagern zum Teil eine gemeinsame Linie gegen den "Revisionismus" Titos gab, eine Gemeinsamkeit, die aber nicht lange währte).
Wenn heute die Frage steht, welche Bedeutung der 20. Parteitag der KPdSU für die weitere Entwicklung der kommunistischen Weltbewegung und im besonderen für die sozialistischen Länder hatte, so ist m. E. zu berücksichtigen, dass der auf diesem Parteitag vollzogene Kurswechsel zum Revisionismus EINE, aber nicht die EINZIGE Ursache für den Niedergang ist.
In seinem Referat im Rahmen der MASCH hat Gen. Gerfried Tschinkel bereits darauf hingewiesen, dass im ökonomischen Bereich Fehlentwicklungen und vor allem politisch-konzeptionelle Weichenstellungen in die falsche Richtung nicht einfach nur mit Personen und bestimmten Perioden verknüpfbar sind.
Dies gilt erst recht für den Bereich der Politik. So sehr die Ära Chruschtschow als eine für die kommunistische Bewegung schädliche bezeichnet werden kann, ist doch zu berücksichtigen, dass Chruschtschow weder vom Himmel fiel noch vorher alles in bester Ordnung gewesen ist.
Fangen wir mit der Beurteilung von hinten an: Die Frage "Wer wen?" hat der Imperialismus 1989/90 zu seinen Gunsten entschieden. Sein wichtigster Gehilfe im sozialistischen Lager war dabei zweifellos Gorbatschow. Aber auch Gorbatschow kam ja nicht vom Mond.
Ich erinnere an den Beginn der Perestrojka. Der Grund, warum Gorbatschows Reden von der Erneuerung überall in der kommunistischen Welt auf so fruchtbaren Boden fielen, war ja der, dass jeder wusste: Änderungen sind unumgänglich.
Willi Gaisch schrieb 1988 in einem Artikel über die Perestrojka: "Die Kunst der politischen Führung besteht darin, (...) Widersprüche rechtzeitig zu erkennen, geeignete Formen ihrer Bewegung beziehungsweise Lösung zu finden und sie in Triebkräfte des gesellschaftlichen Fortschritts umzusetzen". /4/
Der Grund, warum Gen. Gaisch dies damals schrieb war der: Einige Genossen, die zu Beginn der Perestrojka zu den letzten Jahresschülern der KPÖ in Moskau zählten, hatten die ganze Verwirrung, die sich in der sowjetischen Debatte spiegelte, mit nach Hause gebracht, etwa die, dass es sich beim politischen System der UdSSR vor der Perestrojka gar nicht um eine sozialistische Gesellschaft handle.
Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass Gorbatschow sich in der ersten Etappe der Perestroika auf Lenin berufen hat. Ob er dies tat, um die Mehrheit zu gewinnen, oder ob er es aus Überzeugung tat, ist schwer zu beantworten. Ich erinnere hier an die Debatte zwischen Werner Pirker und Kurt Gossweiler. Pirker, in jener Zeit Volksstimme-Korrespondent in Moskau ist bis heute der Ansicht, dass es nicht der ursprüngliche "Plan" der Gorbatschowisten war, die Sowjetunion zu zerstören, während Genosse Gossweiler davon ausgeht, dass dies sehr wohl der Fall war.
Tatsache ist jedenfalls, dass sich im Verlauf der Perestroika große Wandlungen der Positionen vollzogen, und es unübersehbar ist, dass die Frage "Wer wen?" mit Hilfe und nicht gegen den Widerstand der Führung der KPDSU zugunsten des Imperialismus gelöst wurde.
An dieser Stelle jedoch noch einmal zurück zum Jahr 1960: Spätestens ab diesem Zeitpunkt gab es (obwohl dann in Folge noch weitere internationale Konferenzen stattfanden) nur mehr zwei Arten von Beziehungen kommunistischer Parteien untereinander:
1) die notwendigerweise institutionalisierte Form der politischen, staatlichen, wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit der KPs der sozialistischen Länder unter Führung der KPdSU.
2) Die weitgehend bilateralen Kontakte der KPs und Arbeiterparteien untereinander, wobei natürlich die bilateralen Kontakte der meisten KPs mit der KPDSU besondere Bedeutung hatten, und diese, wie auch in Wien, in ständiger Form über die sowjetischen Botschaften sehr intensiv gestaltet wurden.
Ein Spezifikum der KPÖ bestand darin, dass sie mit Hilfe der sozialistischen Länder einen großen Wirtschaftsapparat geschaffen hatte und -- gemessen an ihrer Größe -- über eine sehr komfortable finanzielle Ausstattung verfügte. Dieser "Reichtum", schreibt Bruno Furch in seinem Buch "Das schwache Immunsystem", "gereichte der Partei nicht nur zum Segen. Er wurde auch zu einer Quelle der Unmoral und der Überhandnahme spekulativer Einstellungen im Leben der Partei"./5/
Damit zu einem anderen Thema: Gerne wird heute der Mythos verbreitet, die KPÖ habe sich Ende der 60-ziger Jahre anhand der Frage gespalten, welche Haltung die Partei zur Intervention der Truppen des Warschauer Vertrages in der CSSR eingenommen habe. Das ist eine unzulässige Verkürzung, denn die ideologischen Konfliktlinien betrafen auf ganzer und breiter Front die grundsätzliche Linie.
Ich möchte hier besonders Ernst Fischer erwähnen, der ja in den Jahrzehnten davor wesentlich die Politik der KPÖ mitgestaltete und mit seiner publizistischen Ausstrahlung weit über die Reihen der KPÖ hinaus wirkte. Noch in der Auseinandersetzung mit der KP Jugoslawiens schrieb Fischer ein Theaterstück mit dem Titel "Der große Verrat", das nicht nur in Wien gespielt wurde, sondern auch in Berlin, wo am Premierenabend Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl anwesend waren.
Fischer fungierte Ende der 60er Jahre als Speerspitze des Revisionsmus, vom 150-Prozentigen Apologeten der KPDSU-Linie hatte er sich zu einem Lakaien der imperialistischen Interessen gewendet. Nicht umsonst stellen sich die heutigen Wendehälse gerne in die Traditionslinie Fischers. Fischer also - immer noch eine sehr bekannte Figur in ganz Europa - setzte ein publizistisches Trommelfeuer gegen die KPDSU, die KPC, die KPÖ-Führung in Gang, er propagierte den Wandel in den sozialistischen Ländern, der ganz offenkundig ein Wandel zum Kapitalismus sein hätte sollen.
Damit zu einem Kernproblem, vor dem alle Kommunisten damals und auch später standen. In jeder Debatte mischt der Gegner mit. Und jede Debatte war gekennzeichnet von Hinweisen auf reale Missstände einerseits und jenen "Rezepten", die den Sozialismus begraben wollten andererseits. In diesem Spannungsfeld blieb wenig Spielraum.
Wollte man, wie Fischer oder Dubcek oder die Eurokommunisten die Geschäfte des Gegners besorgen, und das für die berühmten fünf Minuten Berühmtheit? Oder wollte man als Kommunist in der weltweiten Front des Kampfes der Systeme auf der richtigen Seite stehen?
Und die Fehlhaltungen aufrechter Kommunisten dürfen wir nicht gehässig beurteilen, sondern fair und kommunistisch, vor allem gilt zu bedenken, was Ernst Wimmer dazu schrieb: "Umringt, bestürmt von Gegnern in vielen Farben, kam es dazu, dass auch Probleme, von Feinden aufgerollt, zuweilen selber als "feindlich" betrachtet wurden. Unter Bedingungen der Isolierung, einer gehässigen Umwelt wurde mitunter schon ein Geltendmachen objektiver Widersprüche, ein gebotener Verweis auf bestimmte unerfreuliche Züge der Realität, auch im Sozialismus als grundsätzlicher Widerspruch, als "Abweichung" oder gar Verrat missverstanden"./6/
Noch ganz andere Themen aber bestimmten den Bruch zwischen marxistisch-leninistischen und den "eurokommunistischen" Kräften: Große westeuropäische KPs wie die italienische, die französische und die spanische waren in dieser Strömung tonangebend. In Italien entwickelte sich schon seit den späten 40er Jahren die Debatte über einen "eigenständigen" Weg und der wurde unter anderem durch die Festlegung auf einen ausschließlich parlamentarischen Übergang zum Sozialismus beschritten. Auch die Frage der Beteiligung an bürgerlichen Regierungen war nicht mehr ausgeschlossen.
Das Verhältnis zu NATO und EG war ein sehr zahmes - und wenn auch mehrheitlich mit kommunistischer Mitgliedschaft - entwickelten sich diese Parteien zu neosozialdemokratischen. Wenngleich ja zu beachten ist, dass in jener Zeit auch die SP programmatisch noch ganz anders formulierte, so enthält das Parteiprogramm der SPÖ von 1958, welches auch bei Erringung der absoluten Mehrheit 1971 noch gültig war noch das Ziel der klassenlosen Gesellschaft. Freilich hat in der Sozialdemokratie die Diskrepanz wischen Programm und Praxis, zwischen dem heute und der fernen Zukunft eine große Tradition. Inzwischen aber hat man ja auch die Programmatik besser an die elende Praxis angepasst.
Das Parteiprogramm der KPÖ von 1982, vorhin schon erwähnt, hatte aber, als Abschluss eines langen Diskussionsprozesses ein wesentliches Kernstück, das Ernst Wimmer in seinem Diskussionsbeitrag auf dem 25. Parteitag (1984) so zusammenfasste: "Mitunter wird gefragt: Was ist eigentlich das vermittelnde Glied zwischen dem Heute und unseren weitgesteckten Zielen, einer antimonopolistischen Demokratie, dem Sozialismus? Es ist, wie das Programm feststellt, der Kampf zur Überwindung der besonderen Herrschaftsform, die seit Jahrzehnten das politische Leben in unserem land prägt, der "Sozialpartnerschaft". (...) Ihre Überwindung durch die Arbeiterbewegung ist noch nicht nah, aber erreichbar. Sie würde einen tiefen Einschnitt darstellen, eine Wende."/7/
Der historische Knotenpunkt 1989/90
In einem Resümee über das Ende der Sowjetunion schreibt Ernst Wimmer: "Wäre seit dem Roten Oktober wirklich alles schiefgelaufen, dann wäre zweifellos das Beste eine möglichst frühe Auflösung der Kommunistischen Partei gewesen, wie es ihr nicht wenige Antikommunisten nahelegten, ja sogar mit bemerkenswertem Nachdruck zu erreichen trachteten. Aber welche Folgen hätte das für den Kampf um Frieden, gegen Faschismus, auch gegen Kolonialismus, für soziale und demokratische Errungenschaften gehabt? Sollte man wegen dieser Positiva die Schändlichkeiten vertuschen und verdrängen, die damit verflochten waren? Ein solches Verfahren, einen Teil der Wirklichkeit auszusperren, ist kein Privileg von Dogmatikern. Sie wird auch von jenen praktiziert, die ihre Prinzipienlosigkeit als Antidogmatismus kostümieren."/8/ Zu diesem Zeitpunkt war die Sowjetunion bereits Geschichte und die mit ihr verbündeten sozialistischen Länder Europas eines nach dem anderen gefallen.
Einige exemplarische Beispiele nur, welche Auswirkungen, das auf das kommunistische Parteienspektrum Europas hatte: In Italien löste sich die traditionsreiche kommunistische Partei auf, ein großer Teil von ihr ging in einer neu errichteten sozialdemokratischen Formation auf. Kommunisten rund um den betagten Senator Cosutta gründeten die Partei der Kommunistischen Neu (oder Wieder-) Gründung -- Rifondazione Comunista. Als am stärksten wahrzunehmende politische Kraft bildete sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR die SED (später SED-PDS, dann PDS, dann Linke) heraus, in der es anfänglich noch einen starken kommunistischen Flügel gab, der aber durch die Medienlieblinge der Partei wie z.B. Gregor Gysi rasch isoliert wurde, und heute nur mehr die Funktion eines Feigenblattes erfüllt. Kleine KPs in Westeuropa waren voll von der Krise erfasst, in ihr setzte eine Welle ufer- und haltloser ideologischer Debatten ein. In den meisten ehemals sozialistischen Ländern kamen die neuen Machteliten direkt aus den vorherigen Staatsparteien. Es bildeten sich jedoch nach und nach fast überall -- z.T. mehrere, ideologisch unterschiedliche -- neue KPs und Arbeiterparteien heraus. Mit voller Wucht getroffen wurden jene Parteien und Länder, die nicht kapitulationswillig waren, aber in enger politischer und wirtschaftlicher Verknüpfung mit der Sowjetunion und dem RGW gestanden hatten, dies trifft vor allem auf Kuba zu, das fast sämtliche Koordinaten seiner Wirtschaftspolitik neu ordnen musste. Wichtige Parteien des afrikanischen Kontinents, wie die südafrikanische KP waren zu diesem Zeitpunkt voll im Sog des Gorbatschowismus, jedoch nicht unkritisch. Noch vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion schreibt Joe Slovo, Generalsekretär der SACP, viele (sowjetische) Journalisten "scheinen vom technokratischen Fortschritt hypnotisiert; der falsche Glanz des westlichen Konsumismus und die Qualität der Yuppie-Produkte scheinen die Lebensqualität der Gesellschaft als ganzes zu überschatten" und er resümiert: "Der beispiellosen Offensive der Ideologen des Kapitalismus wurde mit einer einseitigen ideologischen Abrüstung begegnet"./9/
Oder um es mit Domenico Losurdo zu formulieren: "Es ist, als ob ein ideologisches Hiroshima die Fähigkeit großer Teile der internationalen kommunistischen Bewegung zu eigenständigem Denken zerstört hätte"/10/
Die KPÖ nach 89/90
Ich möchte an dieser Stelle einen Einschub zur Entwicklung der KPÖ machen. Für mich persönlich war das Jahr 1989 mit mehreren Zäsuren verbunden. Im Sommer 1989 musste ich mich einer Operation unterziehen und anschließend noch mehrere längere Spitalsaufenthalte bis in den Herbst hinein über mich ergehen lassen, weil ein Tumor diagnostiziert worden war.
An der Arbeit des Zentralkomitees der KPÖ, dem ich seit 1985 angehörte, konnte ich deshalb über einen längeren Zeitraum nicht teilnehmen. Ich kehrte erst kurz vor dem 27. Parteitag im Jänner 1990 wieder ins ZK zurück. Inzwischen war die DDR Geschichte und auch die KPÖ, wie wir sie bisher kannten.
Mit Silbermayr und Sohn wurde ein Duo an die Spitze der Partei gewählt, das in Folge in rasantem Tempo versuchte, die Partei in ihren Grundlagen zu zerstören, ihr das kommunistische zu nehmen, und das ihre wichtigste Aufgabe in einer polemischen, schludrigen und für viele alte Genossen verletzenden Art der Vergangenheitsaufarbeitung sah. Nach der Niederlage bei den Nationalratswahlen 1990 und dem folgenden "Hopp oder Tropp" (große Teile des Parteivermögens sollten in eine Stiftung eingebracht werden, die Partei sozialdemokratisiert), scheiterten sie knapp (um eine Stimme!) im ZK und traten gemeinsam mit einem Drittel des ZK aus der Partei aus.
Die Opposition im ZK hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine klare Mehrheit der Parteiorganisationen hinter sich, die sich für die Einberufung eines außerordentlichen Parteitages ausgesprochen hatte. Dieser wurde dann - vom Rest des ZK - vorbereitet und im Juni 1991 in Graz als 28. Parteitag der KPÖ durchgeführt.
Jene Kräfte, die in der Partei verblieben waren, können in groben Zügen folgendermaßen charakterisiert werden:. Die Gruppe um Baier, wesentlich gestützt durch die KPÖ-Wien und die alte Garde der Zentristen des Politbüros um Muhri, Kalt, Hofer, Schwager und Graber; gestützt auch durch zentristische klassenorientierte Kräfte wie Manfred Groß (GLB) und durch in der Partei verbliebene revisionistische Kräfte wie Reinhard Sellner, Julius Mende, Lutz Holzinger und Josef Baum.. Die Führungen der Landesorganisationen Steiermark und Niederösterreich, die damals im Wesentlichen von Ernst Kaltenegger, Franz Parteder, Richard Ramsner und Otto Bruckner im ZK vertreten wurden. Unsere Gruppe vertrat im Wesentlichen einen Klassenstandpunkt, erkannte die Notwendigkeit der Erneuerung und stellte Interessenspolitik, die Demokratisierung und Föderalisierung der Partei in den Mittelpunkt.. Der politisch-ideologische Kern des Marxismus-Leninismus in der Partei, der vor allem durch die Person Ernst Wimmers verkörpert wurde.
Im Kampf gegen die Silbermayr-Sohn-Gruppe hatte es Gemeinsamkeiten zwischen all diesen Gruppen gegeben, die danach so nicht mehr bestanden. Schon der 28. Parteitag selbst zeigte dies deutlich. Konnten sich die Deokratisierung7Föderalsierung durchsetzen (neues Statut, das eine kollektive Führung und ausgebaute Rechte für Länder und Bezirke vorsah), trug die politische Erklärung bereits den Stempel der Baier-Gruppe. In der Wahldebatte wurde verhindert, dass Ernst Wimmer wieder ins ZK gewählt wurde. Bemerkenswert weitsichtig Wimmers Diskussionsbeitrag auf diesem Parteitag: "Dass es einen Marxismus mit neuen Erkenntnissen, Methoden und Kriterien so lange geben wird, als es Kapitalismus geben wird und darüber hinaus, das steht für mich außer Frage. Aber ob es eine marxistische Partei, eine Partei kommunistischen Typs in den nächsten Jahren geben wird, das ist leider für mich nicht so sicher. Keineswegs weil ich, wie kleinmütig geworden oder gekränkt der Auffassung wäre, dass eine solche Partei keine Existenzberechtigung mehr hätte, im Gegenteil. Aber ich habe begründete Zweifel daran, dass das, was heute die Partei ausmacht, sich aufraffen und zusammenraufen kann, um Funktionen zu erfüllen, die erst eine Existenzberechtigung ergeben."/11/
Ich möchte aus heutiger Sicht auch meine eigene Rolle selbstkritisch darstellen. Ich war - wie andere - der Auffassung, es wäre das Wichtigste, zu verhindern, dass die Partei durch einen weiteren Bruch noch mehr geschwächt wird. Deshalb tat ich auch alles, um zu Kompromissen beizutragen und Sprach auch in der Wahldebatte von der Notwendigkeit, ein Ensemble von Personen zu wählen, das die politische Bandbreite in der verbliebenen Mitgliedschaft am besten abbildet.
Aus heutiger Sicht war das Fehler und politisch naiv. Denn die Vehemenz, mit der Baier, Mende und andere die Nicht-Wahl Ernst Wimmers betrieben, hat in Wahrheit doch schon sehr deutlich gezeigt, wohin die Reise geht. Die Klammer, welche wir damals bilden wollten, war schon eine Illusion. Ich habe das leider erst mit Verspätung erkannt und Ende 1993 meinen Rücktritt als Bundessprecher der KPÖ erklärt.
Zur Entwicklung seit 89/90 in Europa
Die am wenigsten vom kapitalistischen Siegeszug beschädigten Parteien, die KKE und die PCP, machten sich sehr bald mit einer Reihe von Maßnahmen verdient um eine neue Sammlung kommunistischer Kräfte.
"Bourgeoisie und revisionistisch-opportunistische Kreise auch aus den eigenen Reihen drängten die Partei, sich von ihrer Vergangenheit und vom wissenschaftlichen Sozialismus zu distanzieren. Über eine Parteienallianz wollte man die Kommunisten in ein bürgerlich-sozialdemokratisches System einbinden und die Selbständigkeit wie den revolutionären Charakter der KKE aufheben. Die Partei konnte sich aus dieser vom Zentralkomitee in einer Erklärung vom Oktober 2007 als »ernst« eingeschätzten Situation befreien »wegen ihrer Treue zum Marxismus-Leninismus, ihrer tiefen Verwurzelung in der Arbeiterklasse, ihrer reichen Erfahrungen im Klassenkampf und wegen ihrer Erfahrungen im Kampf gegen den Opportunismus«. In dieser Erklärung heißt es weiter, die KKE werde sich niemals bei der einheimischen und internationalen Bourgeoisie für ihre Geschichte entschuldigen. In den schwierigen Kämpfen der Gegenwart um die ökonomischen und politischen Interessen der Arbeiter und aller Unterprivilegierten steht die KKE in vorderster Front. Sie ist die führende Kraft im Kampf gegen die NATO- und EU-Politik der griechischen Regierung, gegen die imperialistischen Aggressionen auf dem Balkan sowie im Nahen und Mittleren Osten. " (Erklärung der KKE zum 90. Jahrestag der Gründung, November 2008 /13/
So ist es vor allem diesen Parteien zu verdanken, dass WGB und WBDJ auf neuer Grundlage konsolidiert wurden. Von ihnen ging die Initiative zur Abhaltung jährlicher Konferenzen von KPs und Arbeiterparteien aus, und sie sind es auch, die im ideologischen Bereich als marxistisch-leninistische Felsen in der Brandung des kapitalistischen Siegeszuges betrachtet werden können.
Als Meilenstein der Gegenbewegung kann die Gründung der Europäischen Linkspartei betrachtet werden. Hier sammelten sich unter Führung der PDS und der PRC jene Kräfte, die aus einer kommunistischen Tradition stammen, jedoch in eine sozialdemokratische Richtung tendieren.
"Wir haben heute die dringende Aufgabe, die Frage unserer Einheit unter Kommunisten zu lösen. Ausgehend von wirklichen Organen der Koordination und der Kooperation kann eine gemeinsame Taktik erarbeitet werden - wie beispielsweise gegenüber den europäischen Institutionen. Die ELP trägt zu dem Paradox zusätzlich bei. Gewisse kommunistische Parteien widersetzen sich der Organisation unserer internationalen kommunistischen Bewegung. Aber gleichzeitig formieren sie sich nicht nur zu einem Organ der Kooperation und Koordination sondern zu einer "Überpartei", um sich mit Parteien zu verbünden, die sich entweder offen vom Kommunismus abwenden oder niemals dazu gehört haben. Sie lehnen die Idee ab, dass die kommunistische Bewegung sich mit Strukturen versieht, aber gleichzeitig akzeptieren sie die Zwangsjacke einer "Überpartei" mit ihren Leitungsorganen und ihrem Statut, das obendrein noch unter der Oberaufsicht der Europäischen Union steht. " schreibt die Partei der Arbeit Belgiens (PdA) in einer Stellungnahme zum ersten Kongress der EL in Athen./12/
Wir sollten aufmerksam verfolgen, was sich in den KPs und Arbeiterparteien unserer Nachbarländer tut.
Die Ungarische Kommunistische Arbeiterpartei ist vor kurzem aus der EL wieder ausgetreten. "Wir haben die Positionen anderer kommunistischer Parteien in Erwägung gezogen. Wir stimmen der Feststellung zu, dass die Europäische Linkspartei innerhalb der internationalen Linken eine negative Rolle spielt. Mit unserem Beispiel wollen wir auch anderen Parteien den Austritt aus der ELP erleichtern. Wir wollen allen klar machen, was die ELP wirklich ist. Wir denken, dass Revisionismus und Opportunismus heute die größten Gefahren darstellen, die die kommunistische Bewegung bedrohen. Es ist schlecht, dass wir arm sind und kein Geld haben. Aber wird werden schlicht alles verlieren, wenn wir unsere klare ideologische Überzeugung, den Marxismus-Leninismus, aufgeben. " heißt es in der Austrittserklärung vom 25. April ds. J. /14/
In unserem Nachbarland auf der anderen Seite des Bundesgebietes, in der Schweiz, hat sich in der PdA eine spannende Debatte über ihre künftige Positionierung entwickelt. "Der Aufbau einer kommunistisch inspirierten Partei als allgemeines Ziel, das wir uns vorgeben, ist ein Prozess, der sich strukturieren und im Lauf der praktischen Erfahrungen neu bestimmen wird. Die Partei wird mit dem Umfeld in eine dialektische Wechselwirkung treten, um ihre Praxis fortlaufend an die veränderliche Wirklichkeit anzupassen. Nichtsdestoweniger muss dieser Prozess den grundlegenden Sinn unseres Kampfes bewahren, das heißt auf die Überwindung der kapitalistischen Ausbeutung gerichtet sein. Man muss Erneuerer und Reformator werden, ohne in den Reformismus oder Revisionismus abzugleiten. Die Partei muss lernen, mit den Proletariern in Dialog zu treten, nicht um auf populistische Art und Weise den von bürgerlicher Hand genährten Gemeinsinn zu übernehmen, sondern um die in der Gesellschaft auftretenden Bedingungen und Formen der Ausbeutung richtig zu deuten und zu verstehen." Heißt es in einer Resolution der Parteileitung für die nationale Konferenz am 21. Nov. /15/
Brennpunkt Lateinamerika
Nicht genug Aufmerksamkeit können Kommunisten heute der Entwicklung in Lateinamerika schenken. War es für Kommunisten früher ganz nützlich, russisch zu sprechen, so kann ich heute jungen GenossInnen nur raten, spanisch zu lernen. Da ist zum einen die KP Kubas und Kuba als sozialistisches Land. Die kubanischen Kommunisten haben die massiven Schwierigkeiten nach 1989/90 offen vor dem Volk dargelegt, und das unter Bedingungen der äußeren Bedrohung durch den US-Imperialismus. Zum anderen ist aber Venezuela, und hier die KP Venezuelas sehr interessant, und nicht nur das, das ganze wirtschaftliche Projekt ALBA. Denn hier wird der Versuch unternommen, dass souveräne Nationalstaaten eine gleichberechtige und faire Form der wirtschaftlichen und politischen Kooperation betreiben, und Venezuelas gegenwärtige Entwicklung ist wohl so etwas, wie Ernst Wimmer sich den Weg zur antimonopolistischen Demokratie vorgestellt hat.
Otto Bruckner
Wien
Anmerkungen:
/1/ der streit, Nr. 43/44, Sept. 1992, Wien
/2/ "Sozialismus in Österreichs Farben", Hrsg.: KPÖ, Wien 1982, S. 49
/3/ Aus der Rede Togliattis vor dem ZK der PCI, 24. Juni 1956, zit. nach Frithjof Schmidt: "Die Metamorphosen der Revolution, Campus Forschung, Frankfurt/New York 1988
/4/ Weg und Ziel 12/88, S. 501
/5/ Bruno Furch, Das schwache Immunsystem, Wien 1995, S. 81
/6/ Die Kommunistische Partei Österreichs. Beiträge zu ihrer Geschichte und Politik, Globus Verlag, Wien, 1989, S. 454
/7/ Der 25. Parteitag der Kommunistischen Partei Österreichs, Hrsg. v. d. KPÖ, 1984
/8/ Weg und Ziel, 10/91, S. 430
/9/ The african communist, zit. nach WuZ 2/91, S. 112
/10/ Domenico Losurdo: Flucht aus der Geschichte? Die kommunistische Bewegung zwischen Selbstkritik und Selbsthass., Mehrteiliger Aufsatz in der Jungen Welt, Berlin; 15.-23. März 2000
/11/ 28. Parteitag der KPÖ, 1991, S. 78
/12/ zit. nach: http://www.kominform.at/article.php?story=200510312006488
/13/ zit. nach:http://www.kommunisten.at/article.php?story=20081117172947351
/14/ zit. nach: http://www.kommunisten.at/article.php?story=20090429104006398
/15/ zit. nach: http://www.kominform.at/article.php?story=20090928133056920
/16/ Karl Marx, Der Achtzehnte Brumaire des Lois Bonaparte
ZK der KPD
Brief an die Redaktion offen-siv vom 28.9.09
Werte Genossen,
Eure Veröffentlichung in der Zeitschrift „offen-siv“, auf einem offensichtlich nach Redaktionsschluß gefertigten als „Eilmeldung“ einzustufenden DIN-A-4-Blatt, mit Angriffen auf die KPD, hat uns schon überrascht, nachdem persönliche Gespräche und Austausch von Standpunkten üblich geworden waren. Ihr bedient Euch der gleichen Argumente wie die KPD(B) mit Verleumdungen, falschen Behauptungen und Unterstellungen im Zusammenhang mit einem von uns zu korrigierenden Artikel in der „Die Rote Fahne“, der durch Übertragungsfehler und Auslassungen zu Irritationen führte. Alte längst widerlegte Behauptungen werden von Euch aufgewärmt. Das Ziel Eures Vorgehens läuft auf die Diskreditierung der KPD hinaus. Es erhebt sich die Frage „cui bono“? Wenn Ihr wirklich meint, wir kennen nicht die Ursachen und Hauptstoßrichtung des von den deutschen Faschisten ausgelösten 2. Weltkrieges, sind wir ohnehin nicht die richtigen Gesprächspartner für Euch. Haben wir nicht in vielen Artikeln der DRF unsere prinzipielle marxistisch-leninistische Einschätzung der geschichtlichen und gegenwärtigen Ereignisse unter Beweis gestellt?
Unter den gegenwärtigen Bedingungen sehen wir uns veranlasst, unsere Zusicherung als Unterstützer der Tagung am 10./11. Oktober 2009 zurückzuziehen. Damit entfallen auch die in unserer Vereinbarung vom 6. Juni 2009 getroffenen Festlegungen zu dieser Veranstaltung. Die Würdigung des 60. Jahrestages der Gründung der DDR wird durch Veranstaltungen zusammen mit anderen Organisationen sowie durch unsere Aktivitäten in der massenpolitischen Arbeit auf der Straße vorgenommen.
Wir bitten, dieses Schreiben auch in der nächsten Ausgabe von „offen-siv“ zu veröffentlichen.
Mit kommunistischem Gruß, 28. 9. 2009
Dieter Rolle
ZK der KPD
Redaktion offen-siv
Brief an das ZK der KPD vom 17.10.09
Liebe Genossinnen und Genossen,
Ihr werdet verstehen, dass wir erst heute zu einer Antwort auf Euren Brief vom 28. 9. 2009 kommen. Die Veranstaltung am 10. und 11. 10. 2009 in Berlin erforderte unsere volle Aufmerksamkeit. Natürlich haben wir es sehr bedauert, dass Ihr Eure Unterstützung für die Veranstaltung „…und der Zukunft zugewandt…“ am 10. und 11. 10. 2009 in Berlin zurückgezogen habt.
Dieser Rückzug lässt sich natürlich nicht ändern. Aber wir haben den Wunsch, einige Fragen zu klären. Ihr schreibt nämlich, dass wir uns in der Beilage zur September-Oktober-Ausgabe unserer Zeitschrift offen-siv Argumenten „mit Verleumdungen, falschen Behauptungen und Unterstellungen“ bedient hätten, „alte längst widerlegte Behauptungen“ von uns „aufgewärmt“ würden und das „Ziel“ unseres „Vorgehens auf die Diskreditierung der KPD“ hinauslaufe.
Erlaubt uns dazu fünf inhaltliche Fragen, um deren argumentative, inhaltliche Beantwortung wir bitten:
1. Welche Verleumdungen haben wir formuliert?
2. Welche falschen Behauptungen haben wir aufgestellt?
3. Welche Unterstellungen haben wir vorgebracht?
4. Welche längst widerlegten Behauptungen haben wir aufgewärmt?
5. Womit haben wir die KPD diskreditiert?
Wir werden Euren Brief, Eurer Bitte entsprechend, in der November-Dezember-Ausgabe von offen-siv publizieren. Wir bitten Euch hiermit, diesen unseren Brief im Gegenzug in der nächsten Ausgabe der Roten Fahne zu bringen[4].
Mit kommunistischen Grüßen!
17. 10. 2009
Frank Flegel
ZK der KPD
Brief an die Redaktion offen-siv vom 6.11.09
Lieber Genosse Flegel,
Deinen Brief vom 17. 10. 2009 haben wir erhalten. Da eine weitere Diskussion der gegenteiligen Auffassungen in dieser Art und Weise unserem gemeinsamen Kampf zur Entwicklung einer einheitlichen Kommunistischen Partei auf marxistisch-leninistischer Grundlage und der Schaffung einer breiten antiimperialistisch/antifa-schistischen demokratischen Volksfront nicht dienlich ist, werden wir den Brief nicht weiter kommentieren.
Mit kommunistischem Gruß
6.11.2009
Dieter Rolle
Vorsitzender
Debatte in der DKP |
Redaktion offen-siv
Vorbemerkung
Die sich täglich und auf allen Gebieten verschärfende Barbarei des Imperialismus ist nicht nur der Hintergrund der sich entwickelnden Debatte über Strategie und Taktik der Kommunistinnen und Kommunisten in der BRD.
Sie zwingt der kommunistischen Bewegung zugleich die Notwendigkeit auf, diese Debatte mit aller Konsequenz zu führen. Es geht in ihr nicht nur um eine aktuelle kommunistische Identität, sondern um Grundsätzliches…
Ziel sollte deshalb die Schaffung der Basis für eine so dringend notwendige einheitliche, marxistisch-leninistische Kommunistische Partei sein. Nur auf diesem Weg kann die kommunistische Bewegung wieder eine Identität zurückgewinnen, die es ihr ermöglicht, in die Klassenkämpfe organisierend und orientierend einzugreifen, als Avantgarde der Arbeiterklasse zu wirken und für die Entwicklung einer breiten, demokratischen, antiimperialistischen Volksfront als Voraussetzung für die proletarische, sozialistische Revolution zu kämpfen!
Erneut scheint in der DKP ein Gespenst herumzugeistern, dass für Unruhe und Diskussionen sorgt; diesmal trägt des den Namen „Den Gegenangriff organisieren – die Klasse gegen den Kapitalismus und für den Sozialismus mobilisieren!“ und wurde bisher von 84 DKP-Genossinnen und Genossen unterschrieben. Was ist das Ziel dieses Papiers? Lassen wir es doch selber sprechen. Wir dokumentieren es im folgenden.
Hat diese Initiative der 84 Genossinnen und Genossen zu einer notwendigen, breiten Diskussion innerhalb der DKP, ihren Strukturen und Publikationsorganen geführt? Nein. Die DKP-Führung hat sie auf ein Nebengleis abgestellt (die Homepage www.kommunisten.eu) und diesem Nebengleis auch gleich eine gewollte Richtung gegeben. So heißt es in der die „Debatte“ einleitenden Präambel gleich unmissverständlich: „84 Genossinnen und Genossen haben in dem von ihnen verfassten Positionspapier (…) eine Reihe von Thesen zu den Aufgaben einer revolutionären Partei veröffentlicht, die in einigen Punkten nicht der aktuellen Programmatik der DKP entsprechen.“
Eingeläutet und vorbereitet wurde diese Einordnung bereits vom DKP-Vorsitzenden Heinz Stehr in seinem Grundsatzreferat auf der 8. Parteivorstandstagung. Er scheint wohl zudem eine Gefahr in einer breiten innerparteilichen Diskussion als Vorbereitung des nächsten Parteitages zu sehen, wenn er in seinem Referat u.a. ausführt. „Zum Problem und zur Belastung der innerparteilichen Demokratie werden Meinungsunterschiede auch, wenn – wie jetzt wieder – Positionspapiere, versehen mit Unterschriften von Genossinnen und Genossen, veröffentlicht werden, die unseren programmatischen Aussagen widersprechen. Ein solches, sich wiederholendes Vorgehen birgt die Gefahr der Fraktionierung der DKP.“
Sekundiert wird diese Position noch in verschärfter Form vom langjährigen stellvertretenden DKP-Vorsitzenden Rolf Priemer: „Den Diskussionsbeitrag von Wolfgang Herrmann (siehe www.kommunisten.eu unter „Debatte“), der inzwischen auf eigenen Wunsch aus dem Parteivorstand ausgeschieden ist, habe ich aufmerksam gelesen. Sein Anliegen läuft auf die Organisierung eines Putsches von Revisionisten und Sektierern zusammen mit Teilen der SDAJ gegen den Parteivorstand hinaus. Das muss verhindert werden durch die Delegierten des Parteitages. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Unterzeichnerinnen und Unterzeichner den Ansinnen von Wolfgang Herrmann folgen wollen.“
Für uns ist nicht wirklich nachvollziehbar, warum die 84 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Papiers ihren Diskussionsbeitrag so wenig öffentlich machen, ihre Möglichkeiten deshalb nur ansatzweise für eine inhaltliche Diskussion und – wie von ihnen ja auch selber gefordert oder erhofft – gegebenenfalls Verbesserung ausschöpfen. Wo sind zum Beispiel in diesem Zusammenhang „Theorie & Praxis“ (T&P) oder die „junge Welt“ zu finden? Warum beziehen sie Kommunistinnen und Kommunisten außerhalb der DKP nicht in den Diskussionsprozess ein?
Wir meinen, die mit dem Papier aufgeworfenen Fragen und in ihm dargestellten Grundpositionen sind es wert, innerhalb der kommunistischen Bewegung der BRD breit und offensiv diskutiert zu werden.
Deshalb drucken wir hier das Papier der 84 ab und geben einen Überblick über die bisherige Diskussion bis Anfang November 09[5]. Und wir möchten hinweisen auf ein Debattenforum, welches die Kommunistische Initiative auf www.kommunistische-initiative.de eingerichtet hat. Sie selbst schreibt darüber:
„Mit unserer (neuen) Rubrik `Debatte´ wollen wir nicht nur unsere Homepage formal erweitern, interessanter gestalten. Wir haben uns vor allem damit zum Ziel gesetzt, in die sich entwickelnden Diskussionen unter Kommunistinnen und Kommunisten auch auf diesem Weg einzugreifen, ihnen, falls notwendig, ein Forum zu geben. Das bedeutet zugleich, dass nicht alle an dieser Stelle veröffentlichten Beiträge die Meinung der Kommunistischen Initiative (KI) im Allgemeinen und des Vorläufigen Organisationskomitees (VOK) im Besonderen wiedergeben müssen. Wir wollen den Initiatoren aus der DKP unser neues Forum `Debatte´ anbieten, um eine Veröffentlichung und Diskussion ihrer Positionen jenseits von verdammenden Grenzen führen zu können.“ (Siehe: www. kommunistische-initiative.de)
Redaktion offen-siv
Hannover
Das Papier der 84
Den Gegenangriff organisieren – die Klasse gegen den Kapitalismus und für den Sozialismus mobilisieren!
Alles deutet daraufhin, dass nach der Bundestagswahl die Angriffe auf die sozialen, politischen und demokratischen Rechte massiv zugespitzt werden. Die Arbeiterklasse befindet sich in der Defensive, das Kräfteverhältnis ist schlecht. Die Aufgabe der Kommunisten ist es, erst recht in Zeiten der massiven Krise des Kapitalismus, Klassenbewusstsein zu verbreiten und zur Formierung der Klasse von einer Klasse „an sich“ zu einer Klasse „für sich“ beizutragen. Revolutionäre Politik in nichtrevolutionären Zeiten heißt vor allem, jedes fortschrittliche Interesse aufzugreifen und gemeinsam mit den Betroffenen Widerstand für die Durchsetzung dieser Interessen zu entwickeln. Das gilt auch für Abwehrkämpfe. Dabei gilt es zu verdeutlichen, dass es sich bei den Angriffen auf unsere Rechte nicht um einzelne Aktionen handelt, sondern dass sie Ergebnisse des Grundwiderspruchs unserer Gesellschaft, des Grundwiderspruchs zwischen Kapital und Arbeit sind. So kann in diesen Kämpfen Klassenbewusstsein entstehen. Das erfordert von den Kommu-nistinnen und Kommunisten die Entwicklung einer Interessenvertretungspolitik, vor allem in Betrieb und Kommune. Das erfordert von den Kommunistinnen und Kommunisten, Illusionen in den Kapitalismus nicht zuzulassen.
Das erfordert von den Kommunistinnen und Kommunisten, deutlich zu machen, dass eine sozialistische Gesellschaft notwendig ist, um die dringenden Probleme der Menschheit zu lösen und die Arbeiterklasse diese historische Mission zu erfüllen hat. Ansonsten droht der Menschheit die Barbarei. Wir meinen, dass die Diskussion und das Handeln dazu die Vorbereitung des 19. Parteitags der DKP prägen muss. Deswegen stellen wir dieses Papier zur Diskussion. Wir halten es für richtig, wenn dieses Papier diskutiert und weiterentwickelt wird. Wir halten es für richtig, wenn im Ergebnis dieser Diskussion auf dem Parteitag ein Krisenaktionsprogramm der DKP beschlossen wird. Dieses Papier ist dazu ein erster Entwurf.
1. Die Ursache der Krise ist der Kapitalismus
Angeblich ausgelöst habe die „Katastrophe“ die Finanzkrise in den USA, zurückzuführen vor allem auf die unersättliche Gier der Manager – so die vorherrschende Meinung in der Öffentlichkeit, auch bei den Gewerkschaften. Von „Raubtierkapitalismus“ oder „Casinokapitalismus“ ist die Rede, so, als ob alles nur Auswüchse eines an sich guten Systems wären.
Demgegenüber sagen wir Kommunisten:
Es ist die Krise des Kapitalismus, die in seinem Wesen begründet liegt – der Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung kommt in der Krise zum Ausdruck. Die größte Krise seit 1929 erschüttert die ganze Welt. Den Abwehrkampf gegen die Folgen der Krise aber können wir nur hier im eigenen Land führen: jede Arbeiterklasse muss zuerst mit der eigenen Bourgeoisie fertig werden - und dabei internationalistische Solidarität entwickeln.
Der Drang des Kapitals nach Maximalprofit und der Druck der Konkurrenz führen im Kapitalismus zu zyklischen Krisen, in denen sich die ungleichmäßige Entwicklung der Wirtschaftssektoren gewaltsam wieder ausgleicht. Gemessen an der kaufkräftigen Nachfrage wird zu viel produziert, die Krise ist also eine Überproduktionskrise. Obwohl ein Teil der Menschen im Reichtum fast erstickt, hungern Millionen. Im Kapitalismus wird nicht produziert, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um möglichst viel Profit aus den Arbeitenden zu pressen. Durch die negative Lohnentwicklung, den Sozialabbau und Geschenke der verschiedenen Regierenden konnte sich das deutsche Kapital in den letzten Jahren zum Exportweltmeister aufschwingen, was die Entwicklung verschärfte. Wenn jetzt die Exportmärkte ein-brechen, sind die Überkapazitäten entsprechend groß.
Krise heißt Vernichtung der überschüssigen Waren, Stilllegung von Pro-duktionsanlagen und Massenerwerbslosigkeit.
Finanzkrise
Weil die Profitrate (Verhältnis von erzieltem Gewinn zu eingesetztem Kapital) in der Industrie nur wenig gesteigert werden kann und sie in der Tendenz sogar fällt, fließt ein großer Teil der Gewinne der Kapitalisten nicht in den Produktionskreislauf zurück. Sie dienen zum Aufkauf anderer Unternehmen in Form von Kapitalexport oder sollen zu Extraprofiten im Kreislauf der Geld- und Finanzsphäre führen. Bereits in den letzten Krisen hatte sich das deutsche Finanzkapital – entstanden aus der Verflechtung von Großindustrie- und Bankkapital – den freien Zugang zu den internationalen Finanzmärkten stärker geöffnet. Die Finanzkrise ist die Folge der laufenden Überakkumulation im Kapitalismus.
Krise heißt Vernichtung des überschüssigen Kapitals.
Finanzkrise verstärkt Überproduktionskrise
So ergreift die Krise alle Bereiche: Börse und Banken, Industrie und Handel. Große Monopole wanken und kämpfen gegeneinander ums Überleben. Durch die Niederlage des Sozialismus und die Öffnung Chinas taten sich dem Kapital riesige neue, unerschlossene Märkte auf. Diese Phase neigt sich dem Ende zu. Die Welt ist wieder aufgeteilt unter den Imperialisten – jetzt können sie sich nur noch gegenseitig Einflusssphären abjagen: mit ökonomischem und politischem Druck mischen die wieder erstarkten deutschen Imperialisten mit, zunehmend gewaltsam.
Die Weltwirtschaftskrise verschärft die Konkurrenz unter den Monopolen und imperialistischen Staaten.
Allgemeine Krise des Kapitalismus
Der Imperialismus ist gekennzeichnet durch den Zwang des Monopolkapitals, seine Profite auf Kosten anderer Monopole sowie der nichtmonopolistischer Unternehmen und durch die erhöhte Ausbeutung der Werktätigen zu steigern. Dazu geht es immer größere Risiken ein. Gleichzeitig verschärfen sich die Probleme der Über-akkumulation, der chronischen Unterauslastung der Betriebe und der chronische Massenerwerbslosigkeit. Der Ausweg der Monopolbourgeoisie ist eine immer stärkere Unterordnung des Staatsapparats für ihre Ziele (der bis hin zum Faschismus führen kann), eine gesteigerte Militarisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Das hat die Verelendung von ganzen Ländern und Kontinenten und die rücksichtslose Ausplünderung der materiellen Ressourcen der Erde zur Folge, was als Armuts- und Hungerkrise sowie als Energie- und Umweltkrise in der Öffentlichkeit wahr-genommen wird.
Kapitalismus braucht Krieg und Militarisierung nach innen.
2. Die Krisenbewältigungsstrategie des deutschen Imperialismus
In dieser Situation kann nur der Staat als ideeller Gesamtkapitalist das Überleben der betroffenen Banken und Konzerne retten. Da sich in der Krise die Inter-essengegensätze zwischen den Monopolen verschärfen, treten Widersprüche zwischen ihnen deutlicher zu Tage. Die Theorie der Herrschaft eines transnationalen Kapitals, eines kollektiven Imperialismus, hat sich in der Krise als grundfalsch erwiesen. Die Monopole wollen die Krise bewältigen mit Hilfe ihrer Heimatbasis, den Nationalstaaten, die sie sich weitgehend untergeordnet haben. Diese haben die Aufgabe, die Profite des Finanzkapitals wieder zu stabilisieren, die Konzerne bei der Eroberung neuer Märkte zu unterstützen und die Krisenlasten auf die Bevölkerung abzuwälzen.
Die Verantwortlichen für die Krise werden von der Regierung an führender Stelle herangezogen: die Brandstifter dürfen sich beim Bankenrettungspaket als Feuerwehr betätigen. Das bürgerliche Parlament entrechtet sich selbst, es gibt sein ureigenstes Recht, die Budgetkontrolle, an das Finanzkapital ab. Da die Banken eng miteinander verflochten sind, darf keine untergehen, alle werden als „systemrelevant“ hingestellt - relevant sind sie jedoch nur für die Sicherung der Profite der Bourgeoisie und zur Rettung des Privateigentums an Produktionsmitteln.
Die Rettungsmaßnahmen für die Banken führen zu noch mehr Staats-verschuldung und so zu einer weiteren gigantischen Umverteilung von unten nach oben. Die nächste Krise wird bereits vorbereitet.
Verstärkte Zentralisation des Kapitals
Die Krise führt zu Pleiten, Übernahmen und Fusionen in großem Stil. Die Monopole nutzen ihre Schalthebel in der Staatsmaschine besonders in der Krise, um ihre Position im Konkurrenzkampf zu verbessern.
Der Staat treibt die Monopolisierung voran, um die Kapitalvernichtung möglichst auf Unternehmen und Banken anderer Staaten umzuleiten.
Konjunkturprogramme
„Konjunkturpakete“ heißen die Staatsverschuldungsprogramme zur Sanierung des deutschen Finanzkapitals. Sie enthalten drei Komponenten: 1. Öffentliche Investitionen, die eher kleinen und mittleren Unternehmen zugute kommen. 2. Nur geringe Maßnahmen für den privaten Konsum und für Qualifizierungsmaßnahmen. 3. Bürgschaften für Großunternehmen und die IT-Breitbandoffensive. Die Abwrack-prämie treibt kurzzeitig die Profite der anachronistischen Automobilindustrie in die Höhe. Mit der Kurzarbeit wird den meisten Unternehmen ein ordentlicher Lohnzuschuss gezahlt, was ihre Profite steigert. Die Milliarden, die den Banken in den Rachen geschmissen werden, müssen bei anderen Banken geliehen werden, und die Zinsen sorgen dort ebenso für steigende Profite. Die größten Konjunktur-programme für das Finanzkapital jedoch waren schon immer Rüstung und Krieg. Selbst die „keynesianischen“ Konjunkturprogramme der Bundesregierung der 70er Jahre gingen einher mit riesigen Aufträgen für die Rüstungsindustrie. Die letzten beiden großen Weltwirtschaftskrisen endeten jeweils im Weltkrieg. Auch heute steigt die Kriegsgefahr.
Der größte Anteil an den Konjunkturpaketen ist fürs Monopolkapital bestimmt.
In der Krise werden die Karten neu gemischt. Am Ende wird es eine neue Machtverteilung unter den Imperialisten geben.
Der deutsche Imperialismus will seine Stellung ausbauen.
Dazu will die Bourgeoisie die Krisenfolgen auf uns abwälzen: verstärkte Ausbeutung und Verelendung drohen.
Durch Massenerwerbslosigkeit und Kurzarbeit: Hunderttausende Leiharbeiter und prekär Beschäftigte stehen bereits auf der Straße. Doch spätestens nach der Bundestagswahl werden die Stammbelegschaften der Konzerne, aber auch von Klein- und Mittelbetrieben erfasst werden. Schon die offiziellen Schätzungen gehen von einem Ansteigen der Erwerbslosen auf über 5 Millionen Beschäftigte aus. Ein hoher Grad an Verarmung und Verelendung, wie er jetzt schon in Teilen Ostdeutschlands vorherrscht, wird große Teile der Bevölkerung erfassen.
Durch Lohnabbau: Die Konzerne fordern Einsparungen an Personalkosten in Milliardenhöhe. Die kampfstärksten Teile der deutschen Arbeiterklasse in der Autoindustrie haben bereits Zugeständnisse gemacht. Die Tarifrunden konnten die Preissteigerungen der letzten Jahre nicht ausgleichen.
Durch Sozialabbau: Der Druck auf die Empfänger von Hartz IV nimmt zu. Direkte Rentenkürzungen sollen zwar – vor der Wahl – ausgeschlossen werden, aber auch dauernde Nullrunden bedeuten nichts anderes. Die Beiträge der Gesetzlichen Krankenversicherung werden bei abnehmender Leistung steigen. Es droht eine neue Agenda 2010. Städte und Gemeinden werden durch die Krise noch stärker als bisher in die Schuldenfalle getrieben. Sie werden bald mit massiven Leistungsein-schränkungen und Preiserhöhungen bei den kommunalen Diensten reagieren. Gesetzlich abgesichert wird der Sozialabbau durch den Beschluss einer sog. „Schuldenbremse“: Bund und Länder werden schrittweise bis zum Jahr 2016 verpflichtet, die jährliche Neuverschuldung drastisch zu reduzieren. Da ist nichts mehr drin für Soziales.
Durch Erhöhung der Massensteuern: die Erhöhung der Mehrwertsteuer wird vor allem die Ärmsten treffen.
Die Jugend wird von allen Maßnahmen am meisten betroffen sein: bei der Erwerbslosigkeit ist sie überproportional betroffen, die Zahl der Ausbildungsplätze wird reduziert, das Recht auf Bildung steht nur noch auf dem Papier. Erst nach der Bundestagswahl wird die Arbeiterklasse mit diesen Maßnahmen offen konfrontiert werden – die DKP muss dazu beitragen, den Abwehrkampf zu organisieren.
Die politischen Maßnahmen der Bourgeoisie gegen die Krise sind:
Krieg nach außen...
Um sich im weltweiten Konkurrenzkampf zu behaupten, setzt das Monopolkapital auf Kriegseinsätze in aller Welt. Es geht um den Zugang zu Rohstoffen und Absatzmärkten, der auch mit Gewalt gesichert wird. In Afghanistan richtet sich die Bundeswehr auf lang andauernden Krieg und Besetzung ein – eine neue Stufe der Militarisierung. Als ideologische Begleitmusik fördert die Bundesregierung die Tradition des deutschen Militarismus durch öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr, Ordensverleihungen und Heldendenkmäler.
Die Jugend wird zunehmend wieder als Kanonenfutter verheizt, wobei insbesondere Jugendliche aus dem Osten ihrer perspektivlosen Lage dadurch zu entrinnen suchen.
... und Repression nach innen
Gleichzeitig wird eine „Heimatschutztruppe“ aus Reservisten als zweiter Gewaltapparat neben der Bundeswehr gebildet und der Einsatz der Armee im Innern vorbereitet. Das Technische Hilfswerk wird als Streikbrecherorganisation ausgebaut und die zivil-militärische Zusammenarbeit verstärkt. Dadurch werden zivile Organisationen wie das Rote Kreuz, die Feuerwehr, die DLRG und Krankenhäuser für militärische Aufgaben instrumentalisiert. Der Polizei- und Überwachungsapparat und die Geheimdienste werden seit Jahren ungebremst ausgebaut, Hartz IV-Empfänger ausspioniert. Unsere Rechte dagegen – wie das Versammlungs- und Demonstrationsrecht – werden verstümmelt und das Streikrecht angegriffen.
Der Staat begegnet der „Vertrauenskrise“ gegenüber dem Kapitalismus vorsorgend mit Unterdrückungsinstrumenten, die weit über die Notstandsgesetze hinausgehen.
Ideologische Offensive durch Nationalismus und Antikommunismus, Rassismus und Neofaschismus
Um die Akzeptanz für die staatliche Repression zu verbreitern, die Arbeiterklasse zu spalten, den Widerstand gegen die Krisenverursacher zu schwächen und linke Organisationen zu isolieren, verstärkt die Bourgeoisie den ideologischen Angriff. Der Nationalismus wird nicht mehr durch dumpfen Chauvinismus, sondern vor allem durch die Standortideologie in die Bevölkerung getragen. Um den Sozialismus als eine andere Gesellschaftsordnung, die weder Krise noch Krieg gegen unterdrückte Völker kannte, zu diskreditieren, wird gegen die VR China und vor allem gegen die DDR gehetzt. Der Rassismus soll die Solidarität in den Betrieben unterhöhlen und damit die Kampfbereitschaft schwächen. Insbesondere in der Form des Anti-islamismus sollen Kriege gegen „rückständige Völker“ und „Schurkenstaaten“ gerechtfertigt werden. Neofaschistische Organisationen werden nicht nur geduldet, sondern aktiv vom Staat unterstützt: durch Wahlkampfkostenerstattung aus der Staatkasse finanziert, mit Hilfe der Polizei vor den Antifaschisten bei öffentlichen Aufmärschen geschützt und durch Abschmettern des NPD-Verbots in ihrer Existenz bestätigt. Auch hier ist die Jugend von allen Teilen der Bevölkerung besonders gefährdet, auf die pseudo-antikapitalistische Demagogie der Faschisten hereinzufallen und als Hilfstruppe der Bourgeoisie missbraucht zu werden.
Die Folge ist ein beängstigendes Ansteigen des rechten Potentials, der rechten Gewalt und der neofaschistischen Gefahr.
3. Was macht den Bossen Dampf? Klassenkampf!
Der Multimilliardär Warren E. Buffet erklärte offen: „Es herrscht Klassenkrieg (...) und es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.“ Angesichts dieser Offenheit, ist es notwendig, dass auch wir erklären: Es herrscht Klassenkampf, ein Klassenkampf der Reichen. Und es gibt auf diesen Klassenkampf von oben nur eine wirksame Antwort: Den Klassenkampf von unten. Entscheidend wird sein, inwieweit es gelingt, die Kämpfe gegen die Offensive des Kapitals auszuweiten, zu intensivieren und ihnen eine Kontinuität zu verleihen. Die DKP sieht sich als Teil dieses Widerstandes und Mitglieder der DKP unterstützen diese Kämpfe in ihren Stadtteilen und Betrieben. Es ist von strategischer Bedeutung, dass die Arbeiterklasse ihr Selbstbewusstsein in diesen Klassenkämpfen wiedererlangt. Der Klassenkampf, der täglich vor unseren Augen stattfindet, hat viele Fronten – die sensibelste Stelle sind die Betriebe. In ihnen haben die Belegschaften die besten Ausgangsbedingungen, um die Kapitalisten an ihrer schwächsten Stelle zu treffen: Ihrem Profit. Mit Streiks, Betriebsbesetzungen bis hin zum Festsetzen von Managern und Geschäftsführern haben französische Kollegen gezeigt, wie die Antwort der französischen Arbeiterklasse auf die Krise lautet. Dies sind die klaren Antworten, die die Kapitalisten auch hier in der BRD brauchen und die einzigen, die sie verstehen. Um diesen notwendigen Klassenkampf in den Betrieben aufzunehmen, braucht die Arbeiterklasse eine kämpferische Gewerkschaft. Sozialpartnerschaftliche Illusionen und Lohnverzicht zur vermeintlichen „Standortsicherung“ schwächen die Gewerk-schaften und die gesamte Arbeiterbewegung. Die Mitglieder der DKP kämpfen deshalb zusammen mit anderen Kollegen – gleich welcher Weltanschauung, Herkunft oder Parteizugehörigkeit – in den DGB-Gewerkschaften für einen Konfrontationskurs mit den Kapitalisten.
Statt Abwälzung der Krise auf die Arbeiterklasse durch Lohnkürzungen, Entlassungen, Sozial- und Bildungsabbau setzen wir Kommunisten den Schwerpunkt auf den Kampf für:
Gesetzliche radikale Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personal-ausgleich. Leiharbeit und befristete Arbeitsverhältnisse müssen abgeschafft werden. Kampf um jeden Arbeitsplatz.
Weg mit der Rente mit 67. Absenken des Renteneintrittalters auf 60 Jahre.
Betriebliche Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen und unbefristete Übernahme im erlernten Beruf.
Einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro. Billig-Jobs müssen abgeschafft werden. Keine Absenkung der Löhne wegen der Krise.
Weg mit Hartz IV, das Erwerbslose zugrunde richtet und als Drohkulisse gegen die Belegschaften eingesetzt wird. Keine zeitliche Begrenzung beim Bezug von Arbeits-losengeld.
Stopp der Privatisierung.
Keinen Cent den Banken und Konzernen. Wir brauchen ein Sofortinvestitions-programm u. a. für kostenlose Bildung und Kinderbetreuung; Gesundheit für alle und nicht bloß für Reiche; Schluss mit Altersarmut und Pflegenotstand; Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus zur Absenkung der Mieten; Preissenkungen im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr.
Geld ist genug da: Die Reichen sollen zahlen! Millionärssteuer statt Mehr-wertsteuer!
Runter mit den Rüstungsausgaben!
Dieses Sofortprogramm wird äußerst schwer durchzusetzen sein. Die DKP ist sich darüber im klaren, dass solche Abwehrkämpfe weder im altbekannten Tarifpoker zwischen Gewerkschaftsführungen und Arbeitgeberverbänden noch in einem Betrieb allein erfolgreich geführt werden können. Der Abwehrkampf im Rahmen der Krise setzt das Vorgehen der gesamten Klasse und die Notwendigkeit neuer Kampfformen voraus, wie sie in anderen Ländern seit Jahren praktiziert werden: den politischen Massenstreik, der nur erkämpft werden kann. Diese Widerstandsformen der Arbeiterklasse sind es, die im Schulterschluss mit anderen sozialen Bewegungen das Rückgrat des Widerstandes in der BRD bilden und den Bossen Dampf machen können. Und dieser Widerstand ist es auch, der in der Lage ist, sich wirksam gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr, gegen Naziaufmärsche und staatliche Repressionen zu wehren. Natürlich ist es mit diesen Forderungen noch längst nicht getan. Doch erst der gemeinsame Kampf wird der Arbeiterklasse ein Bewusstsein ihrer selbst geben, ein Klassenbewusstsein bei ihr hervorbringen. Dann wird sie selbstbewusst die Ziele ihrer Kämpfe bestimmen und sich nicht mehr von den Gewerkschaftsführungen am Nasenring herum ziehen lassen. Dann wird sie auch in die Offensive übergehen – nur im Kampf lernt sie ihre eigene Kraft, aber auch den Gegner und ihre Bündnispartner besser einzuschätzen.
Die DKP muss auch Forderungen diskutieren, die über die dringendsten Notwendigkeiten hinausgehen. So brauchen wir z. B. ein kostenloses Gesund-heitssystem, das nicht dem Profit unterworfen ist, den Umbau der Verkehrssysteme und den Wechsel zu alternativen, erneuerbaren Energien, um den Klimawandel zu stoppen. Wir benötigen andere Städtebaukonzepte, andere Massenmedien und eine alternative Kultur. Um den Kommunen wieder Luft zum Atmen zu verschaffen, müssen die kommunalen Schulden restlos gestrichen werden. Diese Diskussionen müssen die Frage nach den Grenzen des kapitalistischen Systems aufwerfen bzw. nach der Notwendigkeit eines Gesellschaftssystems, das nicht dem Profitprinzip unterworfen ist.
Grundstrukturen der kapitalistischen Wirtschaft angreifen
Wir wissen, dass im Kapitalismus alle im Klassenkampf errungenen Erfolge, alle Reformen, immer wieder vom Kapital in Frage gestellt und je nach dem Kräfte-verhältnis beseitigt werden. Wenn wir nicht die Eigentumsverhältnisse selbst angreifen, werden große Teile der Klasse immer wieder auf das Existenzminimum zurückgeworfen.
Vergesellschaftung der Banken
Der Finanzsektor besitzt eine hohe strategische Bedeutung für das ganze kapitalistische System. Durch die Krise hat die Forderung nach Verstaatlichung der Banken eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung gewonnen. Doch so lange der Kapitalismus herrscht, sind alle Banken bei Strafe des Untergangs den Gesetzen der kapitalistischen Ökonomie und der Konkurrenz unterworfen - die Kapitaleigenschaft wird auch durch die Verwandlung in Staatseigentum nicht aufgehoben. (Die Mehrheit der Banken befindet sich ohnehin bereits in der Hand des Staates.) Diese Forderung in der aktuellen Situation an den kapitalistischen Staat zu stellen, schürt nur Illusionen in seine Überparteilichkeit.
Eine Vergesellschaftung der Banken mit demokratischer Kontrolle setzt mindestens ein Klassengleichgewicht zwischen der Bourgeoisie auf der einen Seite und dem Proletariat mit seinen Bündnispartnern auf der anderen Seite voraus. Denn eine Vergesellschaftung des Bankensektors wäre nichts weniger als die Entmachtung des Finanzkapitals. Dieses wird seine Enteignung mit allen Mitteln zu verhindern wissen, d.h. mit dem Einsatz von Polizei und Armee. – In revolutionären Zeiten allerdings kann die Forderung mobilisierende Wirkung haben, kann sie die Perspektive für den Sozialismus öffnen helfen.
Die Vergesellschaftung des Bankensektors erfordert die politische Macht im Staat durch das Proletariat und seine Bündnispartner, d.h. den Sozialismus.
Wirtschaftsdemokratie
Auch die Industriebetriebe bedürfen einer Kontrolle der Arbeiterklasse, um eine Produktion durchzusetzen, die der Gesellschaft dient und nicht den Profitinteressen weniger Kapitalisten. Die Forderung nach Mitbestimmung im Betrieb, die Kontrolle der Produktion durch die Belegschaften ist so alt wie die Arbeiterbewegung. Mit der Einsetzung von „Wirtschafts- und Sozialräten“, wie sie die IG Metall vorschlägt, oder mit einem „Parlament der Wirtschaftsdemokratie“ (isw) würde tief in das Eigen-tumsrecht der Kapitalisten eingegriffen - wenn sie denn wirklich entscheidende Befugnisse über Art und Umfang der Produktion, über Entlassungen und Arbeits-bedingungen hätten und nicht nur Kredite für die Kapitalisten und Kommunen organisieren sollten. Das können zwar Ansätze für den Klassenkampf sein, aber die Durchsetzung von wirklicher Mitbestimmung durch Fabrikräte z. B. wird eine bisher nicht erreichte Stärke im Klassenkampf erfordern, wie sie in Deutschland 1918/19 nur kurz sichtbar wurde.
Demokratie in der Wirtschaft und Vergesellschaftung der Produktion erfordern die Macht im Staat, d. h. den Sozialismus.
Das Ziel der DKP ist der Sozialismus
Alle Kämpfe gegen die Abwälzung der Krisenlast auf die Arbeiterklasse bleiben perspektivlos ohne gesellschaftliche Alternative. Wer den Kapitalismus als Ende der Geschichte akzeptiert, wird selbst tagespolitische Kämpfe mit Verzichtsgedanken im Kopf führen, wird sich arrangieren. Wer die Diktatur des Kapitals, den bürgerlichen Staat, akzeptiert wird Illusionen schüren und Kämpfe lähmen. Der Kapitalismus hat kein Problem der Menschheit gelöst. Es geht um die Befreiung der Arbeit als wichtigste Quelle allen gesellschaftlichen Reichtums von den Zwängen der Profitwirtschaft. Eine Gesellschaft, die sich bewusst auf diesen Weg begibt, ist in der Lage, die Arbeit vernünftig einzusetzen, um Gesundheit, Bildung, Wohnraum, Verkehr und Infrastruktur, technischen Fortschritt im Interesse der arbeitenden Menschen zu gestalten. Der hohe Grad der Vergesellschaftung der Produktion, der bereits jetzt existiert, schreit danach, die Eigentumsverhältnisse dem anzupassen. Die objektiven Verhältnisse sind längst reif für den Sozialismus. Dieser wird aber nicht durch „transformatorisch wirkende Reformen“ (isw) zu erreichen sein, sondern nur durch härtesten Klassenkampf um die politische Macht.
Sozialismus oder Barbarei! Für eine Gesellschaft ohne Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung!
Die folgenden Genossinnen und Genossen unterstützen das Grundanliegen dieses Papiers, dies schließt Kritik in Einzelfragen nicht aus:
Sebastian Bahlo (Frankfurt); Marion Baur (Irland); Jürgen Beese (Essen); Erika Beltz (Gießen); Michael Beltz (Gießen); Markus Bernhardt (Berlin); Mario Berrios (Wildau); Achim Bigus (Osnabrück); Björn Blach (Stuttgart); Daniel Bratanovic (Trier); Sebastian Carlens (Göttingen); Fritz Dittmar (Hamburg); Hans Dölzer (Hirschberg); Helmut Dunkhase (Berlin); Anke Dussman (Essen); Monika Ebert (Mannheim); Manfred Feldmann (Landshut); Werner Feldmann (Augsburg); Dieter W. Feuerstein (München); Pablo Graubner (Marburg); Marc Galwas (Berlin); Wolfgang Garbers (Hamm); Hermann Glaser-Baur (Irland); Günter Gleising (Bochum); Michael Götze (Hamburg); Ina Gold (Stuttgart); Ulrike Grotehusman (Hamburg); Michael Grüß (Berlin); Heinz W. Hammer (Essen); Olaf Harms (Hamburg); Andreas Hartle (Hannover); Christoph Hentschel (München); Wolfgang Herrmann (Dreesch); Hans Heinz Holz (S. Abbondio); Matthias Hör (Augsburg); Heide Humburg (Bremen); Andreas Hüllinghorst (Berlin); Ludwig Jost (München); Hans-Joachim Knoben (Bonn); Patrik Köbele (Essen); Toni Köhler-Terz (Jena); Detlef Krüger (Schöneiche); Manfred Kriegeskorte (Wiehl); Axel Koppey (Rödermark); Thomas Knecht (Friedrichsdorf); Günther Klein (Stuttgart); Dietmar Koschmieder (Berlin); Simon Lochmann (Trier); Anton Latzo (Langerwisch); Stefan Lorenzen (Hamburg); Thomas Lühr (Marburg); Johannes Magel (Hannover); Siw Mammitzsch (Essen); Jutta Markowski (Essen); Stefan Marx (Illigen); Mathias Meyers (Mainz); Brigitte Müller (Wansdorf); Wolfgang Müller (Regensburg); Renate Münder (München); David Nagelsmann (Dortmund); Stefan Natke (Berlin); Uwe Nebel (Mannheim); Tobias Niemann (Wuppertal); Ghassem Niknafs (Hamburg); Rainer Perschewski (Berlin); Dietmar Petri (Wiehl); Sabine Petz (Regensburg); Jörg Pflüger (Hamburg); Klaus von Raussendorff (Bonn); Wera Richter (Berlin); Wolfgang Richter (Dortmund); Gerd-Rolf Rosenberger (Bremen); Tina Sanders (Hamburg); Ansgar Schmidt (Münster); Nadja Schmidt (Mühlacker); Roland Schmidt (Mannheim); Hans-Günter Szalkiewicz (Berlin); Jan Tacke (Dortmund); Gregor Thaler (München); Ursula Vogt (Regensburg); Peter Willmitzer (München); Holger Wendt (Bochum); Michael Weisser (Bonn); Thomas Wolf (München)
Frank Flegel: Überblick über die Diskussion
Ich habe mir die Diskussionsbeiträge angesehen und sie in ihren Argumentationen geordnet. Mehrere Diskussionsstränge lassen sich unterscheiden. Es gibt:
1. den Vorwurf des Linksradikalismus,
2. die Bagatellisierung,
3. widersprüchliche Beiträge, die sich mit der Diskussionskultur befassen.
Zum Schluss dokumentieren wir den Diskussionsbeitrag von Wolfgang Herrmann, der im Vorspann für diesen gesamten Schwerpunkt schon im Zitat von Rolf Priemer genannt wurde.
Die Beiträge sind im folgenden auszugsweise wiedergegeben – geordnet nach den inhaltlichen Schwerpunkten.
Redaktion offen-siv, Frank Flegel, Hannover
1. Vorwurf des Linksradikalismus, des Putschismus, der Selbstüberschätzung und der Fraktionsbildung:
Heinz Stehr: „Zum Problem und zur Belastung der innerparteilichen Demokratie werden Meinungsunterschiede auch, wenn - wie jetzt wieder – Positionspapiere, versehen mit Unterschriften von Genossinnen und genossen, veröffentlicht werden, die unseren programmatischen Aussagen widersprechen. Ein solches, sich wieder-holendes Vorgehen birgt die Gefahr der Fraktionierung der DKP“ (Heinz Stehr, Rede auf der 8. Tagung des PV der DKP)
Heinz Stehr: „Das Profil der DKP ist gefährdet durch sektiererische Verengung und dogmatische Positionen. Heute ist auf der Grundlage unseres Programms eine politische Alternative zu entwickeln, die mehrheitsfähig wird in der Bevölkerung. Ihr Hauptinhalt müssen die Forderung nach Frieden, sozialer Sicherheit, mehr Demokratie, Antifaschismus, Bildung, Kultur sein. Dazu darf man sich nicht durch Verengungen und Sektierertum von der Mehrheit der Menschen entfernen und isolieren.“ (Heinz Stehr, Rede auf der 8. Tagung des PV der DKP)
Rolf Priemer: „Den Diskussionsbeitrag von Wolfgang Herrmann, der inzwischen auf eigenen Wunsch aus dem Parteivorstand ausgeschieden ist, habe ich aufmerksam gelesen. Sein Anliegen läuft auf die Organisierung eines Putsches von Revisionisten und Sektierern zusammen mit Teilen der SDAJ gegen den Parteivorstand hinaus. Das muss verhindert werden durch die Delegierten des Parteitages. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Unterzeichnerinnen und Unterzeichner den Ansinnen von Wolfgang Herrmann folgen wollen.“ (Rolf Priemer, www.kommunisten.eu)
Frank Dähle: „Eine Betrachtung des – durch jahrzehntelange Sozialpartnerschaft und vielfältige Beeinflussung durch im Wesentlichen kapitalistische Medien geprägte – Massenbewusstsein könnte die AutorInnen ggf. zu der Erkenntnis führen, dass der Kampf um eine sozialistische Perspektive offensichtlich nur in Etappen erfolgen kann. Eine solche Erkenntnis passt aber nicht in das hier vertretene irreale Konzept einer `Offensivstrategie´. Hier wird es nicht reichen, der Arbeiterklasse zu sagen, dass sie ihre historische Mission zu erfüllen hat!“ (Frank Dähle, www.kommunisten.eu)
Willi Gerns: „Ein solches Herangehen widerspricht nicht nur unserem aktuellen Parteiprogramm, sondern der seit Konstituierung der DKP 1968 erarbeiteten strategischen Orientierung des Kampfes um antimonopolistische Übergänge, mit denen der Weg zum Sozialismus geöffnet werden soll.“ (Willi Gerns, www.kommunisten.eu)
Thomas M.: „Das Papier `Den Gegenangriff…´ ist so dürftig, dass es nicht als Grundlage einer Debatte geeignet ist, höchstens als Indikator für deren Notwendigkeit. Einerseits gibt’s viel Allgemeinplätzliches, einen Haufen allseits anerkannter Grundlagen kommunistischer Politik, teils auch von niemandem bestrittene richtige Orientierungen. Andererseits eine Fülle realitätsferner links-radikaler Phrasen. (…) Man erkennt in `Gegenangriff´, `ìn die Offensive übergehen´, `Eigentumsverhältnisse selbst angreifen´, `politischer Massenstreik´, `härtester Klassenkampf um die politische Macht´ sofort die nackte voluntaristische linksradikale Phrase.“ (Thomas M., www.kommunisten.eu)
Robert Steigerwald: „Da haben wir auf der einen Seite unsere Partei mit ihren ungefähr vier- bis fünftausend Mitgliedern, deren Durchschnittsalter eher bei den 60 als bei den 50 Jahren liegt, deren Mitglieder schon aus diesen Gründen nur noch wenig in Betrieb und Gewerkschaften aktiv sein können. Das wäre unser `Potential´ für den `Gegenangriff´. Und bei diesem Unternehmen würden wir in einer Bevölkerung wirken, die uns gerade – wie uns die jüngsten Wahlen zeigten – selbst bei aktivstem und einfallsreichstem Wahlkampf gerade so 0,1 Prozent ihrer Stimme gegeben hat. Und der Gegner ist keineswegs waidwund! Hervorragende Bedingungen für einen `Gegenangriff´! Ist dies das richtige, wissenschaftliche, marxistische Herangehen an die Erarbeitung eines `Krisenaktionsprogrammes´ zur Vorbereitung des Parteitages?“ (Robert Steigerwald, www.kommunisten.eu)
Mirko Knoche: „`Wir müssen französisch lernen´. `Wir brauchen den Generalstreik´. Mit Verlaub, Genossen – das kennt man zur Genüge aus dem Mund von SAV und Linksruck.“ (Mirko Knoche, www.kommunisten.eu)
Rolf Priemer: „Da muss man den Text lesen. Im Kern läuft er darauf hinaus, dass das Parteiprogramm, über dessen Erarbeitung unter vielen Mühen 16 Jahre gestritten und über das schließlich 2006 mit großer Mehrheit der Parteitagsdelegierten entschieden wurde, revidiert werden soll. Die Begründungen dafür erscheinen mir äußerst dünn, rechthaberisch, allein seligmachend für und bestätigend der eigenen Position.“ (Rolf Priemer, www.kommunisten.eu)
Klaus Mausner: „Aus diesem Positionspapier spricht viel revolutionäre Ungeduld! So sehr man diese auch emotional verstehen kann, so wenig hilft das wirklich. Nach einer alten Erkenntnis wächst das Gras nicht schneller, wenn man an den Halmen zieht. (…) Ich kann den im Positionspapier sich immer wieder durchziehenden linksradikal-sektiererischen Touch nicht billigen. Wenn er sich in unserer Partei durchsetzen würde, wäre es nach meiner Überzeugung von erheblichem Schaden. (…) Ich fordere dementsprechend die Verfasser auf, ihre Positionen selbstkritisch zu überdenken und das Papier zurückzuziehen! Damit wäre auch eindeutig die Gefahr einer Fraktionierung unserer Partei beseitigt,…“ (Klaus Mausner, www.kommu nisten.eu)
Jane Zahn: „Statt verbalradikaler Attacken brauchen wir den Mut, sich in der Öffentlichkeit und in Bündnissen mit unseren Positionen zu stellen. Und zwar mit unserem Parteiprogramm. Und nicht mit Selbstüberschätzung.“ (Jane Zahn, www.kommunisten.eu)
Dieter Keller: „Geradezu selbstherrlich halte ich die Feststellung: `Das erfordert von den Kommunistinnen und Kommunisten, Illusionen in den Kapitalismus nicht zuzulassen.´ Da liegen nun Anspruch und Wirklichkeit gleich millionenfach auseinander. Da sollen 5.000 Kommunistinnen und Kommunisten mit ihren be-grenzten Möglichkeiten, die darüber hinaus kaum noch in Betrieben organisiert sind, keine Illusionen zulassen bei 42 Millionen Beschäftigten. Das soll mir mal eine/einer sagen, wie das möglich ist.“ (Dieter Keller, www.kommunisten.eu)
Walter Listl: „Die schematische Vorstellung, die Vergesellschaftung des Banken-sektors und der Produktion oder Demokratie in der Wirtschaft erforderten zunächst die Macht im Staat, d.h. den Sozialismus, wie im Papier behauptet, negiert die Erkenntnis, dass gerade der Kampf um diese Veränderungen Teil eines gesell-schaftlichen Transformationsprozesses sein muss, wenn daraus eine anti-kapitalistische und sozialistische Gesellschaft entstehen soll. Die Eigentums- und Wirtschaftsdemokratiefrage auszuklammern, solange Kapitalismus herrscht, heißt, darauf zu verzichten, das Profitprinzip anzugreifen. (…) Geradezu schädlich ist wird das Gegenangriffpapier, wenn es um die Einschätzung der Arbeiterklasse und der Rolle der Gewerkschaften geht. Die Arbeiterklasse, heißt es da, dürfe sich `nicht mehr von den Gewerkschaftsführungen am Nasenring herumziehen lassen´. Dieses Bild ist nicht nur dumm, weil es die Schwäche der Arbeiterbewegung auf den angeblichen oder tatsächlichen Verrat sozialdemokratischer Gewerkschaftsführer reduziert, sondern auch mit Grundpositionen unserer Partei nicht vereinbar. (…)
Wenn man natürlich die Existenz transnationaler Konzerne bestreitet, in der heutigen kapitalistischen Globalisierung nichts qualitativ Neues entdeckt und ignoriert, wie sich dadurch die Kräfteverhältnisse zuungunsten der Arbeiterbewegung verschoben haben, dann bleibt ja als Erklärung fast nur noch der Verrat. Diese Gründe zu analysieren ist natürlich umständlicher, als das Bild einer Zuchtbullenauktion zu bemühen. Aber auch hier lohnt sich der Blick in das Parteiprogramm der DKP. (Walter Listl, www.kommunisten.eu)
2. Bagatellisierung
Leander Sukow: „Das Positionspapier `Den Gegenangriff organisieren…´ kann jeder Kommunist getrost unterschreiben. Es tut gar nicht weh. Allerdings hilft es auch nicht weiter. Denn das Papier ist deshalb jederzeit unterschreibbar, weil es sich auf eine eigentümliche Art im Nichts bewegt. Es ist eine Aneinanderreihung von Maximal- und Minimalforderungen im gegenwärtigen Gesellschaftszustand.
All das, was dort steht, ist Allgemeingut; jedenfalls weitgehend. Man mag sich über die Frage der Transnationalität streiten. Man kann es aber auch lassen. (…) Mir liegt das wesentlichste Loriot-Zitat auf der Zunge, wenn es um dieses Papier geht: `Ach´.“ (Leander Sukow, www.kommunisten.eu)
3. Zur Diskussionskultur
Gerd-Rolf Rosenberger: „Es ist gut, dass das Positionspapier veröffentlicht und zur Diskussion gestellt wird. Und vielleicht auch eine breite Debatte in den Kreisen und Gruppen geführt wird, aber bitte nicht so, dass Genossinnen und Genossen, weil sie das Papier unterschrieben haben, diszipliniert werden. (…) Es ist sehr schade, dass das Positionspapier nicht in der UZ veröffentlicht wird. Da gehört es genauso rein, wie zu überlegen ist, in absehbarer Zukunft eine ganze Zeitungsseite in der UZ für solche Diskussionen und Leserbriefe zu öffnen.“ (Gerd-Rolf Rosenberger, www.kommunisten.eu)
Herbert Münchow: „Sicherlich ist an dem Papier einiges zu diskutieren – m.E. auch zu ändern bzw. richtiger darzustellen – aber es mit dem Bannstrahl des Linksradikalismus zu belegen, ist unerhört. Weitaus problematischer waren da die Äußerungen des Parteivorsitzenden zur Linkspartei während des Wahlkampfes – Linksradikalismus war das nicht, aber bereits eine Art Selbstaufgabe. Warum kann dieser Text nicht in die UZ? Beherrscht der PV diese Debatte nicht? Wenn man sich auf das Parteiprogramm beruft, was richtig und notwendig ist, dann aber nicht nach dem Auswahlprinzip `Wie es Euch gefällt´. (Herbert Münchow, www.kommu nisten.eu)
Leander Sukow: „Kritisiert wird dabei, dass die Diskussion in einzelnen Landes-verbänden, Kreisen und Gruppen nicht in dem Maße in die Diskussion der Gesamtpartei einfließen können, welches nach Meinung der Kritiker notwendig wäre, um zu einem offenen Diskussionsprozess und damit zu einer neuen Einheit zu kommen. Dieser Vorwurf erscheint mir richtig zu sein. Es ist versäumt worden, Plattformen – z.B. im Internet – zu schaffen, die eine umfangreiche Vordiskussion ermöglichen und der Berichterstattung aus den Gliederungen gedient hätten. Der Parteivorstand hat es nicht nur versäumt, die Diskussion zu ermöglichen, er hat sie sogar – z.B. in der Yahoo-Mailingliste `dkp-im-netzt´ verhindert.“ (Leander Sukow, www.kommunisten.eu)
Klaus Köhler/Walter Herbster: „Aktive und bekannte GenossInnen haben sich Gedanken zur aktuellen politischen Lage und zur Zukunft der DKP gemacht. Das ist gut so. Dass dies durch unterschriebene Positionspapiere neben den DKP-Strukturen geschieht, um sich Mehrheiten zu verschaffen, ist zu kritisieren. Jedoch: Die Diskussion wird derzeit in den Strukturen der DKP geführt, und die Partei wird dies – so hoffen wir – aushalten und positiv zur Klärung und Weiterentwicklung nutzen. Wir erwarten diese Diskussion innerhalb der DKP, bei Respektierung des Rechts, immer und jederzeit die Meinung äußern zu können.“ Klaus Köhler/Walter Herbster, www.kommunisten.eu)
Volker Metzroth: „Es ist kein Ausdruck von kommunistischer Diskussionskultur, aber vielleicht ein gezieltes Manöver, wenn zu jedem möglichen Anlass der Partei Diskussionen über Papiere aufgenötigt werden, die unserer Programmatik widersprechen. (…) Während der jüngsten Bezirksvorstandssitzung diskutierten vier Parteigenerationen über die Situation der Partei. Die Einschätzung war einstimmig: das 84er-Papier hilft uns nicht weiter, es nötigt uns Diskussionen auf, die uns nicht voran bringen, es birgt die Gefahr einer Fraktionierung der Partei in sich. (Volker Metzroth, www.kommunisten.eu)
Wolfgang Herrmann: Grundsätzliches Umdenken über den Kurs der Partei erforderlich
„Da haben wir den Salat.
Ihr habt es alle gelesen, das Referat des Vorsitzenden der DKP, Genossen Heinz Stehr, auf der 8. Tagung des Parteivorstandes.
Das Krisenpapier der 84 wurde versenkt. Auf die Internetseite der Eurokommunisten `kommunisten.eu´, auf die Werbeseite des Parteivorstandes „DKP und die EL“. Dort nun soll der Aufruf zum Umsteuern diskutiert werden. Heinz Stehr meint im Referat, dass `wir nach 1990 eine DKP wollten, zu der auch notwendiger Meinungspluralismus, Diskussion, Streit und das Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit gehören.´ Wenn aber ein auf Meinungspluralismus basierender Streit beginnt, dann ist das nach Heinz Stehr eine Belastung der innerparteilichen Demokratie. `Zum Problem und zur Belastung der innerparteilichen Demokratie werden Meinungsunterschiede auch, wenn - wie jetzt wieder - Positionspapiere, versehen mit Unterschriften von Genossinnen und Genossen, veröffentlicht werden, die unseren programmatischen Aussagen widersprechen. Ein solches, sich wiederholendes Vorgehen birgt die Gefahr der Fraktionierung der DKP.´(…)
Es ist leider harte Realität, dass der mit der Programmannahme gesteuerte Kurs des Parteivorstandes die DKP in eine Krise geführt hat. Um aus ihr heraus zu kommen, muss umgesteuert werden. Ansonsten brauchen wir den 19. Parteitag nicht mehr!
Ich hatte dem Krisenpapier zugestimmt. Ich hatte aber auch gemeint, dass es nicht mehr ausreicht. Wenn wir das Ruder in der DKP herumreißen wollen, dann müssen wir es dem Steuermann aus der Hand nehmen.
Unsere Gruppe hat sich bereits mit dem Zustand der DKP beschäftigt und ihre Meinung in „`Umdenken´ und `Umsteuern´ zum Ausdruck gebracht. Wir rufen auf!“ (Wolfgang Herrmann, www.kommunisten.eu)
Fritz Dittmar: Leserbrief an die UZ
Fritz Dittmar: Vorbemerkung an die Leser/innen der „offen-siv“.
Liebe Genossen!
Es ist nicht so, dass die UZ keine kritischen Leserbriefe bringt. Ich war jedenfalls erst mal positiv überrascht, dass sie meinen Brief zu Hans-Peter Brenner nicht einfach ignoriert haben. Er war eine Antwort auf zwei Seiten UZ, und ein Leserbrief der üblichen Länge konnte keine angemessene Erwiderung sein. Mein Text komplett hätte vielleicht ein Fünftel des Brenner-Textes[6] ausgemacht. In dem Text, den ich euch schicke, habe ich die ausgelassenen Stellen unterstrichen. Jeder möge selbst entscheiden, ob die Kürzungen den Text verharmlosen sollen.
Fritz Dittmar, Hamburg
Leserbrief an die UZ
Hans-Peter Brenner hat im August/September 09 in der UZ zur Frage revisionistischer Tendenzen in der DKP einen Artikel geschrieben: „ `Revision´ oder notwendiger Erkenntnisprozess?“. Darin betont er die Übereinstimmung der DKP-Politik mit der wissenschaftlichen Methode von Marx, Engels und Lenin: Revisionismus, sagt er, gab es, z.B. bei Kautsky mit seinem „Ultraimperialismus“ und dessen angeblicher Friedensfähigkeit, auch im Eurokommunismus in den siebziger Jahren, auch noch in der Strömung der „Neuerer“ in den Achtzigern (und womöglich auch noch bei Gorbatschow?), aber heute ist für ihn die Welt der DKP nach dieser Seite hin zum Glück in Ordnung. Irgendwelche aktuellen revisionistischen Tendenzen erwähnt er nirgends.
Damit negiert er Lenin. Der schreibt in „Der linke Radikalismus“: „(Erstarkt ist der Bolschewismus) erstens und hauptsächlich im Kampf gegen den Oppor-tunismus…Das war natürlich der Hauptfeind des Bolschewismus innerhalb der Arbeiterbewegung.“
Wie Hans-Peter betont, ist ein solches Zitat kein Beweis. Aber innerhalb des Marxismus-Leninismus wäre natürlich derjenige beweispflichtig, der die Notwendigkeit bestreitet, den Kampf gegen den Revisionismus und Opportunismus beständig zu führen. Er würde in Frage stellen, was unter Marxisten Konsens sein sollte: Die kommunistische Politik wird nicht „unter einer Käseglocke“ entwickelt, sondern beständig durch die Einflüsse des herrschenden bürgerlichen Bewusstseins bedroht. Dagegen muss sie verteidigt werden, auch innerhalb der Partei. Jede andere Sichtweise wäre undialektisch, solange der Kapitalismus Kapitalismus bleibt.
Und einen Beweis für das Gegenteil bleibt Hans-Peter schuldig. Seine Argumentation gegen Parallelen zwischen Kautskys „Ultraimperialismus“ und Tendenzen bei führenden DKP-Politikern ist nicht stichhaltig. Ich erinnere an den Entwurf zum neuen DKP-Programm.
Im Entwurf der hochrangig besetzten Kommission stand eine „neue“ Analyse des heutigen Imperialismus. Sie begann mit den Transnationalen Konzernen, Konzerne, die keinem Nationalstaat zuzuordnen sind, sondern gemeinsam die Nationalstaaten erpressen, ihnen freie Bahn für Produktion, Handel und Spekulation zu schaffen. Diese TNK schloss der Entwurf zu einer neuen, weltweit herrschenden Klasse zusammen, einer Transnationalen Monopolbourgeoisie. Diese legt sich ein Trans-nationales Kontrollgremium zu, das mit einer eigenen Gewaltmaschinerie ausgestattet ist, zur Sicherung ihrer Herrschaft und zur Regelung zwischenimperialistischer Widersprüche. So etwas wäre, wenn es denn entstehen würde, ansatzweise ein Weltstaat.
Gäbe es ein solches funktionierendes, mit Gewaltmitteln ausgestattetes Inter-nationales Kontrollsystem, so wäre es seine Aufgabe, die Gefahr großer militärischer Konflikte zu bannen. Mit einem Wort, es würde die Welt und den Imperialismus friedensfähig machen. Dennoch soll das alles nach Hans-Peter nichts mit Kautskys Ultraimperialismus haben. Er behauptet: „Kein…verantwortlicher Funktionär und Theoretiker der DKP vertritt aber diese reformistische Meinung.(eines friedenfähigen Imperialismus)“
Nun könnte er darauf hinweisen, dass dem Entwurf im beschlossenen Programm die schlimmsten revisionistischen Giftzähne gezogen wurden: Von „Transnationaler Monopolbourgeoisie“ und Internationaler „Gewaltmaschinerie“ ist im Programm nicht mehr die Rede. Aber die Verfasser des Entwurfs sind immer noch in wichtigen Funktionen, und von den Ideen des Entwurfs sind sie meines Wissens nicht abgerückt.
Und diese falschen Ideen wirken weiter, auch in Hans-Peters Artikel hinein. Er skizziert ausführlich die Entwicklung von Bündnissen und Absprachen der imperialistischen Großmächte von vor dem ersten Weltkrieg bis zu den G5- und G7- Gipfeln von heute: Warum er den Kritikern der Revisionismus dabei unterstellt, ihrer Kritik läge „eine Unkenntnis der bereits zu Lebzeiten Lenins bestandenen innerimperialistischen Bündniskonstellationen zu Grunde“, verstehe ich nicht. Ich wusste auch vor seinem Artikel davon und habe z.B. die Bündnisse vor dem ersten Weltkrieg nicht als Schritte zur Verhinderung des Kriegs gewertet, sondern als Schritte der Vorbereitung auf den Krieg. Die imperialistischen Hauptmächte suchten sich ihre Bündnissysteme zusammen, um sich für den kommenden Krieg zu stärken. Und ähnliches gilt auch heute. Sicher hat Hans-Peter Recht, wenn er sagt, dass man die Politik der BRD nicht mit der des Deutschen Imperialismus von 1933 bis 1945 vergleichen kann. Aber wie erklärt er die Verpflichtung zu ständiger Aufrüstung im Lissabon – Vertrag der EU, wie das enorm teure Galilei-Satellitenprogramm, das die EU vom GPS der USA unabhängig machen soll? Eher passt der Vergleich zu 1928, wo die SPD das Panzerkreuzer-Programm durchzog, aus dem die „Schleswig-Holstein“ stammte, die dann zehn Jahre später mit der Beschießung der Westerplatte den zweiten Weltkrieg eröffnete.
Dazu, dass auch heute innerhalb der DKP der Revisionismus bekämpft werden muss, zwei Beispiele:
Der stellvertretende Parteivorsitzende Leo Mayer erklärt, dass die Zusammenarbeit mit der Linken Vorrang vor der Kritik an ihr haben müsse. Demnach wäre Kampf gegen den Revisionismus manchmal nötig, manchmal überflüssig, sogar gegen den Revisionismus außerhalb der Partei. Der Vorsitzende Heinz Stehr schreibt in der UZ, was er eigentlich den Bayer-Aktionären sagen wollte: dass im Mittelpunkt der Konzernstrategie der Mensch stehen müsse. Demnach brauchen wir keine Revolution mehr, sondern nur eine erfolgreiche Aufklärung der Kapitalisten über ihre eigentliche Aufgabe.
Für mich sind das Gründe genug. Ich frage mich, ob Hans-Peter die Gefahr des Revisionismus tatsächlich nicht sieht, oder ob er sie bewusst vertuscht.
Fritz Dittmar
Hamburg
Politische Ökonomie des Sozialismus |
Kommunistische Initiative Österreich/Gerfried Tschinkel
Interview mit Hermann Jacobs: "Mit nunmehr aller Konsequenz"
Zur Debatte über Warenproduktion im Sozialismus
Du schreibst, in „offen-siv“ wird eine Diskussion zu Ende geführt, die die sozialistische Wissenschaft begonnen, aber nicht vollendet hat. Gemeint ist die Diskussion über die Warenproduktion in nachkapitalistischen Gesellschafts-ordnungen. Wie ist der Stand der Diskussion und wo machst du den Dissens-Punkt in der sozialistischen (oder auch kommunistischen) ökonomischen Wissenschaft, von dem du sprichst, aus?
Ja, das ist richtig, „offen-siv“ leistet einen Beitrag, eine Debatte zu Ende zu führen. Zu Ende heißt: bis zur Klärung des Problems. Wir wollen wirklich klären helfen, was es mit der Frage der Warenökonomie im Sozialismus – und im Grunde darüber hinaus – auf sich hat, inklusive praktischer Konsequenzen. Bei der Anlage, die diese Debatte in der Sowjetunion, aber auch in anderen sozialistischen Ländern, darunter insbesondere in der DDR, angenommen hatte, konnte diese Klärung nicht erfolgen. Sie hatte ja den Charakter eines Status quo erreicht, eines bloßen Für und Wider der Argumente. Wir treffen uns in dieser Haltung – nicht zu unserer Überraschung – mit jenem Teil der sowjetischen und deutschen Wissenschaftler, die eine stärkere Berücksichtigung oder überhaupt eine Berücksichtigung der Warenökonomie im Sozialismus gefordert haben bzw. noch immer fordern. Auch sie sind mit dem sowjetischen Stand der Debatte unzufrieden. Wir treffen uns im Punkt „unzufrieden“, wenn auch aus gegenteiligem Grund. Wo dort der Trend zurück zur Warenökonomie geht, geht bei uns der Trend in die andere Richtung: Stärker, entschiedener von ihr weg. Unsere Einschätzung der planwirtschaftlichen Praxis ist so angelegt, dass dort, wo die – ich sage mal restaurative (im Sinne der Warenproduktion restaurative) – Kritik von einer Verletzung der Warenökonomie spricht, wir – in unseren Artikeln – bereits von einer Form ihrer Überwindung sprechen; das sind zwei Sichtweisen auf die Realität des Sozialismus.
Was ist überhaupt Warenökonomie?
Nun, nichts als die bürgerliche, die kapitalistische Produktionsweise. Sie ist Warenökonomie in ihrer höchsten Vollendung. Und wenn von einer politischen Bewegung wie der der Arbeiter innerhalb dieser Ordnung ein Anspruch auf die politische Führung im Staat erhoben wird, dann macht das nur Sinn, wenn er einem Anspruch auf eine grundlegende Veränderung in den ökonomischen Verhältnissen, also in der Produktionsweise gleichkommt. Nur den Kapitalisten aufzuheben, das Kapital nicht, verwandelte den Marxismus aus einer Wissenschaft in eine Ideologie. So oder so ist Kommunismus Aufhebung der bürgerlichen Produktionsweise, was nur anderer Begriff für Aufhebung der Waren- und Wertökonomie ist. Rein praktisch erfolgte in der Sowjetunion der Aufbau der Planwirtschaft, d.h. der Aufbau einer am Gebrauchswert orientierten Ökonomie – was der Aufbau des Gegensatzes zur bürgerlichen Produktionsweise ist. Die Forderung, die Marx einst aufgestellt hatte, ist erfüllt worden. Was als Problem oder Widerspruch zu empfinden ist, ist die Verarbeitung dieser Praxis in der Theorie. Die sowjetische Wissenschaft empfand schon die Planwirtschaft als den Gegensatz zur bürgerlichen Produktionsweise – ausgenommen den Punkt Erhalt des Geldes. Wo Geld ist, meinte sie, da ist auch Ware, da besteht auch die Notwendigkeit des Erhalts des Wertprinzips in der Ökonomie, da wirkt auch – für die Preise, also die ideelle Form für den Wechsel der Ware in die Geldgestalt – das Wertgesetz. Sie sprach daher auch nur von einer Planwirtschaft mit Warenproduktion, und sie kennzeichnete den Sozialismus als die erste Phase des Kommunismus. Heraus kam also „1. Phase des Kommunismus mit Warenproduktion“. Sie nahm den Widerspruch, der damit zum klassischen Ausgangspunkt der Wissenschaft vom Kommunismus entstanden war, gelassen hin; sie berief sich einfach auf den höheren Erfahrungswert der Praxis oder „wirklichen Historie“. Sie empfand sich „höherentwickelt“ (als Marx, Engels usw.). Der eigentliche Gegensatz in seiner ökonomischen Form wurde in die höhere Phase des Kommunismus verwiesen, was einen bedeutungsvollen „Unterschied“ zwischen erster und zweiter Phase – oder Sozialismus und Kommunismus – erzeugte, der zu vielen theoretischen Spekulationen veranlasste.
Was war falsch?
Die sowjetische Wissenschaft berief sich eben nicht (nicht mehrheitlich, nicht einheitlich, einzelne Wissenschaftler schon, aber nicht die Wissenschaft) auf die wirkliche Praxis der Preise und auf das wirkliche Verhalten der Betriebe zu den Geldfonds, die ihnen im Rahmen der Planauflagen zugewiesen wurden, um als Käufer der Produkte anderer Betriebe auftreten zu können. Die Preise waren dem Prinzip nach Festpreise und die Wahrnahme der betrieblichen Geldfonds war an die Planauflagen gebunden. Sie waren also keine freien Geldmittel, wie in einer wirklichen Warenökonomie üblich. Es kommt bei der Bewertung der Ökonomie in einer sozialistischen Planwirtschaft nicht darauf an, was hier und dort noch als Kategorie existiert, um daraus nun abstrakt theoretisch zu folgern, „Aha, das kennen wir doch, das führt doch auf die uns bekannte und theoretisch erschlossene Warenökonomie zurück!“, sondern darauf, wie „Kategorien“ wirklich bewegen. Und ein Festpreis „bewegt“ eben anders als ein Wertpreis, und ein kaufendes Geld mit Planbindung anders als ein Geld, zu dem ich mich als Eigentum verhalten kann. Ich habe den Leiter des Betriebes, in dem ich arbeitete, einmal gefragt, wie er es mit dem betrieblichen Geldfonds halte, und er antwortete mir: „Bis zum Ende des Jahres auf Null fahren“. (Null hieß, alle Auflagen des Planes per Jahr erfüllt zu haben.) Eine sowjetische Theorie hätte um all jene Elemente bereinigt werden müssen, in denen nicht der wirklichen Bewegung der Ökonomie der Planwirtschaft entsprochen worden war, d.h. bereinigt werden müssen um all das „klassische Getue“.
Damit wurde der Sozialismus angreifbar.
Dass die Theorie davon nicht befreit war, konnte nur dazu führen, dass immer wieder Ökonomen auferstanden, die nun ausgehend von den „klassischen“ Definitionen (der Ware, des Wertes, der Preise und des Geldes) Korrekturen bis hin zu Reformen im Sinne der Klassik einforderten. Ein theoretischer Dualismus beförderte den praktischen Dualismus. Der sowjetischen Wissenschaft gelang einfach nicht die eindeutige Orientierung auf das entstandene kommunistische Element in ihrer Gesellschaft, im Gegenteil: mit diesem haderte sie ständig. Wir erkennen dies z.B. daran, dass man von der Planung erwartete, sie könne sich auf die perspektivische Form von Planung zurückziehen, was nichts anderes bedeutete, als die direkte Produktionsplanung aufzugeben. Damit hätte man die Betriebe in den Zwang gebracht, jenes Element wiederzubeleben, über das Betriebe/Unternehmen Produktion regulieren, also den durch lebendige Arbeit geleisteten Wert in seiner gegenständlichen Form, und verstanden als ein Recht auf Aneignung. Auch ein ökonomischer Laie kann unschwer begreifen, dass ein Recht auf die eigene Arbeitsleistung und ein Recht auf die Arbeit, soweit sie gesellschaftlich für mich (den Betrieb) geleistet wird, ein beträchtlicher quantitativer Unterschied sein kann. Aber dieser Unterschied im Quantitativen macht den Unterschied im Qualitativen, den Unterschied von Wert- oder Eigentums-, und Gebrauchswert- und Gemeinschafts-Ökonomie (Ökonomie vereinigter Produzenten) aus.
Was hältst du jenen entgegen, die behaupten, das Problem des real existierenden Sozialismus sei gewesen, dass man Wertbeziehungen als rein formale Angelegenheit behandelt habe? Weil Preise keine „ökonomische Funktion“ ausgeübt hätten, sei es zu Störungen der Produktionsproportionen, zu einer Hemmung der technischen Entwicklung und so weiter gekommen.
Ich sagte ja schon, dass Festpreise das Verhältnis zum Wert, also das Verhältnis, in dem lebendige Arbeit zur gegenständlichen Arbeit quantitativ bewegt, lahmlegen, außer Kraft setzen. Insofern ist es auch nicht richtig, von wenigstens „formellen Wertbeziehungen“ im Sozialismus zu reden – immer, ich betone das noch einmal, ausgehend von der wirklichen Praxis einer Planwirtschaft. (Nicht von einer theoretischen Prämisse in Lehrmeinungen vom Sozialismus). Festpreise können keine Beziehungen zum Wert mehr aufnehmen (sie entfernen sich auch nicht vom Wert, entsprechen diesen „immer weniger“, wie es bei sowjetischen Ökonomen auch hieß; man muß konsequent sein: Sie sind es einfach nicht mehr.) Falsch wäre auch zu sagen, Preise hätten „keine ökonomischen Funktionen“ mehr ausgeübt. Umgekehrt: Dass sie die Wertfunktion nicht mehr ausgeübt haben, muss (!) bedeuten, dass sie in einer anderen ökonomischen Funktion erscheinen. Jeder, der die Werttheorie von Marx gepaukt hat, weiß, dass es den Doppelcharakter der Arbeit gibt, von einerseits Arbeit in abstrakter Hinsicht – und die wird quantitativ bestimmt in ihrer zeitlichen Dauer (Marx) – und von andererseits Arbeit in konkreter Hinsicht – und die bestimmt sich quantitativ in Produktionsmengen. Steigt die Arbeitsproduktivität, so sinkt die Zeit (der Wert) und steigt die Menge (die Summe der Produkte). Wenn also der Preis (im Einzelnen) nicht mehr auf den Wert reagiert, weil er durch das weise Gesetz der Planbarkeit der Produktion in einen Festpreis verwandelt worden ist, so muss dennoch die Summe der Preise steigen wie die Summe der Menge an Produkten gestiegen ist. Das Wachstum in der Ökonomie, gemessen an der Summe der Preise, bekommt in der geplanten Wirtschaft einen anderen Bezug, es drückt die Produktivkraft in konkreter Hinsicht aus, nicht mehr die Arbeitszeit in abstrakter. Das war zu begreifen.
Hat der Verlust des Wertbezugs (gemeint ist nur der in Preisen) zu „Störungen der Produktionsproportionen“ geführt, zur „Hemmung der technischen Entwicklung“?
Wenn die gesellschaftlichen Planungsbehörden dumm genug gewesen wären, sich keinen anderen Einblick in die Ökonomie der Betriebe zu verschaffen – vielleicht, aber bevor man ernsthaft auf dieses Argument einginge, sollte man wohl den Nachweis führen, dass es so gewesen ist. An sich bestimmt der Wert Proportionen des Eigentums, wieviel gehört wem an Arbeit in lebendiger und gegenständlicher Hinsicht, und darauf erhebt der Eigentümer im Wechsel seiner Ware in die Geldform Anspruch, das ist eine Proportionalität, und die geht natürlich in einer Planwirtschaft, die ihre Proportionalität auf Basis der konkreten Arbeit und deren Entwicklung bestimmt, verloren. (D.h. sie existiert noch in der naturalen Form, aber nicht mehr in der Geldform, und besteht, das ist das Wichtigste, nicht mehr als Anspruch; wofür denn auch?) Die wertökonomische Proportionalität nimmt nicht nur Schaden, sie verschwindet in Gänze. Ob nun die gebrauchswertökonomische Proportionalität Schaden nimmt dadurch, dass die wertökonomische verlorengeht – bitte, nachweisen.
Woran scheiterte der real existierende Sozialismus?
Der reale Sozialismus ist nicht gescheitert, sein „Scheitern“ wurde organisiert. (Wann scheitern schon Gesellschaftsformationen? Welche Katastrophen hat der Kapitalismus hinter sich – aber ist er je gescheitert? Auch der Sieg der Oktoberrevolution beruht nicht gleich auf einem Scheitern des Kapitalismus in Rußland.) Ich will nicht gleich von Konterrevolution sprechen. Mir wäre der Gedanke, dass im Rahmen der Arbeiterklasse eine Konterrevolution, also eine bewusste Rückkehr zur bürgerlichen Gesellschaft möglich wäre, historisch … na, ich sage mal: „überwollt“. Konter-, also Gegenrevolution, ist bei Herrschaftsklassen möglich, feudaler zu bürgerlicher Klasse – sie beruhen auf einem jeweils anderen Produktionsprinzip (und da ist nicht automatisch das eine schwach, weil das andere schon stark) –, aber nicht bei Klassen, die an sich einen ökonomischen Gegensatz in Bezug auf denselben Gegenstand, die Arbeit, darstellen. Die Politik der letzten sowjetischen Parteiführung hat einen anderen Grund als den, dem Scheitern des Sozialismus durch Rückkehr in eine bürgerliche Gesellschaftsform zu entgehen. Diesen kann man aus den Reden von M.S. Gorbatschow ab seiner Regierungszeit sehr gut entnehmen – man verstand ihn nur nicht in dieser Dimension eines Rückbaus der sowjetischen Gesellschaft in eine quasi wieder bürgerliche Gesellschaft, in eine mehr staatskapitalistisch bürgerliche als schon unmittelbar in eine umfassende Klasse kapitalistischer Eigentümer der Produktion zurückführende Dimension. Man sollte auch hier auf dem Boden der Realität bleiben. Nur was Rußland ist, ist „Rußlands Konterrevolution“. Was der Sozialismus wirklich erlebte, war eine Schwächephase. Die Sowjetunion/der Sozialismus wäre unvermeidlich untergegangen (nicht gleichbedeutend mit Scheitern, das hätte auf einen inneren Widerspruch des Sozialismus hingedeutet, und den gab/gibt es nicht) – aber erst in einer längeren Perspektive. Rußland entging dieser, indem es sich aus der gesellschaftlichen Form des Gegensatzes Kommunismus-Kapitalismus zurückzog, es nahm die bürgerliche Form an, und zwar in einer politischen Vision, die bis heute den bürgerlichen Klassen suspekt ist: der Vision allgemeiner Menschheitsinteressen, der Vision der Verhinderung der Vernichtung der Menschheit durch einen mit Atomwaffen geführten Krieg. Dem Konflikt zu entgehen, indem man ihm den gesellschaftlichen Bezug nimmt, scheint übergesellschaftlich, und nur einseitig übergesellschaftlich, zu Lasten nur des Sozialismus gehend. Die Sowjetunion bzw. die letzte politische Führung dieses Landes hat einen Kompromiss ganz neuer Art in der Geschichte geschlossen – indem sie die gesellschaftliche Verfasstheit der Sowjetunion aufgegeben, aber damit den staatlichen Bestand Rußlands erhalten (gerettet?) hat. Sollen wir richten? Auch bestimmte bürgerliche Kreise haben erkannt, welche Form von Vernichtung der Menschheit insgesamt, über alle Gesellschaftsformen hinweg droht, würde der so genannte Ost-West-Konflikt auf seine letzte, höchste Konsequenz getrieben worden sein. Nur: zur kapitalistischen Wende hat es noch nicht gereicht. Ich schlage den anderen Weg vor. Wir, d.h. die Arbeiterbewegung in ihrer politischen Form, halten an der Theorie vom Sozialismus bzw. Kommunismus fest, drücken uns nicht um die realistische Einschätzung seiner ökonomischen Leistungen (oder Nichtleistungen), und halten der These vom Scheitern des Sozialismus – als der Ursache des „Debakels“ in der Sowjetunion und darüber hinaus – auch (!) entgegen, dass sie der Wende in der Sowjetunion ein schönes Feigenblatt abgegeben hat und wohl noch immer abgibt. Die These vom Scheitern des realen Sozialismus erklärt nichts, was bis zur Erklärung des Rußlands von heute hinführt, aber sie wird gebraucht von der ganz anderen Theorie eines „grundsätzlich anderen Sozialismus als des sowjetischen Modells“, d.h. sie wird gebraucht von einer Theorie, die inmitten des Sozialismus entstanden ist als die Theorie von der „Notwendigkeit der Warenproduktion im Sozialismus“. Diese Theorie beweist sich mit einem „Scheitern des Sozialismus“, denn das hebt sie in den Rang einer Notwendigkeit unabhängig davon, wieweit sie schon Theorie – oder doch nur These ist. Womit wir wieder bei unserem Thema wären – dem Dualismus in der sowjetischen sozialistischen Ökonomie. Sie konnte nicht eindeutig Planwirtschaft sein, sondern „fummelte“ theoretisch an dieser herum. Es ist viel richtiger, in dieser Frage einen wirklichen Revisionismus (der ökonomischen Form) nachzuweisen und zurückzuweisen, als uns Gedanken über Gorbatschow und den russischen Staat von heute zu machen. Er ist entstanden, aber nicht aus Gründen eines in Rußland gescheiterten Sozialismus.
Einige marxistische Ökonomen schätzen heute ein, dass das Hauptproblem in einem Zurückbleiben des Angebots hinter der zahlungsfähigen Nachfrage bestand. Wie hätte dieses Problem gelöst werden können?
Sofern das eine Frage an die Theorie ist, ist sie so zu beantworten, dass in einer Planwirtschaft mit steigender Arbeitsproduktivität, also wachsendem Produktionsvolumen an Gütern, die Löhne steigen müssen – vorausgesetzt, es handelt sich um Wachstum in der Produktion von Konsumtionsmitteln. Theoretisch müßte es hier um Äquivalenz gehen, also Summe der Preise in II gleich Summe der individuellen Einkommen. Es gibt keinen Grund aus dem Produktionsverhältnis her, dass die Löhne, also die zahlungskräftige Nachfrage, schneller zu steigen habe als die Menge der Konsumtions-Produkte. Wenn doch, dann handelt es sich um ein Übermaß in der Einkommenspolitik, um ein Vorangehen der Löhne vor dem ökonomischen Wachstum – und das ist ein Politikum, kein Gesetz der Ökonomie. Theoretisch wäre das die Frage, ob das Vorangehen der Löhne vor der Produktion ein Muß der Produktion sein muß. Braucht sie immer ein Plus an Geld, um immer realisieren zu können? Im Prinzip würde ich das verneinen, es kommt vielmehr auf angenäherte Parallelität im Vorangehen der beiden Summen an.
Anders sieht die Frage aus, wenn die Produktion plötzlich zurückginge, dann stellte sich das Überangebot an Geld her aus einem unplanmäßigen Unterangebot an Waren. Das wäre aber eine Frage der Wirtschaftspolitik. Von der Seite der Theorie her ergibt sich nur die Frage, wie stellt man sich im Sozialismus in der Lohnsumme auf einen Rückgang der Produktion ein? Soll man die Preise steigern, also in die Inflation ausweichen (wie das der Kapitalismus macht), oder soll man die Löhne senken? Richtig wäre Lohnsenkung, aber dazu müßte in der Voraussetzung ein Teil des Lohnes bezogen auf das Wachstum gezahlt worden sein, und von diesem Teil müßte dann klar sein, dass er mit der Produktionsmenge schwanken kann, und nur ein anderer Teil bezogen auf ein so genanntes Grundeinkommen, und das dann fest, d.h. nichtschwankend ausgezahlt würde. Aber so weit, den Lohn in zwei Formen zu teilen, war der reale Sozialismus nicht gediehen. Was dem Sozialismus in Wahrheit fehlte, war ein das Volkseigentum umsetzendes Lohnsystem. D.h. das sozialistische Lohnsystem hatte sich noch nicht aus dem betrieblichen Lohnsystem, wie es nur der Kapitalismus oder private Eigentümer von Arbeit entwickeln kann, gelöst und in einen gesamtgesellschaftlichen Bezug umgewandelt (und solange die wertbezogene Betriebsform des Sozialismus zur Debatte stand, konnte das auch nicht geschehen.) Als es in den 80er Jahren mit dem normalen Gang des Sozialismus vorbei war und in der Produktion auch Rückschläge zu verkraften waren, traf es den Sozialismus unvorbereitet, d.h. es entstand ein wirklicher Geld- resp. Einkommensüberhang (er betrug in der DDR wohl ca. 160 Mrd. Mark der DDR; die auf diese Sparsumme zu zahlenden Zinsen „fraßen“, wie ich mal hörte, das ganze damalige Wachstum II der DDR auf).
Gab es aber an sich eine Mangelwirtschaft in der DDR, den sozialistischen Staaten, die durch einen permanenten Kaufkraftüberhang oder seitens der Produktion durch eine stete Unterproduktion gekennzeichnet war, ist Disproportionalität zwischen Gut und Geld also ein Systemausdruck des Sozialismus? Diese Frage möchte ich verneinen. Es spielt zuviel Wirtschaftspolitik in diese Frage hinein, als dass man sie im Sinne eines unvermeidlichen Widerspruchs der Planwirtschaft beantworten kann. Die Erscheinung einer Disproportionalität von Angebot in Gütern und Nachfrage in Geld hatten wir nicht zu allen Zeiten in der gleichen Brisanz wie in der letzten Zeit. Aber ich sprach schon von einer Schwächung der ökonomischen Konsistenz der sozialistischen Länder ab etwa Mitte der 70er Jahre. Man muß immer sehen, in welchem Verhältnis schwach. Die 60er und 70er Jahre hatten ja auch eine große Ausdehnung des sowjetischen resp. sozialistischen Einflussbereichs gebracht. Sie führten zu einem nichtäquivalenten Handel der Sowjetunion, andererseits zu einer Schwächung der gemeinsamen Rohstoffbasis des schon entwickelten Internationalismus in den ökonomischen Beziehungen der sozialistischen Länder selbst. Die ökonomischen Probleme konnten auch nicht kompensiert werden durch einen Aufschwung des sozialistischen Denkens in den zuhöchst entwickelten kapitalistischen Ländern. Die sowjetische Politik begann, in engen, eigenen Grenzen über ihre Sicherheit nachzudenken. Wir sollten das nicht immer mit der linken Hand abtun, als müsse einer Sowjetunion alles möglich sein. Jedenfalls ist es richtig, dass ab den 80er Jahren das Warenangebot teils zurückging, aber darin einen Widerspruch im System zu sehen, der zu dessen Zusammenbruch führen muß, halte ich für abwegig. Wer für Scheitern votiert, dem ist eben alles Scheitern. Der Sozialismus muss sich nur davor hüten, mit dem Geld allzu großzügig umzugehen nach dem Motto: Wir haben es ja. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Sowjetunion ab der Mitte der 80er Jahre eine andere Politik aufnahm, und der mangelte es an Interesse, solche inneren Probleme einer Lösung zuzuführen.
Du hebst hervor, dass Warenproduktion und Privateigentum eine Einheit bilden und sprichst in diesem Zusammenhang von „gesellschaftlichen Zwischenstufen überflüssiger Art beim Aufbau des Kommunismus“. Könntest du etwas näher darauf eingehen?
Allgemeinhistorisch oder auch allgemeintheoretisch wäre es nur notwendig, nach einer kurzen Übergangsphase und ohne eine nennenswerte Zwischenpause einzulegen, mit dem Aufbau des Kommunismus zu beginnen, ökonomisch gesehen also mit der Planwirtschaft. Unter Konzession an eine andere Auffassung verstehe ich, sich von der bürgerlichen Produktionsweise nur soweit zu trennen, als man sich von der Person des Kapitalisten trennt, aber nicht von den Verhältnissen und Formen seiner Produktionsweise selbst. D.h. die bürgerliche Produktionsweise oder Warenproduktion würde fortgesetzt werden mit einer genossenschaftlichen hoheitlichen Form, und dies allgemein; der Begriff des Volkseigentums wäre dann auf diese ökonomische Form nicht mehr anwendbar. Bei einem Zurückweisen der These von der besonderen, historisch dritten Form der Warenproduktion im Sozialismus wäre es unvermeidlich gewesen, die Frage der Periodisierung beim Aufbau des Kommunismus anders zu stellen. Was nicht mehr Ware, ist was? Elemente des Kommunismus hätten schneller, früher bestimmt werden müssen, das Ableben der Elemente der bürgerlichen Produktionsform auch. Das ist nicht ein theoretischer Wunsch, sondern hätte nur der Aufnahme der planwirtschaftlichen Praxis in das Denken entsprochen. Und was China betrifft, so hat es in gewaltigen Mengen ausländisches Kapital ins Land geholt und hat damit einen Fortschritt importiert, den es sonst selbst hätte entwickeln müssen – sicher sehr viel später. Was ein Zuviel an Schritten ist, ist sicher nur an einer erfolgreichen Planwirtschaft zu messen.
Du sagst, dass man das Geld von der Ware trennen müsse können. Wie soll das bewerkstelligt werden?
Der Form nach ist Frage mit dem System fester, konstant bleibender Preise im Sozialismus beantwortet; Preise, die fest bleiben – angesichts der Veränderungen in der Produktivkraft der Arbeit – vermitteln nichts mehr über den Wert, wenn Vermittlung nicht an sich verstanden ist als Vermittlung der Bewegung der Werte. Die Werttheorie von Marx wäre undenkbar ohne den Satz: Die Wertgröße der Ware wechselt umgekehrt wie die Produktivkraft der Arbeit; mit steigender Produktivkraft sinkt sie, mit sinkender steigt sie. Aber in der sowjetischen Ökonomielehre ist es gelungen, von einem Satz „Der Preis der Ware bleibt fest, egal wie die Produktivkraft der Arbeit wechselt“ dasselbe zu denken wie von Marx, als wäre es Marx. Nun, es ist Sozialismus, und diese Praxis verlangt eine sozialistische Erklärung, aber mit Werttheorie hat das nichts mehr zu tun.
Die „Trennung des Geldes von der Ware“, von der ich bezogen auf das Geld im Sozialismus spreche, ist quasi in der Doppelpoligkeit der Wertform schon vorgegeben. Ware, die in Geld wechselt, ist Geld, das in Ware wechselt. In der ersten wechselnden Form realisiert die Ware ihren Wert im Geld, Geld ist Wertgestalt der Ware, und in der zweiten wechselnden Form, derselbe Wechsel also betrachtet unter dem Gesichtspunkt der anderen Seite, der des Geldes, wechselt Geld nur seine Gebrauchwertgestalt. Dass, wer die Ware anwendet, nur seinen Wert erwirbt, und dass, wer Geld anwendet, nur einen Gebrauchswert erwirbt – und nicht etwa auch seinen Wert –, ist in der Doppelseitigkeit der Wertform vorgegeben. Dass hinter diesen beiden jeweiligen Formen der Realisierung aber nichts weiter als die Realisierung des Doppelcharakters der Arbeit lauert, man in der einen Beziehung das Interesse an der abstrakten Seite der Arbeit realisiert, in der anderen aber das Interesse an der konkreten Seite der Arbeit, dass dies tatsächlich ökonomisch verschiedene Interessen sind, bringt uns eine neue Einsicht in das ökonomische Verhältnis resp. in den inneren Widerspruch der Warenproduktion. In einer realen Warenproduktion ist natürlich das Interesse auf die Realisierung des Wertes in der Wertform gerichtet, und was Interesse des Geldbesitzers ist, tritt zurück oder fällt aus der ökonomischen Betrachtung heraus. In einer Planwirtschaft, oder bereits in einem Verhältnis, wo grundsätzlich das ökonomische Verhältnis mit dem Geld eröffnet wird – und das ist beim Lohnarbeiter der Fall und eben im Sozialismus – tritt natürlich das andere Interesse, das Interesse auf den Gebrauchswert, hervor. In welchem Verhältnis braucht jemand, der am Gebrauchswert interessiert ist, Geld? Im selben Verhältnis, in dem er als Gebrauchswert, Bedürfnis auf diesen, bestimmt ist. Alles Weitere regelt sich dann von selbst.
Wir fragen immer danach, was Kommunismus ist. Was will denn eigentlich jener in der Gesellschaft ändern, der für den Kommunismus ist? Welche Antwort erwarten wir denn eigentlich – im Unterschied zu der Antwort, die der Kapitalismus gegeben hat? Dass wir auch (!) ein Verhältnis zum Geld in der realen Planwirtschaft hatten, das dem Kommunismus ohne Geld entspricht, heißt, dass wir uns bereits dem Inhalt nach in einer kommunistischen Produktionsweise befanden, also auch die Periodisierung des Kommunismus neu, anders, vorverlegt in den Sozialismus bestimmen mussten. Die Warenproduktion unterscheidet sich nach Wesen und Form, aber für die Form gilt, kann gelten, dass sie auch für ein neues Wesen spricht, sprechen kann.
Wie würdest du aus heutiger Sicht das NÖS bewerten?
Das „neue ökonomische System“ in der DDR wäre möglich gewesen, wenn damit eine Aufhebung des ökonomischen Rechts verbunden gewesen wäre, das sich in der führenden Partei, der SED, und in den staatlichen und gewerkschaftlichen Organen herausgebildet hatte. D.h. es wäre möglich gewesen, wenn es zur Neuschöpfung eines neuen ökonomischen Subjekts gekommen wäre – die eigenverantwortlich agierende Betriebsbelegschaft. Eine Warenökonomie, die sich immer nur mit den Preisen im Sozialismus herumschlägt, hat ja keine Perspektive. Um Warenökonomie zu machen, muss man ein warenökonomisches Subjekt im Sozialismus bestimmen. Und im NÖS war man der Meinung, man habe es gefunden in der Betriebsbelegschaft. Dieses Theorem ist aber nie durchgesetzt worden. Ich bin auch der Meinung, dass diese Konzeption nie richtig durchdacht worden ist. Es hätte ja auch einer Ausarbeitung der Betriebsdemokratie bedurft. Wie waren denn die Rechte der Betriebsleiter/Betriebsleitungen gesetzt und wie die der Belegschaften? Welche Rechte in Bezug auf den Preis hatten die Betriebe? Was war mit dem Teil des Geldes, den Betriebe nicht zum Zweck der eigenen Erweiterung ausgegeben hatten? Blieb er im Besitz/Eigentum des Betriebes? Sollte er in Banken gelagert werden und von dort ausgeliehen werden können an andere Betriebe? Zu welchen Konditionen? Sollten die Betriebe Zinsen auf Sparvermögen erhalten? Hätte Geld in Kapital verwandelt werden können? Usw. usf. Unklar am NÖS war auch das perspektivische Preissystem, seine allgemeine Bewegungsrichtung. Sollten Preise also mit den Werten sinken? Bei sinkenden Preisen, was sollte dann mit den Löhnen geschehen, sie werten doch in ihrer Kaufkraft auf – außer, sie würden auch gesenkt werden, d.h. Preissenkungen würden in Lohnsenkungen umgesetzt werden. Vielleicht langsamer als die Preise gefallen, so dass sie historisch aufwerten (Marxsches Theorem!), aber immerhin sinken. Im NÖS sollten Löhne am Gewinn beteiligt werden oder in Abhängigkeit von der Erzielung von Gewinn gezahlt werden – an die Belegschaften, die Subjekte der neuen Warenökonomie. Wie passt das überhaupt zusammen: Wertpreise, aber steigende Löhne entsprechend Betriebs-Gewinn? Wertgesetz im allgemeinen Rahmen, nach außen, aber nicht nach innen? Ist es ökonomisch möglich, den Lohn wie den Gewinn/Profit zu behandeln, also steigend mit steigender Produktivkraft? Das sind derart viele offene Fragen, dass man vom NÖS nicht (!) als einem ausgereiften ökonomischen System sprechen kann, das dem „sowjetischen Modell“ der zentralen Planwirtschaft hätte erfolgreich entgegen gestellt werden können. Man sollte lieber nicht so tun, als habe man schon ein System gehabt. Man kann ja meine Ausführungen auch als Aufforderung betrachten, Versäumtes nachzuholen.
Im Unterschied zu anderen Fragen, die der reale Sozialismus aufgeworfen hat (wie z.B. die Frage Trotzki, Bucharin, Moskauer Prozesse, Arbeitslager, und auch sagen wir Chruschtschows Außenpolitik), die alle ihren historischen Bezug hinter sich haben und eben Historiker beschäftigen, ist uns das Thema Warenökonomische Reform, Genossenschafts-Sozialismus – insbesondere in der Form NÖS (weniger in der Form Jugoslawische Selbstverwaltung, erstaunlich!) – als aktuell, als gegenwärtig geblieben. Man stellt dem realen Sozialismus ein anderes Modell des Sozialismus entgegen, wenigstens wird das kundgetan. Deutsche Ökonomen aus der DDR, im Umfeld der Partei Die Linke, engagieren sich hier besonders. Dieser Auseinandersetzung wegen muß man sich der Debatte über die Warenproduktion im Sozialismus noch immer stellen – mit nunmehr aller Konsequenz.
Interview: Gerfried Tschinkel;
das Interview erschien erstmals am 22.09.2008 auf www.kominform.at
Gerfried Tschinkel
Politische Ökonomie der Erscheinungsform?
Was hat der reale Sozialismus getan? Er hat das Geld auf eine reine Kauffunktion reduziert, und indem er das tat, hat er die Wertform der Ware und die Tausch-wertform des Geldes aufgehoben! (Hermann Jacobs)
Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass ein solcher Versuch nur zu staatlichen Reglementierungen der Betriebe und ihrer Fachleute und zu übermäßiger Bürokratie führt, und dass damit die volkswirtschaftliche Arbeitsproduktivität im Vergleich zu den privatkapitalistischen Systemen nicht steigt, sondern sinkt. (Wolfgang Hoss)
Ich möchte an dieser Stelle Hermann Jacobs in einigen Punkten seiner Anschauungen recht geben, anderes gilt es jedoch energisch zurückzuweisen. In diesem Text beziehe ich mich auf ein Interview[7], das ich vor einiger Zeit mit ihm geführt habe und das, so glaube ich, den Kern seiner Theorie recht gut wiedergibt.
Zunächst will ich aber eine Überlegung über die Marxsche Sicht einer sozialis-tischen/kommunistischen Gesellschaft anstellen, um dann auf Probleme des „real existierenden Sozialismus“, im Speziellen der DDR, einzugehen.
Meines Erachtens fallen bei Marx zwei Dinge, obgleich er diese sehr scharf voneinander trennt, in der sozialistischen/kommunistischen Ökonomie zusammen. Damit meine ich die „wertökonomische“ (die ja dann wegfällt) und, wie Hermann Jacobs das auch nennt, die „gebrauchswertökonomische“ Proportionalität.
Marx schreibt im Warenfetisch-Abschnitt: „Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. Alle Bestimmungen von Robinsons Arbeit wiederholen sich hier, nur gesellschaftlich statt individuell. Alle Produkte Robinsons waren sein ausschließlich persönliches Produkt und daher unmittelbar Gebrauchsgegenstände für ihn. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt.“ [8]
Die Gebrauchsgegenstände, welche die Gesellschaft produziert, sind also unmittelbar Gebrauchsgegenstände für die Gesellschaft. Was heißt das?
Der Wechsel der Gebrauchswerte auf zwei verschiedene Weisen begründet erst die Wertform. Die Gebrauchsgegenstände müssen zum einen nützlich für andere sein, die Vermittlung der Gebrauchswerte bezieht sich hier rein auf die eigentümlichen Besonderheiten der Erzeugnisse (der eine hat’s, der andere braucht’s). Außerdem aber kommt mit der Entwicklung des Tausches die Allseitigkeit der Veräußerung der Gebrauchswerte hinzu (jeder Gebrauchswert gegen jeden), sodass sich diese in bestimmten Relationen ersetzen. Dieser Widerspruch (die Waren sollen zugleich ungleich und gleich sein) wird schließlich „gelöst“ durch die Verdoppelung der Ware in Ware und Geld. Das Geld ist als besonderes Ding zugleich Gebrauchswert für alle, somit treten jetzt die Waren dem Geld als dem Repräsentanten der ganzen Warenwelt gegenüber und fragen nach ihrem Wert (resp. Preis), der ihnen ja nicht eingeschrieben ist, sondern erst über das allseitige In-Beziehungsetzen der Waren auf dem Markt in Erscheinung tritt.
Der Kommunismus endlich „ersetzt“ das Geld durch die unmittelbare Gesellschaftlichkeit der Gebrauchswerte. Und hier fängt der ganze Spaß an. Denn für Marx ist die Sache relativ „einfach“: Da die Gesellschaft für sich selbst produziert, müssen die Gebrauchswerte nicht erst Gebrauchswerte für die Gesellschaft werden. Dies impliziert: Privatarbeit muss nicht erst gesellschaftliche Arbeit werden. Denn die Arbeit, die angewandt wurde, war von vornherein gesellschaftlich. Außerdem: Die Gebrauchswerte müssen sich nicht erst als nützlich für andere erweisen. Die Gesellschaft hat sie ja in Kalkulation ihrer Bedürfnisse produziert.
Hieraus ergibt sich die Überflüssigkeit der Wertform.
Insofern ist die gebrauchswertmäßige Proportionalität bei Marx kein großes Thema. Die gesellschaftlich planmäßige Verteilung der Arbeitszeit (damit ist natürlich die individuelle gemeint, die zusammenfällt mit der gesellschaftlichen), regelt die richtige Proportion der Arbeitsfunktionen zu den Bedürfnissen. Dies setzt voraus, dass die Bedürfnisse bekannt und die Produktion der Gebrauchswerte dementsprechend geplant ist. Nun ergibt sich folgendes Problem: Der real existierende Sozialismus, so sehr er auch das Privateigentum aufgehoben hat, hat die richtige Verteilung der Arbeitsfunktionen entsprechend den Bedürfnissen offensichtlich nicht auf die Reihe gekriegt. Es sei dahingestellt, ob das damit zu tun hat, dass hier eine „Fehlallokation“ der Arbeit vorlag, oder aber, ob es sich um nicht richtig einzuplanende Bedürfnisse handelte, oder aber um beides.
In jedem Fall hat das Auswirkungen für das Vorhandensein eines Preises: Die Gebrauchswerte müssen jetzt Gebrauchswerte für andere werden (was an und für sich selbstverständlich und auch kein Problem ist, wenn Plan und Bedarf zusammenfallen, wie im Kommunismus). Das heißt, die Gebrauchswerte wechseln den Besitzer aufgrund ihrer eigentümlichen Besonderheiten und zwar nicht nur aufgrund der Nützlichkeit des Guts für den Nicht-Produzenten (Arbeitsteilung) sondern aufgrund der Nützlichkeit, die es für den (eigenen) gesellschaftlichen Produzenten (Plan/Bedarf) hat. Obgleich daher die Gebrauchsgegenstände von vornherein gesellschaftlich produziert werden – die Verteilung der Arbeit also gesellschaftlich ist –, entspricht die betriebsindividuell aufgewandte Arbeitszeit nicht von vornherein der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit[9]. Der Sozialismus hatte (oder hätte) für dieses Problem die Preisform parat (gehabt), die (auch) aus anderen Gründen überliefert wurde (Austausch Stadt/Land, verschiedene Eigentumsformen).
Jedenfalls bestand die Preisform im real existierenden Sozialismus weiter. Heißt das nun aber, dass auch das Wertgesetz weiterhin gewirkt hat?
Hermann Jacobs sagt: Indem die Preisform die Gestalt des Festpreises angenommen hatte, ist das Wertgesetz bereits aus den Angeln gehoben. Da in der Form des Festpreises das Geld keine Auskunft mehr über den Wertwechsel der Waren erteilt, sei auch die Wertform (verstanden als die historische Form, welche das Arbeits-produkt bei Zeiten annimmt) verloren gegangen.
Das Wertgesetz habe sich also eigentlich schon erledigt: „Festpreise können keine Beziehungen zum Wert mehr aufnehmen“ (Jacobs). Die Ökonomenriege der DDR und anderswo, so lässt sich daraus schließen, wäre bloß zu feige gewesen, das einzugestehen und versuchte daher die Theorie gegen die Praxis zu konservieren.
Nun gehe ich davon aus, dass der Festpreis tatsächlich nicht mehr den Wertwechsel reflektiert, aber ist deshalb auch die, wie Jacobs es selber nennt, „gebrauchs-wertökonomische Proportionalität“ hergestellt? Ich meine, nicht notwendigerweise. Denn die Gebrauchswerte müssen nach wie vor erst Gebrauchswerte für andere werden, darüber hinaus aber einen Bedarf decken, der nicht unbedingt mit dem Plan zusammenfällt. (Wenn ich Milch will aber nur Bücher bekomme, mag das von erzieherischem (Gebrauchs-)Wert sein, schrammt aber möglicherweise an der gebrauchswertökonomischen Proportionalität vorbei, wenn es an Milch mangelt, weil zuviel Arbeit auf das Schriftstellergewerbe anstatt auf die Milchindustrie verteilt wurde). Das heißt, es bleibt ein Konflikt bestehen, zwischen betriebsindividuell aufgewendeter und gesellschaftlich notwendiger Arbeit, der sich dummerweise (vorerst) nur über die Preisform lösen lässt.
Der Preis im Sozialismus reflektiert also noch etwas anderes (oder kann noch etwas anderes reflektieren) als „eine Beziehung zum Wert“ (die er ja gerade nicht reflektieren soll), nämlich die Vermittlung von betriebsindividuellem und gesellschaftlich notwendigem Arbeitsaufwand, die eine rein quantitative sein kann und nicht zusammenfällt mit der qualitativen Seite des Problems[10], dass sich die verschiedenen Arbeiten erst als äquivalent erweisen müssen. Bei einer angenom-menen Vereinheitlichung des sozialistischen Eigentums, aber dem Nichtzusam-menfallen von Plan und Bedarf, wäre jede individuelle Arbeit zugleich gesell-schaftliche Arbeit. Zwar stellt sich auch dann erst nachträglich wirklich heraus, ob die produzierten Gebrauchswerte tatsächlich dem gesellschaftlichen Bedarf entsprechen, aber ihre Gleichheit ist eine gesellschaftliche Voraussetzung, die sich nicht erst im Geld beweisen muss.
Man kann sagen, dass in der DDR bis Anfang der 1960er Jahre die Grundlagen einer sozialistischen Planwirtschaft geschaffen wurden. Ich möchte keine Spekulationen darüber anstellen, wie weit die Eigentumsverhältnisse in der DDR bereits entwickelt waren, um die Warenproduktion entschieden oder entschiedener in die Schranken zu weisen. Allerdings sei darauf verwiesen, dass selbst unter der Annahme verschiedener sozialistischer Eigentumsformen bei dieser Form von Warenproduktion das Wert-gesetz nicht die Verteilung der Arbeit auf die einzelnen Produktionszweige reguliert, wie das im Kapitalismus der Fall ist. Es sei denn, dem Wertgesetz wird aufgrund tatsächlicher Probleme der sozialistischen Ökonomie ein Spielraum gegeben, der ihm eigentlich nicht zusteht.
Als erschwerend für die Theoriebildung sollte sich jedenfalls die unter sowjetischen Ökonomen verbreitete Annahme erweisen, dass selbst mit Aufhebung der verschiedenen Eigentumsformen, die Warenproduktion fortbestehen müsse. Ihre Notwendigkeit wurde jetzt (unter Zurückweisung Stalins) aus den sozialistischen Produktionsverhältnissen selbst abgeleitet.[11]
Vor diesem Hintergrund war das Problem der Preisbestimmung in der DDR diskutiert worden. Aber in den 1960er Jahren, als wohl der entscheidende Schritt zu tun gewesen wäre, fehlte es an notwendigen Einsichten. So spielte sich der Streit, was denn der Preis widerspiegle, zwischen zwei scheinbar unversöhnlichen Richtungen ab. Bei der Frage, welche Komponenten bei der Preisbildung zu berücksichtigen seien und auf welchem Wege die Messung zu erfolgen hätte, plädierte die eine Richtung (Rudolph, Wittich, Lendle) für eine direkte, in Zeiteinheiten vorgenommene Bestimmung des Arbeitsaufwandes (und damit des Preises), die andere Richtung (Behrens, Maier, Bichtler, Nick, Schilar), wies diesen Ansatz zurück und hob hervor, dass der Wert nicht unmittelbar in Erscheinung tritt. Während also die einen den Wert negierten und die Preise direkt durch die aufgewendete Arbeit bestimmt haben wollten, negierten die anderen, dass es sich hierbei um ein rein quantitatives Problem handle, sie redeten von der Erscheinungsform, wie von dem Wert. Aber der Wert war eine Realität, ebenso wie seine Überlebtheit![12]
Jacobs nimmt an, dass die Geldmenge entsprechend der Produktivkraftentwicklung wachsen muss. Entspricht dieses Geldmengenwachstum der gebrauchswert-ökono-mischen Proportionalität, bei Annahme eines Festpreises, ist die Sache geritzt und die Menschen kaufen mit dem Geld – das jetzt nichts mehr vermittelt als den Händewechsel der Güter – die Regale leer. Was aber, wenn die Geldmenge bei Festpreisen zwar entsprechend der gesellschaftlich verausgabten Arbeit wächst, aber auf betriebsindividueller Ebene aufgrund ungeplanter oder nichtzuplanender Entwicklungen das Betriebsergebnis nicht dem Plan entspricht oder aber, wenn am vorhandenen Bedarf vorbei produziert wurde, sodass (zum Beispiel) das tatsächliche Ergebnis unter dem erforderlichen liegt. Dann entspricht das Geldmengenwachstum nicht mehr den geplanten Größen und es kommt zu einem Geldüberhang.
Nun ist Jacobs dieses Problem nicht unbekannt, es stellt sich für ihn aber nicht als theoretisches Problem dar: „Anders sieht die Frage aus, wenn die Produktion plötzlich zurückginge, dann stellte sich das Überangebot an Geld her aus einem unplanmäßigen Unterangebot an Waren. Das wäre aber eine Frage der Wirtschaftspolitik.“ (Jacobs)
Das Wort „unplanmäßig“ kann aber Verschiedenes bedeuten. „Unplanmäßig“ kann bedeuten: nicht gemäß dem Plan, also eine Nichterfüllung des Plans (was Jacobs ja auch meint). Oder aber: Etwas liegt außerhalb des Plans, ist nicht in den Plan einbezogen. Das erwähnte Unterangebot müsste dann mit etwas anderem in Beziehung gesetzt werden, das nicht mit dem Plan zusammenfällt. Insofern handelt es sich also doch um eine Frage der Theorie!
Wenn aber im realen Sozialismus der Festpreis wirkte und gleichzeitig Plan und Bedarf nicht in Übereinstimmung gebracht werden konnten, das heißt, die gebrauchswertmäßige Proportionalität nicht erfüllt wurde, was wiederum heißt, dass die Preisform nicht die Differenz von individueller und gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit vermittelte (aufgrund der Festpreise nicht vermitteln konnte), so muss noch ein anderer Grund bestanden haben, die Preisform (also das Geld) beizubehalten. Wenn sie ihren einzigen Grund in der bequemeren Vermittlung des Händewechsels der Gebrauchswerte gehabt hätte, dann wären die Ökonomen der DDR und anderswo tatsächlich bloß zu uneinsichtig und zu feige gewesen das einzugestehen. Oder aber, es wirkte auf eine bestimmte Art das Wertgesetz. Und zwar unabhängig davon, was der Festpreis vermittelte, der sich auf die geplante, gesellschaftlich verausgabte Arbeit bezog[13]. Die planmäßige Preisbildung erfolgte in der DDR nach den „Erscheinungsformen der einzelnen Bestandteile des Wertes“[14], also vor allem nach den Selbstkosten und dem Reineinkommen.
Das Gesamtprodukt der Gesellschaft bemisst sich in der erforderlichen gesell-schaftlichen Gesamtarbeitszeit. Diese wird verausgabt um jenes Produkt zu erwirt-schaften. Aber die betriebsindividuell verausgabte Arbeit trägt nicht direkt zu diesem Gesamtprodukt bei, sodass für das Betriebsergebnis nicht die Arbeit, die auf es verwendet wurde, ausschlaggebend ist, sondern die gesellschaftlich notwendige Arbeit, welche das jeweilige Produkt vorstellt. Das heißt, besteht ein Anspruch auf das Produkt, anstatt bloß auf die angewandte Arbeit, macht das einen erheblichen Unterschied aus. Aber dieser Unterschied kann das Einsetzen einer spontanen Verteilung der Arbeit auf die einzelnen Zweige der Produktion nach sich ziehen.
Bemerkenswert ist, dass in der DDR-Ökonomie erstmals in den 1970er Jahren offiziell die Möglichkeit eingeräumt wurde, dass es auch in einer Planökonomie zur spontanen Durchsetzung ökonomischer Gesetze kommen könne, was bis zu diesem Zeitpunkt nur für den Kapitalismus galt.[15]
War etwa das NÖS in der DDR ein Weg in die Marktwirtschaft, fragt Claus Krömke[16].
Der Durchsetzung des Wertgesetzes als Regulator der Wirtschaft ist jedenfalls entgegengestanden, dass die NÖS-Preise bloß Aufwandspreise im Sinne der Fortschreibung der Kosten waren. Gab es also keinen „ökonomisch begründeten Preis“?
Was bestand, war ein gesellschaftlicher Bedarf an geschaffenen Gebrauchswerten, der nicht mit dem Plan zusammenfiel. Wenn sich hierauf ein Anspruch einzelner auf die Arbeitsergebnisse des Betriebes begründet, dann kann der Bedarf als Antrieb einer ungleichmäßigen Entwicklung wirken. Diesen Anspruch gab es im NÖS der DDR in der Form von einbehaltenen Gewinnen, die nicht wieder gesellschaftlich verteilt sondern betriebsindividuell verausgabt werden konnten.
„So planten jetzt die VVB die Verteilung ihrer Produkte – wobei sie jedoch nicht über die Informationen verfügten, um zu entscheiden, welche der bei ihnen eintreffenden Anforderungen volkswirtschaftlich wichtig oder weniger wichtig war. Zugleich verlangten die Betriebe wegen nach wie vor fehlender harter Budgetrestriktionen nach möglichst vielen Ressourcen aller Art. Beides zusammen hatte die Konsequenz, dass die im Plan 1965 festgelegte Ressourcenverteilung ineffizient war und fast alle VVB das gesamte Jahr über Schwierigkeiten hatten, ihren Bedarf an Materialien und Vorleistungen zu decken. Allerdings nutzten mehrere von ihnen die Situation dazu, mit ihrer „Monopolstellung“ für bestimmte Güter Preiszuschläge durchzusetzen, schon allein dafür, dass sie innerhalb der gesetzlichen Bestellfristen lieferten. Auch indem sie ihren Abnehmern Arbeitskräfte oder Prämien abverlangten, versuchten Hersteller von Defizitgütern, Vorteile zu erlangen. Das Beschaffen der Vorleistungen erforderte gerade von den Finalproduzenten weiterhin erheblichen Aufwand.“[17]
Das heißt, es setzte eine ungleichmäßige Entwicklung der Produktion ein, die nicht mehr ausreichend gesteuert, zu erheblichen ökonomischen Disproportionen führen musste.
Siegfried Wenzel bemerkt zum NÖS: „Wenn [...] die Dimensionen dieser an sich richtigen Politik in einem solch extremen Ausmaß überzogen werden, dass Dis-proportionen nicht nur zwischen Zuliefer- und Finalproduktion eintreten, sondern zunehmend auch Ausfall an dringend benötigten Endprodukten und Leistungen und ein Zerbröseln der materiellen Basis eintritt, dann kann man diese Politik nicht entschuldigen. Eine solche Wirtschaftspolitik war eine Fehlleistung. Vor allem aber beerdigte sie die Grundideen des NÖS.“[18]
Dieser ungleichmäßigen Entwicklung kann oder muss durch verstärkte Zen-tralisierung und der staatlichen Umverteilung von Mitteln entgegengesteuert werden. Dem Problem der Produktionsmittelknappheit wurde in der DDR zunächst mit einem ausgedehnten Investitionsprogramm begegnet.
Es ergibt sich folgendes Bild: Bereits zwischen 1963 und 1967 wurde der Anteil der Bruttoinvestitionen an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung angehoben, um dann im Zuge einer neuerlichen Wachstumsoffensive bis 1970 noch einmal zu steigen und zwar auf 33 Prozent. Das heißt, in dieser Zeit musste verstärkt akkumuliert werden, um den Bedarf an Produktionsmitteln decken zu können.
Otto Reinhold schreibt 1972: „Wenn wir nicht rechtzeitig für den notwendigen Akkumulationsvorlauf sorgen, führt das zu beträchtlichen ökonomischen Disproportionen und Reibungsverlusten, die das Tempo des sozialistischen Aufbaus hemmen. Der gesetzmäßige Zusammenhang kann also nicht außer Kraft gesetzt werden, er setzt sich durch, aber wird nicht von uns beherrscht.“[19]
In den 1970er und 1980er Jahren stieg dagegen der Anteil des Konsums am Gesamtprodukt. Dies wurde in den 1980er Jahren mit einer stark rückläufigen Investitionsquote bezahlt, das heißt, die Akkumulation wurde verlangsamt, was dazu führen muss, dass der Bedarf nach Konsumgütern immer schwerer gedeckt werden kann. Der Anteil der Bruttoinvestitionen an der Wertschöpfung sank von 30 Prozent in den Jahren 1980/81 bis auf 23 Prozent in den Jahren 1985/86. Auch die leicht ansteigende Investitionsquote im Jahre 1986 änderte nichts an diesem Trend. Dabei ist zu beobachten, dass der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung im selben Zeitraum zunahm, er steigerte sich auf 65 Prozent im Jahre 1989. Dabei wuchs insbesondere der Anteil der chemischen Industrie und der des Maschinen- und Fahrzeugbaus, sowie der der Elektrotechnik und Elektronik. Der Anteil der konsumnahen Industriebereiche (Leicht-, Textil und Lebensmittelindustrie) als Anteil an den Industrieinvestitionen ging jedoch leicht zurück.[20]
Vereinfacht gesagt: Da die Geldmittel jetzt überwiegend dazu dienten, die Investitionen in bestimmten Bereichen der Industrie voranzutreiben, blieb die Produktion von Konsumgütern auf der Strecke. Auf diese Art und Weise wird aber die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit gehemmt. Die gesellschaftliche Verteilung der Arbeit wird so erst recht willkürlich gegenüber einem bestehenden Bedarf (was sich darin zeigt, dass das Warenangebot immer weniger der Nachfrage entspricht). Die Akkumulation entgegen der Nützlichkeit der Produktionsergebnisse, entgegen der Proportionalität der Gebrauchswerte, wird damit konfrontiert, dass die Menschen entsprechend ihres Einkommens konsumieren wollen.
In der DDR waren ab 1984 kontinuierlich zurückgehende Zuwachsraten der Produktivität zu beobachten. Die Verteilung der Erweiterungsmittel auf bestimmte Bereiche verstärkte die Innovationshemmnisse in nicht geförderten Teilbereichen. „Insbesondere die Monopolstellung der Kombinate, die vergleichsweise geringen qualitativen Anforderungen im RGW-Handel sowie der nach wie vor in erster Linie quantitatives Wachstum belohnende Lenkungsmechanismus verhinderten eine erfolgreiche Erneuerung der Produktion. [...] Durch die Konzentration der Mittel auf die Schwerpunkte stieg der Anteil der unvollendeten Investitionsvorhaben und damit teilweise oder gar nicht produktionswirksamen Mittel weiter an.“ [21]
Ich wage zu behaupten, dass letztlich nicht mehr allein der Plan über die ökonomischen Geschicke entschied, sondern dass in einem erheblichen Maße gegen bestimmte Entwicklungen angekämpft wurde, die man selbst nicht mehr ausreichend beherrschte. Die Kluft zwischen Plan und Bedarf (ausgedrückt in Geldeinheiten) wurde immer weiter aufgerissen. Ein Indiz dafür ist das enorme Anschwellen des Kaufkraftüberhangs in der DDR in den 1980er Jahren, was nichts anderes bedeutet, als dass die stoffliche Reproduktion der Gebrauchswerte nicht ihrem Geldausdruck entsprach.
Unterschiede in der Produktivkraftentwicklung der Arbeit, Unterschiede im Tempo der Akkumulation, machen aber einen Unterschied im Tausch.
Die Waren tauschen erstens, weil sie nützlich für andere sind, zweitens aber, weil sie sich als Tauschwerte gegeneinander ersetzen müssen. Im Kapitalismus wird dieser Widerspruch nur dadurch regelmäßig gelöst, indem die „gebrauchswertökonomische Proportionalität“ in der Form der zyklischen Bewegung des Reproduktionsprozesses gewaltsam hergestellt wird. Das Geld erscheint in der Realisierungskrise als etwas Verschwindendes gegenüber dem Anwachsen der Gebrauchswertmasse, die sich nur als Wert realisieren kann. Daher die engen Grenzen, die der Produktiv-kraftentwicklung im Kapitalismus gesetzt sind, daher seine historische Begrenztheit. Der Sozialismus hebt diesen Widerspruch allmählich auf, indem er die gebrauchs-wertökonomische Proportionalität von ihrer engen Begrenztheit durch den Wert löst (zunächst durch die Aufhebung des Eigentums, gleichzeitig, solange die Ware noch besteht, und im Anschluss daran, durch die Ausnutzung der Preisform), aber der Sozialismus kann den Wert nicht „abschaffen“, er kann nur über den Weg der planmäßig-proportionalen Entwicklung die Wertform in die Schranken weisen und so auch den Widerspruch der Ware. Indes, gibt der Sozialismus die Steuerung über diese Proportionalität auf, oder stemmt sich gegen sie, wird sich diese Proportionalität gewaltsam herstellen und zwar auf eine Weise, welche die sozialistischen Eigentumsverhältnisse untergraben kann.
Die betriebsindividuell aufgewandte Arbeit verlor mehr und mehr den Bezug zu ihrer Gesellschaftlichkeit (die proportionale Verteilung der Arbeit wurde zunehmend unplanbar), sodass sich die verschiedenen individuellen Arbeiten erst als gesell-schaftliche herausstellen müssen. Die Arbeit wird gesellschaftlich verausgabt, aber das Geld wirkte jetzt zersetzend auf diese Gesellschaftlichkeit. Denn die Waren müssen sich – vermittels des Geldes – wechselseitig ersetzen. Sie wechseln die Hände nicht nur aufgrund ihrer eigentümlichen Besonderheiten, sie tauschen[22] gegen Geld, das ihre wechselseitige Austauschbarkeit vermittelt, ganz unabhängig von ihren stofflichen Besonderheiten. Die Gebrauchswerte, die zu einem Festpreis verkauft werden, müssen sich realisieren in Geld. Aber sie realisieren sich im Geld nicht als die betriebsindividuell aufgewandte Arbeitszeit, die für ihre Produktion erforderlich war, sondern als gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, also Arbeitszeit „erheischt, um unter gegebnen allgemeinen Produktionsbedingungen ein neues Exemplar derselben Ware zu produzieren.“ (Marx).
Ändern sich die gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen einer spezifischen Ware, so wird sie nicht mehr produziert unter den Bedingungen wie im Plan ursprünglich vorgesehen, sondern unter günstigeren oder schlechteren Bedingungen, je nachdem, ob die in die Ware eingegangene Arbeitszeit der gesellschaftlich notwendigen entspricht. Die geänderten Reproduktionsbedingungen führen dazu, dass die Waren im Preis fallen oder steigen müssten. Sie müssten im Preis fallen, wenn die Arbeitszeit, die tatsächlich in sie eingegangen ist, über der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit steht und sie müssten steigen, wenn die betriebsindividuell verausgabte Arbeitszeit unter der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit steht.[23] Der Wert revoltiert also gegen Plan und Festpreis. In der DDR hätten die Waren des täglichen Bedarfs im Preis steigen müssen – denn ihre Produktion, dem Gebrauchswert nach, hinkte dem Bedarf, ausgedrückt in Geld, hinterher. Das aber wäre undenkbar gewesen, denn die Kosten der Preissteigerung hätten die arbeitenden Menschen zu tragen gehabt. Stattdessen blieben sie niedrig und die Produktion blieb ständig hinter dem Bedarf zurück.
Aufschlussreich ist etwa der Beitrag von Wilfried Ettl, Jürgen Jünger und Dieter Walter aus dem Jahre 1990. Dort werden schonungslos die Krisenerscheinungen der DDR-Wirtschaft benannt. Es heißt dort unter anderem: „Real existierender Sozialismus ist einerseits Mangelwirtschaft und andererseits Verschwendung.“[24] Die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, spiegeln den Verfall der Eigentums-verhältnisse in der DDR wider: „Die Monopolstellung des Staates als wirklicher Eigentümer mit ihren Folgen – Interessenlosigkeit, Innovationsträgheit usw. bei den Produzenten – kann letztlich nur durch eine Diversifikation der Eigentumsformen aufgehoben werden.“[25] „Geld und Finanzen sind als Steuermedien voll zur Geltung zu bringen. […] Das politische Festpreissystem ist durch ein System ökonomisch gesteuerter, sich weitgehend am Markt bildender Preise zu ersetzen.“[26] usw. usf.
„Auf einen kurzen Nenner gebracht“, so die Autoren, „besteht die Ursache des desolaten Zustands der DDR-Wirtschaft in der wachsenden Ohnmacht der individuellen und kollektiven Produzenten, ja selbst des Staates, gegenüber den geschaffenen gesellschaftlichen Strukturen, in denen sich die Entwicklung der Wirtschaft vollzieht. Ökonomie entzieht sich zunehmend der Gestaltbarkeit, erscheint mehr und mehr als Abhängigkeit von Sachzwängen.“[27]
Nicht, dass die Ökonomen der DDR und anderswo nicht selbst dahinter gekommen wären, dass zwischen Plan und Bedarf eine Lücke klafft. Aber daraus wurde eben auch die Möglichkeit einer sozialistischen Marktwirtschaft abgeleitet. Also wenn schon Wertgesetz, dann bitte richtig, mit einem „funktionierenden Markt“, wo sich unabhängige „Anbieter“ und „Nachfrager“ gegenüberstehen. Das NÖS in der DDR hätte nicht zwangsläufig in die Einbahnstraße führen müssen, aber das Geld ist eben etwas Zwieschlächtiges. Aus dem Fortbestand der Preisform konnte man dann bequem schließen, dass, wo ein Preis, da eben auch ein Wert sein muss, wie Jacobs sagt, nur mit dem realen Hintergrund, dass der Wert letztendlich eben doch voll durchschlug.
Weil die Betriebe selbständig sind, müssen die Gebrauchswerte als Waren tauschen, das war die unumstößliche Lehrmeinung der offiziellen DDR-Ökonomie Ende der 1980er Jahre, in der sich ihre Kapitulation widerspiegelt.
Insofern stimmt es, wenn Jacobs meint, das „Scheitern“ des Sozialismus wurde „organisiert“, aber eben auch von innen heraus. Es war vor allem auch ein Scheitern der ökonomischen Wissenschaft.
Nämlich als ein Rückzug der Theorie vor den scheinbar unbeherrschbaren Gesetzen der Ökonomie.
Gerfried Tschinkel
Wien
Hermann Jacobs
„Wünsche und Wirklichkeit“.
Zwei Fragen zur politischen Ökonomie des Sozialismus: Der auf Geld reduzierte Staat / nicht erfüllte Pläne und Preise
Man wünschte sich manchmal, die Debatte, die heute im „offen-siv“ über die Politische Ökonomie der sozialistisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung geführt wird, hätte schon im Sozialismus, in der UdSSR, DDR usw. stattgefunden. Ich will nicht übertreiben – sie gibt sicher auch noch nicht alles her was zu sagen notwendig gewesen wäre. Aber einiges haben wir doch schon gesagt, was längst auf die Tagesordnung gehört hätte; z.B. die viel stärkere Verteidigung der Planwirtschaft des Sozialismus im Sinne einer Überwindung des Kapitalismus, und hier nicht einmal des Kapitalismus im Besonderen, sondern seiner Grundlage, der Warenökonomie im Allgemeinen. „offen-siv“ hat viel mehr in den Mittelpunkt gestellt, dass der Sozialismus schon war, was Marx, Engels, schließlich Lenin, und letztlich auch Stalin, einst vorausgesehen hatten: real überwundene Warenökonomie zu sein, oder anders gesagt: real aufgebautes Verhältnis zur Ökonomie als einer Ökonomie der Gebrauchswerte, der konkreten Arbeit zu sein. In der offiziellen bis offiziösen Theorie von einerseits Planwirtschaft und andererseits noch (immer) Warenpro-duktion ging das ja unter, und man konnte sich sowohl das eine als auch das andere aussuchen – was denn nun der wichtigere Gesichtspunkt bei der Bewertung des Sozialismus war: Plan oder Ware, oder Plan und Ware, oder: Ware (ganz groß) und Plan (ganz klein).
Besonders die Heraushebung des Systems der Preise im Sozialismus als eines Systems fester Preise gehört hier in die Neubewertung der realen sozialistischen Ökonomie. Wenn gesagt wird, die sozialistische Ökonomie sei auch Warenökonomie, ist das System fester Preise keineswegs mehr selbstverständlich, weil die Orientierung immer dahin geht, der Zukunft des Sozialismus gehöre aber die Rückkehr (oder Wiedereinkehr) wertökonomisch begründeter Preise. Neu in „offen-siv“ ist auch die relative Kritik, die wir an der Marx-These von der Einführung (Ausstellung) von Arbeitszeitzertifikaten für geleistete Arbeitszeit geübt haben. Zu diesen ist es nicht gekommen, sondern es ist beim Geld geblieben. (Arbeitszeitzertifikate in der Hand des Arbeitenden wird es nie geben, heißt das.) Waren wir schlauer (besser erkennend) als Marx? Nein, so die Antwort, sondern das Geld hat seinen Charakter geändert; dieser ist in einer Planwirtschaft der Realität nach reduziert auf ein reines Kaufmittel. Geld erscheint nur, um in Waren (Gütern, Produkten, also Gebrauchswerten) zu verschwinden; es wechselt nur: Vom „Staat“ zum Käufer, vom Käufer zum Staat. Es zirkuliert also nicht. (Richtig KKE[28]). Es ist der Wechsel des Geldes von einem Mittel des Eigentums in ein reines Kaufmittel, das das Arbeitszeitzertifikat überflüssig gemacht hat. Dem eigentlichen Inhalt des Gedankens von Marx, das Arbeitszertifikat löse sich nur in Gebrauchsgütern auf, ist voll entsprochen. Ein nur als Kaufmittel verwendetes Geld macht das auch.
Wir haben zwei Fragen aufgeworfen, die längst eine Richtungsänderung in die Debatte um die Trennung von der Warenökonomie durch Sozialismus hereingebracht haben – man muß es nur erkennen wollen. Aber die Interessen sind nicht so einfach gelagert.
Zwei neue Arbeiten, wieder zu dieser Frage, eine wiederum vom unermüdlichen Wolfgang Hoss, eine zweite von einem neuen Autor: Gerfried Tschinkel aus Österreich.[29] Inhalt der einen Arbeit: eine auf die Geldverteilung reduzierte Rolle des sozialistischen Staates (oder des sozialistischen zentralen gesellschaftlichen Organs), Inhalt der anderen ist die Frage nach dem Standvermögen des Festpreises unter der Bedingung von nichterfüllten Plänen, also der Entstehung von Diskrepanzen von Warenmengen alias Preismengen und Geldmengen. Bringt das den Rückfall in den Wertpreis? Tschinkel bejaht.
Der Staat als der allgemeine Banker
Wolfgang Hoss will den Gewinnstachel in ökonomischen Systemen töten (aus Gründen der ökonomischen Krisen aller Art, die dieses Streben nach Gewinn hervorbringt) und schlägt – ganz erstaunlich bei ihm – vor, den Gewinn (Mehrwert/ Profit?) im Sozialismus formell zum Verschwinden zu bringen. Die bekannte marxsche kapitalisierte Wertform/-formel c+v+m solle ersetzt werden durch einen Preis, der sich zusammensetzt aus den Kosten bei der Erzeugung eines Produktionsgutes plus einer jedem Kostpreis auferlegten Staatssteuer. Also Kostpreis plus Staatssteuer. Der Gewinn ist weg.
Warum muß er eigentlich weg sein? Widerspiegelt er nicht, die Gesellschaftliche Gesamtarbeit betrachtet, den Teil der Arbeit bzw. Produktion, der über die bloße Erstattung des Produktionsverbrauchs (einfache Reproduktion) und der Kosten für den Erhalt der Arbeitskraft hinausreicht, also die Arbeit für die Erweiterung der Produktion? Eine förmliche Staatssteuer auf den Preis wäre gewiss ein über die Kosten plus den Lohn hinausgehender Anspruch des Staates auf die „Mehrarbeit“, Staatsausgaben stellen gewissermaßen die „äußeren Kosten“ der Gesellschaft dar – sie könnten auf diesen Inhalt reduziert werden, aber sie wären keineswegs ein die Existenz eines Sektors der erweiterten Reproduktion in Frage stellender Preis; genauer noch: die Staatssteuer brauchte diesen Sektor der Produktion gar nicht zu berühren; die erweiterte Reproduktion ist ja nicht gleich dem Staatsverbrauch. Der Gewinn muß nicht „weg“ sein – und ist es auch nicht.
Was ist Staatssteuer? Hoss: „Wenn, erstens, auf die betrieblichen Kosten CK nur noch ein Steuer- und Aufgabenaufschlag ST erhoben wird, so dass für den Wert (Achtung, neue Wertbestimmung durch Hoss!, J.) des Produkts die Formel Y = CK+ST gilt, und wenn zweitens der Staat den Steuer- und Abgabenaufschlag so festlegt, dass alle Ausgaben der öffentlichen Haushalte und der sozialen Sicherungssysteme ersetzt werden können (kursiv von mir, J.), wozu benötigt dann eine solidarische auf Arbeitseinkommen festgelegte Gesellschaft den Gewinn?“. (S. 39)
Nun, sie benötigt ihn, weil sie ihn produziert. Sie kann ihn auch verbrauchen. (Wie, vor allen Dingen wie er – im Sozialismus eines Festpreissystems – erscheint, ist eine andere Frage.) Der Staatsverbrauch ist ein über den einfachen Produktionsverbrauch und den Lohn hinausgehender Teil der gesellschaftlichen Arbeit, aber er schöpft nicht den Inhalt des Teils der Arbeit aus, den wir den Sektor der Erweiterung des Produktionsverbrauchs nennen, also der den Produktionsverbrauch für das Wachstum der Produktion ausmacht. Der „Gewinn“ wird tatsächlich auch dann noch gebraucht, wenn wir den Staatsverbrauch als eine Extrasteuer, als eine Extrakategorie in das System der ökonomischen Kategorien einführten, oder, wie Hoss vorschlägt, dem Kostpreis hinzu fügten.
In der kapitalistischen Gesellschaft kommt der Staat dadurch zu seinem Recht, dass er das Einkommen der Kapitalisten (Profit) und das Einkommen der Arbeiter (Lohn) mit Steuern belegt. Staatsverbrauch ist als eine Steuer auf Profit und Lohn zu verstehen, er schmälert den Profit - aber nicht soweit, dass nicht noch ein Äquivalent auf die erweiterte Reproduktion übrig bleibt, und schmälert den Lohn, d.h. teilt den ökonomischen Lohn in die Brutto- und die Netto-Lohnform. (Weshalb der real gezahlte Lohn nicht gleich Lohn im ökonomischen Sinne ist.) Nun muß diese Art der Besteuerung nicht sein, wenn man die Staatssteuer, wie Hoss vorschlägt, als eine Extrakategorie in die Ökonomie oberhalb von Kosten und Lohn einführt, wo bisher der Gewinn geparkt ist, aber rein der Sache nach schöpft er – nur mal bezogen auf den Profit/Gewinn – den Begriff des Gewinns nicht aus; Gewinn wäre immer mehr, es sei … die Staatsteuer würde auf die Höhe des Gewinns steigen. Aber dann wäre der Staat über seinen Verbrauch hinausgegangen und hätte sich in den Besitz des Produkts der erweiterten Reproduktion der Gesellschaft gesetzt; er wäre unmittelbar Besitzer von solchen Produktionsmitteln geworden, die nicht in die einfache Wiederherstellung der Voraussetzung jeder Produktion fielen. Und Unternehmen/Betriebe, egal ob solche des Kapitalismus oder solche des Sozialismus, stünden außerhalb der Möglichkeit, unmittelbar eine Ökonomie der erweiterten Reproduktion, des extensiven Wachstums zu betreiben – obwohl diese Mittel produziert worden wären. Nur der Staat könnte das noch.
Oder Hoss erweitert den Begriff der Produktionskosten um die Größe eines möglichen Wachstums (abgesehen davon, dass dann die Begrifflichkeiten nicht mehr stimmten.)
Womit wir zu dem Punkt 2 bei Wolfgang Hoss kommen; er hat, wie das heute üblich geworden, neu über den Sozialismus des 21. Jahrhunderts nachgedacht (siehe Titel seines Aufsatzes) – sein gutes Recht, und ihm ist die Idee gekommen, ob man sich den künftigen Sozialismus nicht so denken könne: Der Staat der allgemeine Banker, der auch alles Geld verteilt, aber über die Verausgabung des Geldes, über die Gestaltung der Produktion mit Hilfe dieses Geldes, „entscheiden die Produzenten selbst“. Dem Staat das Geld, die Arbeit den Arbeitern. In der Sache eingeschränkter Zentralismus, in der Sache erweiterter Dezentralismus = der neue Sozialismus.
Wie kommt der Staat zu allem Geld? Indem, so Hoss, die „sozialistischen Unternehmen ihre Produkte vollständig in einen Fonds des Volkes … liefern würden. … Nach dem Verkauf der volkseigenen Produkte und der zunächst vollständigen Konzentration der finanziellen Mittel (d.h. der Erlöse aus den Verkäufen, J.) in den Händen einer staatlichen Zentrale …“ (S 40) – befände sich alles Geld beim Staat. D.h. der Staat ist der allgemeine Besitzer aller Waren und allgemeine Verkäufer aller Waren, und er ist der allgemeine Besitzer allen Geldes der Gesellschaft. Es ist der Staat, der zwischen den Formen Ware und Geld wechselt; aber rein einer nur ersten Verfügungsgewalt nach – die nicht die einzige und letzte ist. Mit dem Staatsbesitz ist kein sachliches Recht – in Bezug auf die Ökonomie – verbunden, er ist kein wirklicher Besitz.
Wie sieht der ökonomische Kreislauf nun auf der anderen Seite aus, der Seite der Käufer all der schönen Produkte, bzw. wie kommen die Käufer zu dem Geld, um überhaupt kaufen bzw. wieder arbeiten zu können?
Hoss: „…in den Händen einer staatlichen Zentrale könnte jeder sozialistischen Unternehmensvereinigung VSU … nach einem volkswirtschaftlichen Plan jederzeit soviel Geld für Produktionsmittelkäufe und Löhne zugeteilt werden, dass alle nötigen Produktionsmittel gekauft und hinreichende Löhne gezahlt werden könnten.“ (S. 40)
„Das oben kurz beschriebene System der Geldverteilung kann man Global-verteilungssystem (GZS) nennen. … Die Betriebe erhalten ihre finanziellen Mittel … damit nicht mehr durch Einnahmen aus Produktverkäufen („sie würden ihre Produkte nicht mehr für den Austausch produzieren“) … Aber, und das ist entscheidend, die Gelder werden den Unternehmensvereinigungen nicht mit staatlichen Planvorgaben zu ihren Produktionsprogrammen zur Verfügung gestellt, sondern nur mit der allgemeinen Maßgabe, dass das Grundziel ihrer Produktion die Befriedigung der zahlungsfähigen Nachfrage auf dem Markt nach eigenständiger Marktforschung und eigenen Entscheidung sein muß. Die Regelmechanismen des Marktes könnten auf diese Weise auch weiterhin voll genutzt werden, dies allerdings nur im Rahmen der Globalzuteilungen nach dem Volkswirtschaftsplan“. (Hervorhebung Hoss) (S. 41.)
… der sich allerdings bei den sozialistischen Unternehmen auf die „Grobeinteilung“ in Ausgaben in Produktionsmittel (nicht einmal, in welche) und Lohn beschränkte, was man wohl kaum noch als einen Volkswirtschaftsplan qualifizieren könnte. Und auf den Geldeinnahmen, die der Staat aus dem Verkauf der Produktionsmittel der erweiterten Reproduktion erzielte, bliebe er wohl sitzen, wenn er den Betrieben nur die Produktionskosten plus Staatssteuer ersetzte? Oder gründete mit ihnen neue Betriebe?
Wieso allerdings Wolfgang Hoss meint, die „Regelmechanismen des Marktes“ könnten auf diese Weise weiterhin „voll genutzt werden“, ist mir ein Rätsel, wo die Produktionsunternehmen doch gar nicht mehr verkaufen dürfen, sondern der Staat dies macht, und sie auf die Einnahmen bzw. die Preise, die beim Verkauf erzielt werden, unmittelbar gar keinen Zugriff haben können, der Staat hat ihn doch. Wäre es nicht umgekehrt so, dass die „VSU“ eher ein Interesse daran entwickeln, so viel als möglich Geld vom Staat zu bekommen, aber das Interesse am Preis absolut erlahmt? Wie soll da ein Interesse an der Produktion herauskommen? Eher noch eines am Geld bekommen und verbrauchen.
Dem zukünftigen sozialistischen Staat würde ich eher empfehlen, auf das „GZS“, das Globalgeldzuteilungssystem, zu verzichten; es entmündigt ihn ja – die Rechte der bisherigen sozialistischen Staaten betrachtet. Oder es mindestens so zu gestalten, dass mit den Geldzuteilungen (Geldfonds an die Betriebe) weiterhin konkrete Produktionsprogramme, Produktionsvorgaben, verbunden sind. Der Begriff der Zentrale oder Zentralität ist nur dann ein sachlicher, wenn mit ihm die Gestaltung der Gesellschaft verbunden ist; die „Zentrale“ entwickelt eine Gesamtvorstellung (Plan), die im Einzelnen umgesetzt wird – das ist „Zentralismus“. Die „Produzenten“ werden dadurch nicht um ihre Entscheidungsselbstständigkeit oder –freudigkeit gebracht. Ich will nicht gerade sagen: im Gegenteil, dazu kenne ich meine „Pappenheimer“ zu gut, d.h. ich weiß zu gut, dass das Interesse, „mal so richtig draufloszuarbeiten“, die „Hände frei zu haben nach eigenem Ermessen und Gutdünken“, ein Interesse sein kann, das dem immer planvollen Arbeiten entgegengestellt sein kann. D.h. ich kenne meine Produktionsleiter aus der DDR und habe so manches im Ohr. Ich kenne letztlich auch zwei, drei Jahre Praxis des NÖS der DDR. Ich bin sogar der Meinung, dass ein unmittelbares Bestimmen über die Gestaltung von Arbeitsabläufen in Betrieben einen höheren Nutzeffekt bringen kann – für eine gewisse Zeit. Man kann seinen Betrieb mal „auf Vordermann bringen“, aber dann geht es an das Eingemachte, d.h. dann stellt sich die Frage der Erweiterung, der Expansion der besonderen konkreten Arbeit innerhalb der konkreten Arbeit im allgemeinen, und die ist eben keine allgemeine ihrer Natur nach, sondern immer eine besondere, abgestimmte mit allen anderen konkreten Arbeiten. Die ökonomische Freiheit der konkreten Arbeit ist eine andere als die der abstrakten Seite der Arbeit. Das ist doch zu erkennen.
Natürlich, man ist abhängig von der Zuteilung „von außen/oben“, aber außen/oben sitzt eben doch kein Dummkopf, der letztlich keine Ahnung hat und nur willkürlich Entscheidungen trifft. Zweitens: Wer gesellschaftlich entscheidet, und das heißt für alle, verfügt auch nur über begrenzte Mittel. Er muß unterschiedlich zuteilen, ob er will oder nicht, er muß differenzieren; und so bekommt der eine, und der andere nicht, der eine viel oder mehr, der andere wenig, am wenigsten bis gar nichts. In der unmittelbar gesellschaftlichen Arbeit und der Verteilung nach dem ökonomischen Prinzip des Gebrauchswertes bzw. der konkreten Arbeit wird und kann nicht „gleich“ verteilt werden. Das geht weder vom Produktionsprogramm her, das man sich stellt, noch an sich. Was als Schaden oder als schädlich, „uneffektiv“ aus der Sicht des einzelnen Falls, der einzelnen Produktionsstätte erscheint, ist aber volkswirtschaftlich, im Gesamtzusammenhang der ökonomischen Bewegung betrachtet höchst sinnvoll und durchaus effektiv – wenn es denn effektiv ist. In einer Gemeinschaftsökonomie können effektive und uneffektive(-tivere) Betriebe sehr gut nebeneinander existieren. Es muß nicht alles auf Hochglanz poliert werden. Im Sozialismus/Kommunismus gilt nicht das Prinzip der allgemeinen und gleichen Verwertung der eingesetzten Arbeit, sondern nur das Prinzip der allgemeinen und gleichen individuellen Aneignung. D.h. für die Betriebe gilt nicht, was für die Individuen gilt.[30]
Auch eine Planung kann „danebenhauen“. Das gilt besonders für den Anfang des Sozialismus, wenn man noch keine Erfahrung mit der Planung hat. Man sollte annehmen, einfache Planungsfehler, Fehler, die aus einer falschen Bewertung der örtlichen Lagen in der Produktion entstehen, würden mit der Zeit nachlassen bzw. ganz verschwinden. Hier sind die Erfahrungen derjenigen verlangt, die real Planungs-wirtschaft betrieben haben – als Beruf im Sozialismus. Das kann von außen sowieso keiner beurteilen. Ich kann aus meiner Erfahrung in der Produktion – und das ist eine dreißigjährige - sagen, dass ich nicht tagelang in der Arbeit herumgestanden und „auf Material“ gewartet habe, um weiterarbeiten zu können. Ich weiß von mancher Hauruck-Aktion, aber so, dass generell eine Mangel-Arbeit der Betriebe (ich habe in vier verschiedenen gearbeitet) herausgekommen ist und ich eigentlich an meine volkseigene Arbeit nur mit Grausen zurückdenke, wie man anhand mancher Veröffentlichungen über den Sozialismus meinen könnte, war es nun doch nicht.
Hoss’ Idee operiert mit einem Dualismus: Hie der Staat als der allgemeine Eigentümer und Verkäufer der Waren und der allgemeine Geldzuteiler (Banker) – und da entspricht er eigentlich, nur in anderen, nur in seinen Worten, der Realität der sozialistischen Gesellschaft, wie sie existierte; das ist Planwirtschaft, Überwindung der Warenproduktion, Staat in seiner neuen ökonomischen Rolle, aber dort letztlich - bei ihm, per Zukunft - mit einer eingeschränkten, auf ein Minimum eingeschränkten ökonomisch-praktischen Funktion: Produktionsmittelfondsvorgabe – und zwar allgemein, an sich und abstrakt nur in der Geldform, ohne Naturalform, und Lohnfondsvorgabe. Sodass dem Betrieb bleibt, der Sache, d.h. Produktion erst einen konkreten Namen zu geben, und/oder die Löhne … unterschiedlich zu verteilen. Und das ist … Privatökonomie, Warenproduktion. Andererseits letztlich ohne wirkliche Verantwortung des Betriebes „dem Volk“ gegenüber! Ohne ein Programm zu bekommen muß man für kein Programm, keine Programmerfüllung geradestehen. Nur vor sich selber muß man geradestehen. Wie ein Privater Unternehmer. Bankrott gemacht – Pech gehabt, mein Lieber.
Es sieht wie Sozialismus aus, ist aber Privatökonomie.
Wolfgang Hoss operiert mit einem privaten ökonomischen Freiheitsbegriff in einer an sich gesellschaftlich gewordenen Produktion. Er meint, mit diesem zu operieren, will ihn aber in einer nur noch gedrosselten Form freisetzen – denn er will ja den Gewinn weghaben. Warum den Gewinn weghaben? Weil er, wie insbesondere seine einführenden Gedanken zeigen, dem exzessiven Wachstum einen Riegel vorschieben möchte, weil er der Gefahr für die Menschheit begegnen möchte, die darin liegt, einem ökonomischen Prinzip zu frönen, dass die Menschen ständig zwingt, über ihre ökonomischen Voraussetzungen hinauszutreiben. Unendliches, übermäßiges Wachs-tum zerstört letztlich die Menschheit, nimmt der Menschheit den Lebensatem. Es muß begrenztes Wachstum, gedrosselte Expansion - letztlich überhaupt keine Expansion mehr? - geben. Deshalb sein Gedanke, die expansive Kategorie a priori aus der Welt der ökonomischen Kategorien, konkret: aus dem Preis, herauszunehmen. Das ist, lieber Wolfgang Hoss, in Wahrheit doch nur ein pädagogischer Eingriff in die Ökonomie, oder? Preise ohne Gewinn! Aber die einzige Sicherheit, Preis ohne Gewinn zu haben, im Eigentlichen: überhaupt keinen Gewinn mehr zu haben, ist die, keine Produktionsmittel mehr für die Erweiterung der Produktion zu produzieren. Man diskutiert deren Existenz aber nicht weg, wenn man sie aus dem Preis wegdis-kutiert.
Dem Marxismus/Sozialismus steht exzessives Wachstum auch nicht zu Gesicht. Wie ersetzt er den exzessiven Profit des Kapitals durch vertretbaren Gewinn (vertretbare erweiterte Reproduktion)? D.h. wie kommt er denn zu einem die Menschheit erhal-tenden Gewinn?
Spannendes, notwendiges Thema: Gewinn, Wachstum im Sozialismus.
Zum zweiten Autoren:
Die Inkongruenz von Plan und Arbeit und der Preis
Gerfried Tschinkel hat ein Problem: Er respektiert den Festpreis als ökonomischen (systemrelevanten) Preis des Sozialismus (und insofern Aussagen dazu von mir), aber der Preis im Sozialismus „reflektiert noch etwas anderes“, „nämlich“, laut Tschinkel, „die Vermittlung von individuellem und gesellschaftlich notwendigen Arbeits-aufwand, die nicht zusammenfällt mit der Vermittlung von konkreter und abstrakter Arbeit, sehr wohl aber auf den Preis zurückgreift“. Tschinkel meint damit die Ab-weichungen der Planerfüllungen vom geplanten Plan, nach oben oder unten, die er hier als einerseits individuellen, wirklich durch die Betriebe getätigten Arbeits-aufwand charakterisiert, und andererseits, auf Seiten des Planes, als den geplanten und deshalb gesellschaftlich notwendigen Arbeitsaufwand. Er gibt den beiden Begriffen aus der Warenökonomie damit einen anderen Inhalt. Es geht um die Abweichung der Realität von der Erwartung, der wirklichen von der erwarteten Realität. Es geht um die Diskontinuität von Plan und Arbeit, die als Diskontinuität von Produktions- und Geldplanung erscheint. Beide Dinge sind ja Planrealität. Man plant Produktion, und gibt Geld aus, bildet – in Betrieben und Individuen – Geldfonds in Erwartung, dass beide materiellen Prozesse synchron laufen. Was bei anders als geplant ablaufender Arbeit in den Betrieben dann nicht mehr der Fall ist. Es entsteht ein – Problem: Mehr Geld als „Ware“. (Egal nun, welche Zahlen man über das ökonomische Wachstum zelebriert bekommt – sichtbar ist nur eines: Warenmangel (Mangelwirtschaft). „Es wird zu wenig produziert“, „der Sozialismus versteht es nicht, genügend zu produzieren“.)
Was ist mit der Geldmengenplanung, wenn die Produktionsmengen- oder einfach Mengenplanung - nicht funktioniert, nicht synchron läuft? Dann hat man eine Geldmenge (Geldfondsmenge in den Betrieben oder bei den Individuen) und hat eine davon abweichende Produktionsmenge, in die die Geldmenge aufgelöst werden soll – und nun nicht aufgelöst werden kann. D.h. es wurden weniger Produkte als Geld „produziert“. Wohin dann mit dem Geld?
Tschinkel, der in diesem Problem des Sozialismus ein sehr großes, markantes des Sozialismus sieht – er stützt sich dabei aus vielerlei Literatur, die insbesondere in den ersten 90er Jahren, also nach der DDR, von ehemaligen DDR-Autoren, geschrieben worden ist -, meint nun, hier müsse der Preis aktiv werden. Warum? Weil er meint – an vielen Stellen seines Textes -, a) dass Gebrauchswerte „einander tauschen, ersetzen“, und b) dass „der Wert, die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit“ - bei ihm an mehreren Stellen auch in Übereinstimmung gebracht mit dem Begriff der „vollen, richtigen Planerfüllung“ - objektive Kategorien der Gebrauchswertökonomie seien.
„Ändern sich die gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen einer spezifischen Ware, so wird sie nicht mehr produziert unter den Bedingungen wie im Plan ursprünglich vorgesehen, sondern unter günstigeren oder schlechteren Bedingungen, je nachdem, ob die in die Ware eingegangene Arbeitszeit der gesellschaftlich notwendigen entspricht. Die geänderten Reproduktionsbedingungen führen dazu, dass die Waren im Preis fallen oder steigen müssten. Sie müssten im Preis fallen, wenn die Arbeitszeit, die tatsächlich in sie eingegangen ist, über der gesellschaftlich notwen-digen Arbeitszeit steht, und sie müssten steigen, wenn die betriebsindividuell veraus-gabte Arbeitszeit unter der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit steht. Der Wert revoltiert also gegen Plan und Festpreis. In der DDR hätten die Waren des täglichen Bedarfs im Preis steigen müssen – denn ihre Produktion, dem Gebrauchswert nach, hinkte dem Bedarf, ausgedrückt in Geld, hinterher.“ Das aber „wäre im realen Sozia-lismus undenkbar gewesen“, und „so blieb die Produktion ständig hinter dem Bedarf zurück“.
Ganz klar: Tschinkel will, dass im Sozialismus bei auftretender Inkongruenz von Produktenmenge und Geldmenge die Wiederherstellung von Kongruenz durch den Einzelpreis geregelt wird, sein Steigen oder – gegebenenfalls – auch Fallen; haupt-sächlich aber ginge es wohl um Steigen, da die Kritik die „Mangelwirtschaft“ d.h. die Produktion unterhalb der Nachfrage/Bedarf im Sozialismus meint. Da er selbst die Kongruenz versteht als Übereinstimmung von individuellem Arbeitsaufwand und gesellschaftlich notwendigen Aufwand, und diesen dem geplanten Aufwand gleich-setzt, benutzt er in Anlehnung an die erweiterte Wertbestimmung bei Marx – wonach Waren auch anteilig entsprechend der Nachfrage produziert werden müssen, dann erst trete der Wert als solcher hervor -, den Begriff Wert für Kongruenz von Gut und Geld im Sozialismus. So jedenfalls verstehe ich ihn.
Ich kann hier nur auf die Praxis in der sozialistischen Wirtschaft verweisen; zunächst die betriebliche Praxis, d.h. das Entstehen von Inkongruenz von wirklicher betrieblicher Arbeit und geplanter betrieblicher Arbeit, erschienen im Liegenbleiben, Nichtrealisieren von durch den Plan gebildeten betrieblichen Geldfonds. Dazu: Nichtrealisierte Geldfonds wurden am Ende der Planperiode – sagen wir Jahresplan - vom Staat wieder eingezogen. Die sozialistische Ökonomie kennt also das direkte Prinzip der Geldkappung, nicht das relative der Einzelpreiserhöhung. Das erklärt sich so, dass Geld im Sozialismus kein Eigentum ist. Man schädigt also niemanden, dem man das Geld wegnimmt.
Das ist bei den Betrieben so, aber nicht bei den individuellen Einkommen. Mit Löhnen ist ein bleibendes Recht verbunden; einmal gezahlt – immer Eigentum. Es gab bei Löhnen/Individuellen Einkommen keine Möglichkeit der Kappung inkon-gruenten Geldes. Aber es gab auch nicht das Prinzip der relativen Ent-wertung/Kappung von Löhnen, also der allgemeinen nominellen Steigerung der Preise, oder Inflation, weil sich der Sozialismus dieser Möglichkeit bewußt beraubt hatte. So blieben die Löhne – im Falle nichterfüllter Pläne, in Folge mangelnden Angebots im Verhältnis zu gezahlten Löhnen - inkongruent und es stiegen die Sparvolumen.
Frage: Wäre der Mangel verschwunden, die Produktion dem Bedarf wieder adäquat, wenn die Preise nun gestiegen wären? Auf den Wert gestiegen wären? Der ja – dann, laut Tschinkel – gegen den Festpreis und den Plan nicht nur revoltiert, sondern sich auch durchgesetzt hätte? Weitergehende Frage: Hätte der Sozialismus, bei Auftreten von Plannichterfüllungen („Unterproduktionen“ – gegenüber dem Plan, geplanten Bedarf), mit Hilfe von Preiserhöhungen die Erscheinung eines ökonomischen Mangels im Angebot verhindern (unsichtbar) machen können? (Oder sollen?). So wie der – Kapitalismus?
Die Antwort lautet: Steigende Preise, denen keine wiederum steigenden Löhne gegenüberstehen, drängen nur Nachfrage aus dem Markt, mit anderen Worten: Käufer aus dem Verbrauch. Steigende Preise reduzieren das Angebot an Gütern auf weniger Menschen. Nun ist das bei einem zu geringen Angebot – im Verhältnis zum nachfragenden Geld – immer der Fall, aber im Falle nicht steigender Preise ist der Ausschluß von Käufern eher ein zufälliger („wer am Abend kommt hat Pech gehabt“), er erzeugt an sich Unzufriedene, aber nicht prinzipiell Arme, Ärmer-werdende. Jedem verbleibt mindestens im verbleibenden Sparvolumen die Illusion, der Käufer wenigstens von morgen zu werden. Aber bei nominell steigenden Preisen und konstanten Löhnen ziehen sich immer zuerst die Minderverdienenden aus dem Markt zurück, womit potentiell Arme, Ärmere geschaffen werden. Dies der gesell-schaftliche Unterschied von einerseits steigenden Preisen – bei Inkongruenz von „Ware“ und Geld – und andererseits konstant bleibenden Preisen. Und dies wohl auch der Grund, weshalb der reale Sozialismus die Veränderung der relativen Verhältnisse von Ware/Gut und Geld über Preiserhöhungen vermieden hat. Literatur dazu, worin dieses Verhalten verteidigt, oder überhaupt auf dieses Problem eingegangen worden ist, gibt es nicht.
Ob im Sozialismus die Produktion ständig hinter dem Bedarf zurück hing, sie also nie soviel produziert hat als sie laut Plan produzieren sollte, oder anders herum: ob sie stets mit einem Geldüberhang produzierte, so dass die geplante Güterproduktion nie der ebenso geplanten Geldmengenproduktion entsprach, entsprechen konnte – ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke aber eher nein.
Man sagt, die Theorie/These, dass der Sozialismus stets mit einem Geld“überhang“, oder anders, ständig mit einem Vorangehen des Geldes vor der Ware, der Geldmenge vor der Warenmenge, arbeiten solle, stamme von Stalin. Von ihm stammt ja auch die These von der stets besseren/höheren Befriedigung der stets wachsenden Bedürfnisse der Menschen (Grundgesetz des Kommunismus). Und aus der Festpreistheorie wissen wir, dass wachsende Produktion auf der Basis wachsender Produktivkraft nicht von einem Sinken der Preise auf die gefallenen Werte im Einzelnen begleitet wird, so dass umgekehrt mit der wachsenden Produktion den Mengen nach die Summen der Preise steigen müssen und eine auf diese Summe bezogene Menge des Geldes ebenfalls steigt. Wachsende Produktion der Menge nach und wachsende Menge des Geldes sind nur zwei Seiten einer selben Bewegung. Kommt es nun im Jahr I dazu, dass die Produktion nicht im Maße wächst wie vorgesehen, ist aber eine Geldmenge im Maße gewachsen, wie in der Produktion vorgesehen, so ist ein Geldüberhang per Jahr entstanden, der aber im nächsten Jahr, ist weiteres Wachstum vorgesehen, ebensogut auch wieder als Überhang eliminiert werden würde. Das Wachstum der Geldmenge im Jahr II brauchte also nur etwas geringer auszufallen als die Produktion im Jahr II. und Synchronität/Kongruenz zwischen Warenmenge/Preismenge und Geldmenge wären wieder hergestellt. Das Ganze ist also nur ein relatives, ein befristetes Problem, kein absolutes und systemisches. Das Problem eines Geldüberhanges muß nicht an sich von der Theorie behandelt werden, sondern behandelt werden unter der Bedingung stetig wachsender Summen Produkte, Summen Preise, Summen Geldes, und das heißt auch: der Wirtschaftspolitik. D.h. im Sozialismus muß es sozialistisch behandelt werden, eine allgemeine Theorie, auch nicht des Preises und Geldes, für alle Gesellschaftsordnungen, in denen es zur Geldform der Produkte kommt, gibt es nicht und kann es nicht geben.
Ich würde die Problematik eines Bestehens/Entstehens eines Geldüberhanges aus diesem Grund nicht übertreiben.
Anders, wenn ein Produktionsrückgang einträte resp. es der Sozialismus mit chronisch defizitärer Planerfüllung, quasi einer Stagnation zu tun bekäme. Dann müßte er sich schon fragen, wie er sich das permanente Zuviel an Geld vom Leibe schaffte. Dann aber brauchte es noch immer nicht zu dem Weg kommen, der von G. Tschinkel vorgeschlagen: Der „Vernichtung“ des Geldüberhangs durch Preissteigerung der geringer oder zu gering produzierten „Waren“.[31] Der theoretische Inhalt der Frage aber ist: Wäre nominelle Preissteigerung im Sozialismus einer Planwirtschaft ein Beweis, dass zu Wertpreisen zurückgekehrt wäre, der Wert also „gegen Plan und Festpreis revoltiert“ und sich durchgesetzt hätte? Keineswegs. Das Gesetz der Summen-Äquivalenz (Geldsumme = Preissumme), dass also in etwa gleichviel Mengen Geldes „auf dem Markt“ erscheinen im Verhältnis zu Güter-preisen, die auf dem Markt erscheinen, so dass das Geld fließt und kein Geld liegen-bleibt, gehortet oder gespart werden muß, sagt ja nichts darüber aus, dass und ob Preise bewegt werden wie Werte bewegt werden. Es müssen, lieber G. Tschinkel, nur Summen gekappt werden, nicht aber Summen dadurch „gekappt“ werden, dass sie entwertet werden. Das Gesetz der Summenäquivalenz von Geld-Preis besteht unabhängig davon, wie Preise selbst bewegen und dadurch die Summe der Preise verändert wird.
G. Tschinkel ist der Meinung, dass man mit Hilfe der Preise im Einzelnen, also der Bewegung der Einzelpreise, überwinden kann, was nur eine Nichtäquivalenz in den Summen von Preisen und des Geldes ist; man brauche durch nominelle Steigerung der Warenpreise nur die kaufende Kraft des Geldes zu senken. Dann müssen (wenn Preise nominell steigen) weniger Waren durch mehr Geld gekauft werden = Äqui-valenz. Obwohl in seinem Beitrag nicht ausgesprochen, ist das aber der Weg des Kapitalismus, der ja ebenfalls historisch an einen permanenten Geldüberhang geraten ist und diesen auf dem Wege der permanenten Inflation, d.h. der Erhöhung der Preise im Einzelnen wieder eliminiert. Aber der Kapitalismus muß so vorgehen.
Warum der Sozialismus nicht? Warum umgeht oder kann der Sozialismus die permanente nominelle Inflation der Preise im Einzelnen umgehen? Warum muß er anders handeln? Warum könnte sie seine Methode sein, aber warum ist sie nicht seine Methode geworden?
Weil man Geld auch direkt kappen kann, durch einfaches Wegnehmen des überschießenden Geldes. Der Sozialismus kann das. (Ungelöst ist die Frage nur bei Individuen, Löhnen, geblieben. Ich habe mal den Vorschlag einer doppelten Lohn-zahlung gemacht; der eine Lohn ist ein fester, beständiger, ein anderer ein beweg-licher, und zwar ein mit dem Mehrprodukt bewegender Mehrlohn. Weil er vom Wesen her ein beweglicher Satz ist, kann er im Notfall auch mal gekürzt werden. Das wäre im Prinzip dann dasselbe wie bei Betrieben, denen der Staat die ungebrauchten oder nicht zum Gebrauch gebrachten Geldfonds wieder einzieht.)
Im Sozialismus kann man Geld direkt kappen (wegnehmen), weil das Geld im Sozialismus keine Eigentumskategorie ist. Geld ist im Sozialismus nicht Eigentum. Das hat einen großen Vorteil gegenüber der indirekten Methode zur Geldkappung. Man kann das Geld dort wegnehmen, wo es konkret überschießt, d.h. bei den Betrieben, die nicht in der Lage sind, ihre Mittel zur Planerfüllung zu realisieren, weil bei den Betrieben, bei denen sie ihre Produktionsmittel kaufen sollten, die Pläne nicht erfüllt werden. Es werden dann die kaufenden Betriebe „bestraft“, nicht die verkau-fenden.
Hier zeigt es sich, ob Planwirtschaft überhaupt verstanden wird.
Warum ist die Geldwegnahme bei den sozialistischen Betrieben, die ihre Pläne nicht erfüllen, weil ihre Vorlieferanten nicht liefern (oder weil sie auch selbst den Fluß ihrer eigenen Produktion aus irgendeinem Grund nicht garantieren können) kein Problem? Warum schauen sie ihrer „Enteignung“ interesselos zu? Weil sie im Moment, wo ihre Materialbezieher wieder liefern können (oder sie selbst wieder voll produzieren), die Geldfonds zum Kauf ihrer notwendigen Produktionsmittel wieder zugewiesen bekämen.
Gerfried Tschinkel ist aber nur deshalb der Meinung, die Inkongruenz von Geld und Ware müsse über den höheren Einzelpreis der zu wenig produzierten Waren beseitigt werden, weil er – in letzter Konsequenz doch - von der Existenz des sogenannten gesellschaftlich durchschnittlichen Wertes ausgeht. Er macht sich nicht geltend, solange die Kongruenz zwischen gewollter und tatsächlicher Planerfüllung gegeben sei, erscheint aber, sofern diese gebrochen. Ich muß hier leider passen, d.h. ich denke anders. Der Wert, also auch seine gesellschaftlich notwendige Form, ist ein Gesetz des Privateigentums an der Arbeit, der Wert verschwindet also auch, wenn dieses Eigentum verschwindet. Gebrauchswerte aber, die immer, in jeder Produktionsweise produziert werden, also auch in einer eigentumslosen, tauschen nicht. Es muß kein Gebrauchswert genommen werden, wenn einer gegeben worden ist. Gebrauchswerte fließen nur, der Fluß der Gebrauchswerte entbehrt des Zwanges ihrer Gleichsetzung auf eine ihnen gemeinsame Einheit – die abstrakte Arbeit. Dass es nicht die Gebrauchswerte sind, die tauschen, ist in jeder Produktionsweise so, auch in einer Warenproduktion. Dass immer wieder diese irrige Formulierung auftaucht, Tausch hieße Tausch der Produkte als Gebrauchswerte, rührt daher, dass in der einfachsten Erscheinung der Wertform tatsächlich ein Gebrauchswert gegen einen anderen Gebrauchswert tauscht, aber Marx sagt von diesem ersten Gebrauchswert, der auf den Verkäufer eines Gebrauchswertes zurückdelegiert wird, dass er die allererste, einfachste Erscheinung der Wertform ist. Er betrachtet also bereits am Beginn der Warenproduktion die erste eingetauschte Ware nicht mehr unter dem Gesichtspunkt ihres Gebrauchswertes, sondern schon (!) unter dem Gesichtspunkt ihres Erscheinens als die allgemeine Ware des Wertes, also als erste Form des Tauschwertes. Getauscht in der Warenproduktion wird nicht Gw zu Gw, sondern getauscht wird die Ware der relativen Wertform (also bereits in dieser Ware nicht Gebrauchswert, sondern relative (verhältnismäßige, dem Verhältnis nach) relative Wertform) zur Ware der äqui-valenten Wertform, der Form also, die dem Wert direkt entspricht. Gebrauchswerte haben nur in einer Warenproduktion die Eigenschaft (die Pflicht, den Zwang), Träger des Wertes, der Wertform zu sein. Aber diese Eigenschaft haben sie nicht, weil sie Gebrauchswerte sind, sondern weil sie das Erscheinende, das Gegenständliche der Arbeit sind – denn das ist ja der Wert gerade nicht. Er muß aber besessen sein können, Gegenständliche Form eines Eigentums sein, deshalb der Zwang des Wertes an den Gebrauchswert, ihm zur Gegenständlichkeit zu verhelfen, deshalb die „schielende Weise“ (Engels), dass Gebrauchswerte zur Erscheinung „ihres Gegenteils“, des Wertes werden, oder eben Gebrauchswerte für Werte genommen werden. Man hat die Tauschökonomie überhaupt nicht verstanden, wenn man nicht versteht, dass es dem Privateigentum, das Gebrauchswerte gesellschaftlich, für andere produziert, darum geht, im Moment der Weggabe des Gebrauchswertes den Wert, d.h. die Arbeitszeit, die im Eigentum geleistet worden, gerade nicht wegzugeben, sondern erst in Besitz zu nehmen; deshalb die „Rückgabe“ eines anderen Gebrauchswertes an den Verkäufer von Gebrauchswerten. Das ist eben kein Gebrauchswert, sondern ist der Wert in der Gestalt eines Gebrauchswertes! –
Es wäre ein großer Fehler aus einem sozialistischen, planwirtschaftlichen Streben nach Äquivalenz von produzierten mit geplanten Mengen Gebrauchswerten auf die Notwendigkeit des Erhalts der Wertform zu schließen – weil es zweimal, hier wie dort, um Äquivalenz geht. Belassen wir es beim Wert um das eine Mal.
Hermann Jacobs
Berlin
Cuba |
Heinz W. Hammer
Betreff Cuba – Das Trümmerfeld der reaktionären Illusionen
Ausgerechnet die »Sozialistische Tageszeitung – Neues Deutschland« veröffentlichte am 05./06. Sept. 09 eine Rezension von Benjamin Jakob mit dem Titel »Antonio José Ponte besichtigt das moribunde Havanna - Trümmerfeld der Metropole« (Bespre-chung des Buches »Der Ruinenwächter von Havanna«) Nun ist es bereits ist ärgerlich, wenn der Leser einer Rezension bereits beim Titel gezwungen wird, zum Wörterbuch zu greifen. Dieses Ärgernis setzt sich dann noch ungebremst fort, nachdem Autor und Rezensent dekretieren, dass nicht nur die cubanische Hauptstadt Havanna, sondern auch der Revolutionsführer Fidel Castro (in dem Beitrag wie Che kumpelhaft nur mit Kurz- bzw. Vornamen erwähnt) »moribund«, also laut Duden »Med.:Im Sterben liegend, dem Tode nah« seien.
Wer jemals in dieser karibischer Metropole zu Gast war, weiß jedoch, dass diese vor prallem Leben pulsiert. Um diesen nicht zu leugnenden Widerspruch zu überwinden und dem eigentlichen Anliegen, nämlich der Diskreditierung der cubanischen Revolution, gerecht zu werden, muss also ein Kunstgriff her. Denn zwar erkenne der besprochene, bezeichnenderweise in Madrid lebende Autor »die stete Bereitschaft der Habaneros zu feiern« an, die cubanische Gesellschaft in Gänze jedoch befinde sich »in Auflösung«.
Die dann folgenden Angriffe auf das durch seine Sicht auf die Hauptstadt widerspiegelte cubanische Gesellschaftssystem, »die Stadt ruiniert, ihre Bewohner ruiniert, und Ruine wird, wer ins Mahlwerk der Macht gerät«, ist nach Form und Inhalt kaum mehr als der literarische Wurmfortsatz des anticubanischen Propagandastreifens »Havanna - Die Neue Kunst Ruinen zu bauen« (2006), der - wie vom Regisseur Florian Borchmeyer damals selbst zugegeben - »in Teilen unter konspirativen Bedingungen«, also mit geheimdienstlichen Mitteln produziert wurde. Der Rezensent teilt mehrmals die Behauptungen des offenbar von ihm sehr bewunderten Autors: »Die Trümmer, sagt der Autor richtig, seien zu Teilen eine Schöpfung der Comandantes, Zeichen einer „Sehnsucht nach dem militärischen Angriff“. Castro braucht die Ruinen – damit seine Warnung vor der Intervention aus dem Norden auf paradoxe Weise glaubhaft blieb.«
Zusammengefaßt: Die Revolutionsführung lässt aus strategischen Gründen das Volk darben, die Städte verkommen und betreibt ansonsten beständig eine kriegs-treiberische Politik.
Dies alles ist jedoch interessanterweise weder in Form noch Inhalt neu. Im Gegenteil. Es wird zitiert »auf Teufel kommt raus«, ohne dass die Zitate als solche ausgewiesen werden. Die ganze »Argumentation« ist bereits im Begleitheft des o.g. Films von 2006 enthalten und selbst der Titel stammt aus der Begründung der Jury, die diesem den mit € 10.000 dotierten »Bayrischen Filmpreis in der Kategorie Dokumentarfilm« verliehen hatte. Der Laudator Stoiber hatte damals formuliert »Dabei verfallen Borchmeyer und Hentschler nicht der verlockenden Poesie des Moribunden, sondern feiern die erstaunliche, nostalgiefreie Vitalität der Ruinenbewohner«. (siehe: Hans Weiss, »Kuba – Nachrichten von der Schurkeninsel«, S. 83ff.) Da lacht das alte Kolonialistenherz …
Der Autor selbst scheint, gelinde gesagt, eine schillernde Persönlichkeit zu sein. In der ND-Rezension wird Ponte vorgestellt »als Liebling des Castro-Systems und Feind desselben, ausgeschlossen aus dem Künstlerverband, als ein Gespenst, zum Schweigen verurteilt seit 2003 (…) Seit 2006 lebt (…) Ponte in Madrid.« Hans Weiss schreibt (S. 86): »Borchmeyer und Hentschler (…) bedienen sich dazu des nach eigener Aussage einzigen in Kuba lebenden Redakteurs der spanischen Zeitschrift „Encuentro da la Cultura Cubana“, Antonio José Ponte, der sich selbst als Inhaber eines imaginären „Lehrstuhls für Ruinologie“ bezeichnet (…).«
Das Ganze müffelt denn doch stark nach Geheimdiensten.
Da verwundert auch kaum noch die unerträgliche Arroganz des Rezensenten gegenüber den »anderen Totengräbern der Stadt, jene Campesinos, Provinzler, die Havanna ab 1959 rasch eroberten (…) Leute mit ländlichem Gebaren (…) Man denke an die Besetzung Roms durch die „Barbaren“«. Dass der Autor diese Beschimpfungen ausgelassen habe, stellt die einzige Kritik des Rezensenten dar. Ansonsten bilden Rezensent und Autor ganz offensichtlich eine geschlossene ideologische Front. Ersterer bescheinigt letzterem abschließend: »Dies ist ein kluges Buch«. Ach? Beide scheinen doch eher davon beseelt zu sein, der Müllsammlung anticubanischer Propaganda einen weiteren Beutel hinzuzufügen, als sich tatsächlich »klug«, sachlich und unvoreingenommen mit den – zweifellos vorhandenen – Widersprüchen und Probleme des cubanischen Alltags auseinandersetzen zu wollen.
Es wäre aber wohl müßig, solch reaktionären Positionen die Realität nicht nur des lebendigen Havanna, sondern auch des hierzulande tatsächlich von Konzernen und Politikern gewollt herbeigeführten Verfalls ganzer Stadtviertel aus Profitgründen (ich selbst wohne in einem solchen Quartier) entgegenzustellen und darüber zu reflektieren.
Heinz-W. Hammer
Essen, 22.09.09
Nächster Durchgang des Fernstudiums – März 2010 |
Dritter Durchgang unseres marxistisch-leninistischen Fernstudiums
Zeitraum: März 2010 – Juni 2011
I. Allgemeines
Das Fernstudium soll die Grundlagen des Marxismus-Leninismus vermitteln und diese nutzbar machen für die aktuelle Praxis. Da die interessierten Genossinnen und Genossen weit über das Land verstreut sind und wir nicht die Kapazitäten haben, kontinuierliche Schulungsarbeit vor Ort durchzuführen, haben wir uns für die Form des Fernstudiums entschieden.
Diese Form bedeutet, dass es Einführungsseminare mit den „Teamern“, also den für den jeweiligen Studienteil verantwortlichen „Lehrern“ geben wird, woran sich eine Phase der Eigenarbeit in den jeweiligen Gruppen bzw. allein anschließt. Eine solche Phase dauert drei Monate. Am Ende dieser Zeit findet eine Lernzielkontrolle statt, deren Auswertung und Nachbereitung bei einem Zwischenseminar durchgeführt wird. Nun würde die zweite Phase des Studiums beginnen, aufgebaut so wie gerade für die erste Phase dargestellt. Im Ganzen denken wir an einen Zeitraum von eineinhalb Jahren, jeweils unterteilt in 3-monatige Blöcke – so wie oben skizziert.
Voraussetzungen und Bedingungen
Das Programm ist nicht unkompliziert, setzt kontinuierliche Arbeit und einige Disziplin voraus. Andererseits ist es auch zu schaffen: als Teilnehmer/in muss man ein- bis zweimal wöchentlich zwei bis drei Stunden Studienzeit aufbringen können, man muss alle drei Monate zu einem zweitägigen Wochenendseminar fahren können. Und hilfreich ist es, wenn man Zugang zu einem Computer mit Internet-Anschluss hat.
II. Methode:
1. Das Startseminar: Überblick über den Inhalt und Einsicht in den Zweck des gesamten Fernstudiums sowie notwendige philosophische und wissenschaftstheo-retische Grundlagen, dann Einführung in die erste Studienphase mit überblickartigen Vorträgen zu den beiden inhaltlichen Blöcken (Ökonomie und Politik, die wechsel-weise in zwei Lerngruppen behandelt werden), anschließend Fragen und Diskussio-nen. Dabei Mitschriften über inhaltliche Eckpunkte und Fragen anlegen.
2. Selbständige konkrete Bildungsarbeit vor Ort in den Gruppen oder individuell – anhand von Literaturangaben, den Mitschriften aus den Einführungsseminaren und Diskussionen.
3. Lernzielkontrolle. Jede/r einzelne Teilnehmer/in schreibt eine Art Klausur, d.h. alle Teilnehmer/innen bekommen einen Fragenkatalog zugesandt. Die Antworten werden von den jeweiligen Teamern intensiv durchgesehen und mit Kommentaren versehen zurückgegeben, so dass Lernfortschritte und eventuelle Lernprobleme sichtbar wer-den.
4. Die weiteren Seminare, worin im ersten Teil die Probleme, Fragen und evtl. Unklarheiten, die sich in der Lernzielkontrolle gezeigt haben, aufgenommen und geklärt werden können. Im zweiten Teil gibt es dann die Einführung in die zweite Studienphase mit überblickartigen Vorträgen zu den beiden inhaltlichen Blöcken (Ökonomie und Politik), anschließend Fragen und Diskussionen. Dabei Mitschriften über inhaltliche Eckpunkte, Probleme und Fragen anlegen.
In dieser Weise wird es insgesamt sechs Seminare geben: das Einführungsseminar, vier Zwischenseminare und das Abschluss-Seminar.
III. Die Seminare
Startseminar
1. Tag, Sonnabend
Anfangsplenum, Sonnabend, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr
- Technisches
- Überblick über das gesamte Fernstudium; dann
- Philosophische Grundlagen, Wissenschaftsbegriff, Erkenntnistheorie, Materialismus u. Idealismus, Materialismus in der Gesellschaftswissenschaft, Basis-Überbau-Modell, Bestimmung: was ist die Grundlage einer Gesellschaftsformation?
Kaffeepause - 15.00 bis 15.30 Uhr
Startseminar Lerngruppe A, Ökonomie Ware - Gebrauchswert und Wert, |
Startseminar Lerngruppe B, Politik Klassen im Kapitalismus, |
Abendessen - 18.30 bis 19.30 Uhr
Zweites Plenum, Sonnabend, 19.30 – 21.00 Uhr:
Geschichte der Gesellschaftsformationen, Teil 1:
Begriffsklärungen: Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse,
Urgesellschaft, Stammesgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft.
danach Kennenlernen, Gespräche, Diskussionen…
2. Tag, Sonntag
Frühstück - 8.30 bis 9.30 Uhr
Startseminar Lerngruppe A, Ökonomie Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe B |
Startseminar Lerngruppe B, Politik Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe A“ |
Mittagessen - 12.30 bis 13.30 Uhr
Schlussplenum, Sonntag, 13.30 – ca. 15.30 Uhr:
1. Teil:
Kurt Gossweiler berichtet über lernen und kämpfen
2. Teil:
Rückmeldung über das erste Wochenendseminar:
Kritik, Lob, Wünsche usw.
2. Seminar: Erstes Zwischenseminar (nach 3 Monaten)
1. Tag, Sonnabend
Anfangsplenum, Sonnabend, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr:
Frank Flegel: Verhältnis von Wissenschaft und Politik, Abgrenzung zur bürgerlichen Geschichtsschreibung,
zu Theologie, zum Biologismus, Psychologismus, Sozialdarwinismus usw.
Kaffeepause - 14.30 bis 15.00 Uhr
1. Zwischenseminar Lerngruppe A,Ökonomie 1. Teil: Wiederholung und Klärung 2. Teil: Fetischcharakter der Ware u. des Geldes, |
1. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik 1. Teil: Wiederholung und Klärung 2. Teil: Parteitheorie I: |
Abendessen - 19.00 bis 20.00 Uhr
Zweites Plenum Sonnabend, 20.00 bis 21.30 Uhr:
Gerhard Feldbauer: Die kommunistische Bewegung in Italien nach der Wahlniederlage
2. Tag, Sonntag
Frühstück - 8.00 bis 9.00 Uhr
1. Zwischenseminar Lerngruppe A,Ökonomie Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe B“. |
1. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe A“. |
Mittagessen - 13.00 bis 14.00 Uhr
Schlussplenum, 14.00 bis 16.00 Uhr
1. Teil:
Geschichte der Gesellschaftsformationen
2. Teil:
Reflexion des Fortgangs unseres Fernstudiums, Lob, Kritik, Wünsche, Verbesserungsvorschläge.
3. Seminar: Zweites Zwischenseminar (nach 6 Monaten)
1. Tag, Sonnabend
Anfangsplenum, Sonnabend, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Michael Opperskalski: Der aktuelle Zustand der kommunistischen Bewegung in Deutschland und seine Vorgeschichte.
Kaffeepause - 14.30 bis 15.00 Uhr
2. Zwischenseminar Lerngruppe A, Ökonomie 1. Teil: Wiederholung und Klärung 2. Teil: Formen der Mehrwertproduktion, |
2. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik 1. Teil: Wiederholung und Klärung 2. Teil: Parteitheorie II: Partei und 3. Teil: Staatstheorie: |
Abendessen - 19.00 - 20.00 Uhr
Zweites Plenum Sonnabend, 20.00 bis 21.30 Uhr
Michael Opperskalski: Die so genannte „neue Weltordnung“
2. Tag, Sonntag
Frühstück - 8.00 bis 9.00 Uhr
1. Zwischenseminar Lerngruppe A,Ökonomie Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe B“. |
1. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe A“. |
Mittagessen - 13.00 bis 14.00 Uhr
Schlussplenum, 14.00 bis 16.00 Uhr
1. Teil:
Frank Flegel: Die aktuelle Weltwirtschaftskrise
2. Teil:
Reflexion des Fortgangs unseres Fernstudiums, Lob, Kritik, Wünsche, Verbesserungsvorschläge.
4. Seminar: Drittes Zwischenseminar (nach 9 Monaten)
1. Tag, Sonnabend
Anfangsplenum, Sonnabend, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Michael Opperskalski: Der palästinensische Widerstand in Gaza
Kaffeepause - 14.30 bis 15.00 Uhr
1. Zwischenseminar Lerngruppe A,Ökonomie 1. Teil: Wiederholung und Klärung 2. Teil: Marxsche Methode: 3. Teil: Lenins Imperialismustheorie:
|
1. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik 1. Teil: Wiederholung und Klärung 2. Teil: Revolutionstheorie, 3. Teil: Strategie und Taktik der kommunistischen |
Abendessen - 19.00 bis 20.00 Uhr
Zweites Plenum, Sonnabend, 20.00 bis 21.30 Uhr
Ingo Niebel: Der revolutionäre Prozess in Venezuela
2. Tag, Sonntag
Frühstück - 8.00 bis 9.00 Uhr
1. Zwischenseminar Lerngruppe A,Ökonomie Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe B“. |
1. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe A“. |
Mittagessen - 13.00 bis 14.00 Uhr
Schlussplenum: 14.00 bis 16.00 Uhr
1. Teil:
Der deutsche Imperialismus, Teil 1
2. Teil:
Reflexion des Fortgangs unseres Fernstudiums, Lob, Kritik, Wünsche, Verbesserungsvorschläge.
5. Seminar: Viertes Zwischenseminar (nach 12 Monaten)
1. Tag, Sonnabend
Anfangsplenum: 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr:
Michael Opperskalski: Iran
Kaffeepause - 14.30 bis 15.00 Uhr
4. Zwischenseminar Lerngruppe A, Ökonomie 1. Teil: Wiederholung und Klärung offener 2. Teil: Politische Ökonomie des |
4. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik 1. Teil: Wiederholung und Klärung 2. Teil: Klassischer Revisionismus |
Abendessen: 19.00 - 20.00 Uhr
Zweites Plenum Sonnabend, 20.00 bis 22.00 Uhr:
Michael Opperskalski und Frank Flegel: Der so genannte Stalinismus.
Klassenkampf, Ökonomie und Politik in der Sowjetunion von den 20er Jahren bis in
die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Heutige Bedeutung.
2. Tag
Frühstück - 8.00 bis 9.00 Uhr
1. Zwischenseminar Lerngruppe A,Ökonomie Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe B“. |
1. Zwischenseminar Lerngruppe B, Politik Siehe: 1. Tag unter „Lerngruppe A“. |
Mittagessen - 13.00 bis 14.00 Uhr
Schlussplenum, 14.00 bis 16.00 Uhr
1. Teil
Andrea Schön: Der deutsche Imperialismus, Teil 2
2. Teil
Planung des nächsten Seminars: Agitation und Propaganda, Fragen der Entfaltung von Organisationskraft, Vernetzung, Zusammenarbeit, Multiplikation.
6. Seminar Schluss-Seminar (nach 15 Monaten)
1. Tag
Anfangsplenum, Sonnabend, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr:
Frank Flegel:
Kriterien für kommunistische Agitation und Propaganda,
abgeleitet aus den Mystifizierungen der Oberfläche des Kapitals und deren Fetischbildungen.
Kaffeepause - 14.30 bis 15.00 Uhr
Kleingruppenarbeit
Sonnabend 15.00 – 17.30 Uhr:
Exemplarische Analysen vorhandener historischer und aktueller Beispiele
für kommunistische Agitation und Propaganda. Reflexion, Kritik und Verbesserung.
Zweites Plenum Sonnabend, 17.30 – 19.00 Uhr:
Vorstellung der Kleingruppenarbeiten, Diskussion
Abendessen - 19.00 – 20.00 Uhr
drittes Plenum Sonnabend, 20.00 bis 22.00 Uhr:
Michael Opperskalski und Frank Flegel: Organisationsseminar.
Handreichungen zu den Fragen von Motivieren, Organisieren und Reflektieren.
2. Tag
Frühstück - 8.00 bis 9.00 Uhr
Viertes Plenum, Sonntag, 9.00 bis 13.00 Uhr:
Zukunft.
Mittagessen - 13.00 bis 14.00 Uhr
Fünftes Plenum, Sonntag, 14.00 – 15.30 Uhr
Schluss-Reflexion des Fernstudiums.
IV. Materialien und Kosten
Wir werden für das eineinhalbjährige Fernstudium eine geringe Gebühr nehmen müssen: 10,00 €. Alle Teilnehmer/innen werden dafür zu Beginn ein Paket ausgehändigt bekommen mit sieben Schulungsheften und wahrscheinlich auch einer CD mit Texten. Das „Kapital“, Band 1 von Marx (Dietz-Ausgabe MEW 23 – wir brauchen gleiche Seitenzahlen!) und Lenin: „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ müssen von den Teilnehmern/innen angeschafft werden.
Für die Tagungsräume und die Verpflegung bei den Seminaren müssen wir ebenfalls jeweils 10,- € berechnen.
Außerdem müssen die Fahrtkosten zum Seminarort (z.Zt. Hannover) von den Teilnehmern/innen selbst aufgebracht werden.
Für diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, werden wir eine Kampagne für einen Spendenfonds einrichten, damit fehlendes Geld kein Hindernis fürs Lernen ist.
Zeitpunkt des Startseminars und Anmeldungen:
Sonnabend, 20. und Sonntag, 21. März 2010,
Beginn: Sonnabend, 20.3.10, 12.00 Uhr in Hannover
Anmeldungen:
Redaktion offen-siv, F. Flegel, Egerweg 8. 30559 Hannover.
Tel.u.Fax: 0511 – 52 94 782,
Mail: redaktion@offen-siv.net
Redaktion offen-siv
Hannover
Frank Flegel
Multiplikatoren
Am 7. und 8. November 2009 fand das Schluss-Seminar des zweiten Durchganges unseres Fernstudiums statt.
Das Thema waren Fragen von Agitation und Propaganda, abgeleitet aus den notwendigen Verkehrungen des Alltagsbewusstseins, wie sie von Marx aus der Kapitalanalyse entwickelt werden, also aus dem Fetischcharakter der Ware, des Geldes und des Kapitals, aus den Mystifikationen der Oberfläche der Waren- und Kapitalzirkulation sowie dem Lohnfetisch.
Gleichzeitig gab es Handreichungen zu den Problemen des Organisierens, Motivierens und Reflektierens.
Und es war selbstverständlich die Zukunftsperspektive Thema.
Dabei stellte sich heraus, dass 10 Genossinnen und Genossen des jetzt abgeschlossenen Lehrganges sich zu Teamern weiterqualifizieren wollen. Dazu nehmen sie am dritten Durchgang teil.
Sie werden von den bisherigen Teamern in die inhaltlichen, didaktischen und methodischen Vorbereitungen einbezogen und sie werden einzelne Bausteine, Themen oder Themenblöcke (unter Anleitung) beim neuen Durchgang selbständig übernehmen.
Das Ziel ist, unser marxistisch-leninistisches Fernstudium ab 2011 verbreitern und vor allem regionalisieren zu können.
Ich ziehe den Hut vor diesen Genossinnen und Genossen, denn die Begeisterung darüber, dass der Marxismus-Leninismus das Instrument ist, sowohl die Welt zu erkennen als auch den Weg zu ihrer Veränderung zu finden, die Faszination der Erkenntnis und die Notwendigkeit des Handels bringt sie dazu, Anstrengungen und Kosten, Zeit und Energie aufzubringen, um genau dies weiterzugeben.
Die Arbeit mir ihnen ist mir eine große Freude.
Frank Flegel
Hannover
Aus der Leser/innenpost |
Erich Buchholz
Zu offen-siv 5-09. Einige Anmerkungen zum Kompendium des marxistisch-leninistischen Fernstudiums, Kapitel Staatstheorie, Punkt 3: Der Staat und seine Funktionen
Dort heißt es: "Der Staat ist das entscheidende politische Machtinstrument der ökonomisch herrschenden Klasse einer Gesellschaftsformationen zur Sicherung und Durchsetzung ihrer Interessen."
Diese Aussage ist zweifellos zutreffend und vielfältig praktisch bestätigt. Sie bedarf natürlich der konkret-historischen Ausfüllung dessen, wer die jeweils herrschenden Klassenkräfte sind bzw. waren: wer herrschte während der Kaiserzeit, während der Weimarer Republik, im Nazistaat, in der frühen Bundesrepublik und in der durch Annexion der DDR mächtiger gewordenen Bundesrepublik!
Der moderne bürgerliche Staat tritt mit allem, was dazugehört (Parlament, Regierung, Exekutive mit Polizei und Armee, sowie Rechtsprechung) nicht, besonders wenn er sich als „demokratischer Rechtsstaat“ bezeichnet und ein solcher sein will, ganz überwiegend nicht vordergründig als solches Herrschaftsinstrument in Erscheinung. Er begegnet dem Bürger in der Regel nicht als unmittelbares politisches Machtinstrument. Er erscheint getarnt, wenn man so will als „Wolf im Schafspelz“ – aber nicht aus einem besonderen politischen Kalkül heraus, sondern seinem Wesen gemäß! Denn der Kapitalist benötigt zur Profierzielung möglichst dauerhaft ruhige, ungestörte Ausbeutungs- und Marktverhältnisse. Für diese soll sein Staat für „Ruhe und Ordnung“ sorgen.
Dazu gehört die Funktion des modernen bürgerlichen Staates, in Erfüllung seiner grundlegenden, in der oben zitierten Definition benannten Interessen der gesamten kapitalistischen Klasse, deren einzelne Kapitalisten auf dem Markt zueinander in oft erbittertem Konkurrenzkampf stehen, die für die Profiterzielung notwendigen äußeren Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erhalten.
Zu diesen äußeren Bedingungen gehört zum einen, dass sich die Ausgebeuteten möglichst ohne Widerstand im Arbeitsprozess mit der Mehrwerterzeugung ausbeuten lassen, und zum andern, dass im alltäglichen Kampf aller gegen alle und jedes gegen jeden, besonders auf dem Markt, außerökonomische Störungen möglichst ausgeschlossen bleiben, so dass das Geld möglichst ungestört die Welt regieren kann.
In Erfüllung dieser oben genannten Funktion „sorgt“ der moderne bürgerliche Staat auch dafür, dass den Ausgebeuteten gerade noch solche Überlebensbedingungen bleiben, dass nicht mit einem offenen, gewaltsamen Protest gegen ihre Ausbeutung aufbegehren.
Dazu gehört auch die im Art. 20 GG verwendete, von den Politikern gebrauchte und von deren Medien verbreitete Vokabel vom „Sozialstaat“. Der Einsatz dieser Vokabel vom Sozialstaat gehört zum Arsenal der ideologischen Herrschaft der ökonomisch und politisch herrschenden Klasse.
Daher tritt der bürgerliche Staat als politisches Machtinstrument nur dann offen, unverblümt und unverhüllt in Erscheinung, wenn Bürger (bei Demonstrationen oder in anderer Form) offen gegen den Staat und seine Politik auftreten. Dann erleben sie seine Machtmittel, die Polizei, mit Ab- und Einsperrungen, mit Schlagstöcken (früher Gummiknüppeln), mit Tränengas und Wasserwerfern, mit Festnahmen und gegebenenfalls mit Strafverfolgung.
Für den Alltag und für die meisten Bürger, namentlich für die „ruhigen“ und „anständigen“ Bürger, die nicht aufmucken, erscheint der „demokratische Rechts-staat" friedfertig. Im Alltag kann sich der Staat, so der der BRD, so zeigen. Er muss nicht gewalttätig in Erscheinung treten.
Er lässt die Bürger in seiner „Parteiendemokratie“ alle vier Jahre einige der von den etablierten Parteien benannten Kandidaten in den Bundestag oder in die Landtage wählen. Der so konstituierte Gesetzgeber erlässt im Rahmen eines parlamentarischen Verfahrens ohne Beteiligung der Bürger die vornehmlich den Interessen der herrschenden Klassen dienenden Gesetze. Diese verschleiern durch eine hohe Abstraktion der Formulierung, in wessen Interesse sie erlassen worden und wem sie ihnen. (Darüber könnte in anderem Zusammenhang Näheres ausgeführt werden.)
Der neuzeitliche bürgerliche Staat erscheint harmlos, nicht gewalttätig, nicht als politisches Machtinstrument! Deshalb wissen und erkennen viele Bürger das wahre Wesen dieses Staates nicht! Dieses Bild vom unpolitischen und nicht gewalttätigen „demokratischen Rechtsstaat“, das prinzipiell von den früheren Staatswesen zu unterscheiden ist, wird besonders durch die herrschenden Medien der herrschenden Klasse vermittelt, vorgetäuscht, vorgezeichnet.
Deshalb besteht der erste Schritt der notwendigen Erkenntnis des Wesens und der Funktion des modernen kapitalistischen Staates darin, hinter dem Schein, hinter der Erscheinung dieses Staates sein Wesen zu erkennen.
Das ist eine vorrangige Aufklärung der heutigen Aufklärung.
Zur Erkenntnis des hinter dem Schein wirkenden Wesens des modernen kapitalistischen Staates ist es erforderlich, solche Umstände und Herrschaftsmethoden zu begreifen, die dieses Bild, diese Erscheinung befördern:
- Erstens werden die Gesetze nicht mehr wie früher durch Dekrete des Monarchen, sondern durch eine Volksvertretung, das Parlament erlassenen, durch eine Institution, die aufgrund von Wahlen vorgibt, das Volk zu vertreten und die Interessen des Volkes wahrzunehmen.
- Zweitens erscheint das heutige Recht - anders als früher - aufgrund seiner hoch-abstrakten Verallgemeinerung als eine Gesamtheit von Gesetzen, von Rechtsnormen, die - angeblich - über den Klassen stünden und die die Gleichheit aller Bürger und somit die Interessen der „Allgemeinheit“ zum Ausdruck brächten. Zum modernen „demokratischen Rechtsstaat“ gehören Gesetze, die ihren Klassencharakter nicht offen bekennen, sondern verschleiern; sie verschleiern damit ihre reale politische Funktion. Denn Gesetze sind stets in juristische Formen gebrachte Politik (nicht zufällig wird von Rechtspolitik gesprochen). Nur ganz selten tritt der Klassencharakter von Gesetzen und ihre politische Funktion so deutlich und unverhohlen hervor wie bei dem extra für die Strafverfolgung von Kommunisten und ihren Sympathisanten erlassenen 1. Strafrechtsänderungsgesetz vom 30. August 1951. Dieses grundgesetzwidrige politische Strafgesetz wurde als „Rechtsgrundlage“ für die rechtswidrige Strafverfolgung von Hunderttausenden von Bundesbürgern in den 50er Jahren – vielfach durch Nazi-Juristen - und zur Vorbereitung des KPD-Verbots erlassen.
- Dieses Bild des angeblich über den Klassen stehenden Staates und selbigen Rechtes wird durch eine entsprechende Rechtsideologie gestützt. Diese bürgerliche Rechtsideologie gehört als Methode ideologischer Herrschaft ganz wesentlich zum System der Klassenherrschaft im bürgerlichen Staat. Ideologische Herrschaft, besonders mit der bürgerlichen Rechtsideologie, ist zusammen mit der ökonomischen und politischen Herrschaft unerlässlich. (Auf sie müsste in anderem Zusammenhang näher eingegangen werden).
- Vor allem aber muss man sich darüber im Klaren sein, dass im bürgerlichen Staat, so heute in der Bundesrepublik, die ökonomische Herrschaft die maßgebliche ist. Bei der vorgenannten Definition des Staates und seiner Funktion als politisches Machtinstrument darf diese Tatsache nicht vernachlässigt oder unterschätzt werden. Hinter dem politischen Machtinstrument steht die wirtschaftliche Macht des Kapitals. Diese Wirtschaftsmacht ist die ausschlaggebende und maßgebliche Macht in der Gesellschaft.
Deshalb ist es irreführend, wenn durch die Medien in Vorbereitung von Wahlen im Wahlkampf die Frage aufgeworfen wird, wer denn die Macht (durch Wahlen) erringen werde. Ganz gleich, wie das Wahlergebnis schließlich aussieht und welche der beiden großen Parteien die meisten Sitze im Parlament einnehmen darf, die Macht der Kapitalisten, die Wirtschaftsmacht, wird durch diese Wahlen überhaupt nicht tangiert, geschweige gefährdet. Die Wirtschaftsmacht des Kapitals bleibt intakt. Die großen Konzerne und Trusts, besonders die großen Banken, verändern weder ihren Charakter noch ihre Tätigkeit mit oder durch die Wahlen. Ihre Entwicklung und ihre Praxis folgen ganz anderen – ökonomischen – Gesetzen. Welche politischen Kräfte im Parlament in der Regierung und anderswo eine Rolle spielen, das Sagen haben, berührt überhaupt nicht die reale Wirtschaftsmacht des Kapitals. Denn „die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Interessen der gesamten Bourgeoisieklasse verwaltet“, so im Komm. Manifest (im Abschn. 1: Bourgeoisie und Proletariat)
Die ökonomische Macht des Kapitals und Finanzkapitals wird durch Wahlen nicht infrage gestellt. Deren Macht kann nur durch Enteignung der Kapitalisten ein-geschränkt und später überwunden werden.
Da das Grundgesetz ausdrücklich bei (zulässigen) Enteignungen eine angemessene Entschädigung verlangt, also nur eine Modifizierung der ökonomischen Macht, an Stelle von Unternehmen bare Münze, zulässt, mit der man neue Unternehmen gründen und aufbauen könnte, erlaubt das Grundgesetz ausdrücklich keine wirkliche, die Macht des Kapitals berührende Enteignung. Das Grundgesetz, das angeblich wirtschaftspolitisch neutral sei, verbietet somit die Entmachtung des Kapitals.
Nur in Ostdeutschland war eine entschädigungslose Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher - in Sachsen durch Volksentscheid, in anderen Ländern durch Ländergesetze - vorgenommen worden.
Dass die Wirtschaftsmacht die größte und maßgebliche Macht im Staate ist, ist in der Bundesrepublik in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich wie nie zuvor auch von solchen Kanzlern wie Schröder und Merkel ausgesprochen worden. Sie sprachen immer von der "Wirtschaft" in deren Interessen sie handelten - mit der Unterstellung: wenn es der Wirtschaft gut ginge, würde es auch den einfachen Menschen gut gehen, würde man die Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheiten überwinden können.
Sechs Jahrzehnte haben sie Zeit gehabt, die Wahrheit dieser Phrase zu beweisen.
Da sie solches dennoch nicht leisteten, ist damit bewiesen, dass die Bundes-regierungen nichts anderes waren und sind als der „geschäftsführende Ausschuss“ der gesamten Kapitalistenklasse.
Die Wirtschaftsmacht des großen Kapitals zeichnet sich dadurch aus, dass sie friedfertig und rechtmäßig daherkommt, einer unmittelbaren politischen Macht, ebenso direkter sichtbarer Gewalt, entbehrt. Denn kraft des Eigentumstitels (§ 903 BGB) hat es der Kapitalist nicht nötig, im Alltag Gewalt gegenüber Bürgern, gegenüber Menschen einzusetzen. (Im Falle der Bedrohung seiner Rechte und seines Eigentums ruft er die Polizei, damit diese für ihn tätig wird.) Mehr noch: Der Kapitalist bietet dem eigentumslosen „Arbeitnehmer“ Arbeitsplätze an, wobei er die Bedingungen dafür in hohem Maße selbst diktiert.
Der Eigentumslose ist zur Sicherung seines Lebensunterhalts (= zur Reproduktion seiner Arbeitskraft!) und des Lebensunterhaltes seiner Familie, um nicht Hungers zu sterben, unter den gegebenen objektiven ökonomischen Bedingungen, also nicht durch das besondere Handeln von Menschen) genötigt, seine Arbeitskraft anzubieten und zu verkaufen. Da bei diesem Vorgang keine natürliche Person unmittelbar Gewalt anwendet oder mit Gewalt droht, liegt nach dem Strafrecht keine Nötigung (§ 240 StGB) oder Erpressung (§ 253 StGB) vor. Der eigentumslose, Arbeit suchende „Arbeitnehmer“ sieht sich aufgrund der ökonomischen Verhältnisse genötigt und erpresst, „jede Arbeit“ anzunehmen, wobei der Kapitalist nur in seltenen Fällen besonders persönlich in Erscheinung tritt.
Weiter darf nicht übersehen werden, dass Kapitalist und Arbeiter aufeinander angewiesen sind:
- Der Kapitalist kann Profit nur erzielen, wenn Arbeiter bei ihm, für ihn arbeiten, sich ausbeuten lassen. Allein aus dem toten Kapital (Maschinen, Geräte, auch elektronische usw.) allein aus dem „konstanten“ Kapital also (wie es Marx definiert: siehe Studienmaterial S. 36 ff) resultiert kein Mehrwert! Die Mehrwertproduktion, die Profitmacherei erfordert den lebenden Arbeiter, das „variable Kapital“.
- Der Arbeiter kann nicht leben, die Arbeiterklasse als ganze kann nicht existieren, wenn sie nicht ihre Arbeitskraft an den Kapitalisten verkauft und sich ausbeuten lässt.
Diese wechselseitige Abhängigkeit bedeutet, dass unter den gegebenen gesell-schaftlichen kapitalistischen Grundbedingungen bei geschlossenem Auftreten der Arbeiter (so durch ihre Gewerkschaften, früher auch mit mittelbarer Unterstützung durch die DDR) bestimmte, etwas günstigere Bedingungen erkämpft werden können. Bei anderen Bedingungen, so bei hoher Arbeitslosigkeit, sind die Bedingungen, unter denen die Arbeiter ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, ihre Marktbedingungen weit ungünstiger: Die Arbeiter müssen ihre Arbeitskraft auch zu Dumpingpreisen verkaufen oder sich als „Leiharbeiter“ verdingen.
Heutzutage muss man im Rahmen der „Globalisierung“, d.h. der umfassenden Internationalisierung der Kapitalverhältnisse, weiterhin – was hier nur angedeutet werden kann – den Zusammenschluss kapitalistischer Staaten, so in der EU, berücksichtigen. Diese supranationale Staatlichkeit organisiert die geordnete Ausbeutung im Gesamtinteresse aller Kapitalisten, besonders der großen, im kapitalistischen Europa. Daher muss die einleitend wiedergegeben Definition „internationalisiert“ ausgebaut und differenziert werden.
Überwunden werden kann die vorstehend dargestellte Ausbeutung und gegenseitige Abhängigkeit in der kapitalistische Gesellschaftsordnung nur durch Aufhebung des Kapitalverhältnisses, durch Überwindung des Privateigentum an Produktionsmitteln, jedenfalls den wichtigsten, durch umfassende entschädigungslose Enteignung.
In der DDR wurde über vier Jahrzehnte praktisch bewiesen, dass die Arbeiter nicht alle Zeit und unter allen Bedingungen auf die Kapitalisten angewiesen sind, sondern nur, solange es das Kapitalverhältnis und Kapitalisten gibt. In der DDR haben die Arbeiter auf der Grundlage von Volkseigentum an den maßgeblichen Produktionsmitteln erfolgreich industrielle produziert.
Erich Buchholz
Berlin
Werner Wild
Die Kasernierte Volkspolizei - zu offen-siv 6/09
Der Beitrag in offen-siv 6/09 zur Erinnerung an die so bedeutende II. Parteikonferenz der SED 1952 ist direkt eine Aufforderung an meine Person, um darauf eine Resonanz folgen zu lassen:
1952 hatte ich im September das zweite Studienjahr an der Fachschule für Landwirtschaft in Klötze/Altmark begonnen. Im Studium und in der FDJ befassten wir uns mit den Beschlüssen und Dokumenten der II. Parteikonferenz. Im Zuge der Umsetzung der Beschlüsse waren wir als FDJler in den Dörfern der Altmark unterwegs und diskutierten mit den Jugendlichen über die Stärkung der DDR zur Verteidigung des Aufbaus der Grundlagen des Sozialismus. Große Teile der Jugendlichen verpflichteten sich für einen dreijährigen freiwilligen Ehrendienst in den Reihen der geschaffenen bewaffneten Organe der DDR – der Kasernierten Volkspolizei (KVP). Und für mich selbst ergab sich aus diesen Gesprächen und Werbungen, dass ich mich natürlich ebenfalls für diesen dreijährigen Ehrendienst verpflichtete. Diesen leistete ich vom 30. September 1952 bis zum 30. September 1955 in den Dienststellen Burg und Rostock ab.
Wie notwendig bewaffnete Organe für die DDR waren, zeigte der 17. Juni 1953. Hier waren wir als KVP zur Sicherung wichtiger Objekte und Anlagen im Einsatz.
In den Jahren 1953 bis 1955 war ich FDJ-Sekretär in einer Einheit der KVP und trug somit zum gesellschaftspolitischen Leben bei. Nach meiner Entlassung setzte ich im Oktober 1955 mein unterbrochenes Studium an der Fachschule für Landwirtschaft in Oranienburg fort. Natürlich gab es vor meiner Entlassung aus der KPV Gespräche für einen Verbleib in den bewaffneten Organen und für den Besuch einer Offiziersschule. Aber - auch wenn es mir schwer fiel - ich wollte meinen unterbrochenen Ausbildungsverlauf fortsetzen.
Werner Wild
Magdeburg
Hans Bauer
Andenken an und Nachdenken über die DDR
Lieber Frank, die Konferenz ist aus meiner Sicht außerordentlich kämpferisch, sachlich, niveauvoll und konstruktiv verlaufen. Die Unterstützung durch die GRH hat sich als richtig erwiesen. Wir danken Euch besonders für die Möglichkeit, die Tagung für das Andenken an und das Nachdenken über die DDR zu nutzen. Damit wurde ein wichtiger Beitrag gegen Geschichtsfälschung und für künftige Lehren geleistet. Ich hoffe, auch für eine breitere gemeinsame Front linker Kräfte in diesem Lande.
Wenn der Band über die Konferenz vorliegt, bitte ich um Zusendung eines Exemplars an die GRH.
Nochmals vielen Dank und alles Gute für die weiteren Kämpfe.
Solidarische Grüße, Hans Bauer
Monika Voigt
Klasse!
Liebe Anna. Lieber Frank, wir möchten uns für die Tagung zum 60. Jahrestag der Gründung der DDR in Berlin ganz herzlich bei Euch beiden und allen anderen Genossen und –innen für ihre Leistung bedanken. Das war einfach nur Klasse!
Danach waren wir zwar ganz schön k.o., aber glücklich! Nun kommt es darauf an, eine neue Qualität unserer Arbeit aufzubauen. Es müssen Barrieren in den Köpfen vieler Menschen und einiger Genossen beseitigt werden, und das ist Schwerstarbeit. Die Ambivalenzkonflikte, die sie mit und durch dieses System haben, können wir nur durch intensives Studium unserer Theorie, des Marxismus-Leninismus, die geduldige Auseinandersetzung mit Unklarheiten und mit Zweifeln und in Solidarität auflösen.
Es bedarf aber auch der klaren Abgrenzung von den Gruppen, die nach altbewährten Methoden unsere wissenschaftliche Weltanschauung diffamieren und so dem Kapital zuarbeiten. Sie versuchen, auf ihrer eigenen Schleimspur zur Macht zu rutschen. Solche müssen isoliert werden, sie sind gefährlich.
Wir grüßen Euch mit kommunistischen Grüßen,
Renate, Monika, Bernd und Günter plus Sympathisanten!
Monika Voigt
Treuen
offen-siv-Lesertreffen |
Einladung zum offen-siv-Lesertreffen Südost
„Wer, wenn nicht wir!“
Unter diesem Thema findet am 30. Januar 2010 in Gera die erste Leserkonferenz der Zeitschrift „offen-siv“ in der Region statt.
Von 10 Uhr bis gegen 15 Uhr werden sich die Leser über folgende Probleme austauschen:
- Der Beitrag von „offen-siv“ an der Aufdeckung und Verbreitung von Ursachen und Wirkungen in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung;
- Aktivierung des eigenen Beitrages der „offen-siv“-Leser zur Stärkung der Ausstrahlung und Verbreitung ihrer Zeitschrift;
- Möglichkeiten und Wege zur Schaffung einer einheitlichen marxistisch-leninistischen Partei neuen Typus in der BRD und der Anteil der Zeitschrift „offen-siv“
Alle Teilnehmer sind aufgerufen, sich durch eigene Kurzbeiträge in den Diskussionen aktiv am Erfolg des Treffens zu beteiligen.
Veranstaltungsort: WASKO Bistro, Berliner Straße 157. 07546 Gera
Interessenten wenden sich bitte an die Redaktion der Zeitschrift oder an: Detlef Krüger, E-Mail: dkb.grz@t-online.de, Hotline: 0179/755 97 89
Detlef
Einladung zum offen-siv–Lesertreffen Südwest
Liebe offen-siv – Leserinnen und – Leser, liebe Genossen,
Am Zaun eines Neubaus bei Kreßbronn (Bodensee) steht : „Genug!“
Genug! Genug! O Wort wie Donnerschlag!
Genug geschluckt – nun wird es ausgespien!
Genug des Schweigens – endlich wird geschrien!
Zu laut für euch? Was ich schon danach frag!
Genug, genug in Ecken mich gedrückt –
Genug, genug, genug emporgeblickt –
Genug, genug, genug in Leid erstickt –
Genug, o wie genug: „jaja“ genickt –
Genug Geflüster! Endlich sage nein.
Es muß genug, es muß genug jetzt sein!
Was war das alles? Unfug. Trug.
Es kommt die Zeit, da auch die Steine schrein,
Sie schrein wohl hart, das wird ein Schreien sein:
„Genug!“
(Johannes R. Becher, Ausgewählte Dichtung, Aufbau 1948)
Der Südsüdwesten: hauptsächlich kleinere Städte und Dörfer, ländlich althergebrachte Traditionen und scheinbar festbetonierte politische Verhältnisse in einer angeblich heilen Welt ?
Dieses Klischee sehen wir Offen-siv–Leser unserer Region ganz anders. Es gibt auch zwischen Hoch- und Oberrhein, zwischen Allgäu und Schwäbischer Alb, zwischen Bodensee und Donau-Iller eine ganze Reihe von uns, die längst „Genug!“ gesagt haben. Die etwas anderes wollen als diese kapitalistische Gesellschaft mit einem immer rasanter werdenden Sozialabbau, mit sich ausbreitender Armut sowie mit einer immer reaktionärer werdenden Formierung des bürgerlichen Staates. Die bei regionalen Friedensbündnissen aktiv sind und gegen das Erstarken der Neonazis am Bodensee eintreten.
„Genug!“ Mit unserer Zeitschrift analysieren wir bereits, wir sammeln Erkenntnisse und erfahren spannende Neuigkeiten aus der kommunistischen Bewegung. Gibt es aber auch Möglichkeiten, darüber hinaus regional aktiv zu werden?
Hiermit laden wir herzlich ein zu einem Offen-siv–Lesertreffen. Lernen wir uns kennen. Diskutieren wir über interessante Offen-siv–Artikel. Überlegen wir Möglichkeiten, die kommunistische Bewegung auch in Südsüdwest voranzubringen.
Vorschlag:
1. neue Offen-siv–Artikel
2. Rückblicke und Berichte:
* Perspektivkonferenz der Kommunistischen Initiative am 05.12.2009
* LL-Demo und Rosa-Luxemburg-Konferenz am 10.01.2010
3. KI in Südsüdwest
Datum: 30. Januar 2010, 15.00 Uhr
Ort: bei Ravensburg, Kontakt: 07520/967870 oder emko512@yahoo.de
Martin
KI-Regionaltreffen |
Rhein-Main/Hessen
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir möchten euch gerne zum KI-Rhein-Main-Treffen in Frankfurt am Mo., 30.11.09 um 19:00 im Club Voltaire (1. Stock), Kleine Hochstr. 5, Frankfurt/Main, einladen.
Nachdem bei der DDR-Konferenz im Oktober in Berlin einige Perspektiven der Kommunistischen Initiative deutlicher wurden (siehe KI-Newsletter und Website), wollen wir gerne für Rhein-Main/Hessen besprechen, wie wir diese bewerten und wer sich wie einbringen kann. Neben dem Kennenlernen und Erfahrungsaustausch wäre eventuell eine erste Arbeitsteilung möglich sowie weitere Verabredungen. Insbesondere für die einige Tage später, am 5./6.12. in Berlin stattfindende Perspektivkonferenz der KI. Es wäre natürlich famos, wenn Rhein-Main/Hessen dort sich mit praktischen Vorschlägen einbringen könnte und einige mitfahren könnten. Das "Manifest" als Ablösung des Aufrufs mit einer deutlicheren inhaltlichen Profilierung und der Austausch von Erfahrungen stehen in Berlin im Vordergrund. Über diese beiden Punkte sollten wir auch am 30.11. reden.
Da einige größere Strecken zurücklegen müssen, beginnt das Treffen um 19:00 und endet gegen 22:00. Falls Übernachtungsmöglichkeiten gebraucht werden, können wir das gerne organisieren.
Bitte gebt Bescheid, ob ihr kommt, damit wir wissen mit wie vielen wir rechnen können.
Per email: info@alerta-frankfurt.de
Postalisch an: Michael Kubi, Mühlheimer Str. 6, 60386 Frankfurt
Mit kommunistischen Grüßen
Philipp
ANMERKUNGEN
-
Nachträglich wurde die Kommunistische Initiative im Spektrum des RFB nicht nur als „linksradikal“ und „sektiererisch“ bezeichnet, sondern auch als „westgesteuert“.
-
In gewissem Sinne ist natürlich jede proletarische Revolution zu früh, ganz gleich wo sie ausbricht. Zu früh, weil abweichend von den kapitalistischen und feudalen Verhältnissen die sozialistischen Verhältnisse nicht in der ihr vorangehenden Formation hervorkeimen können. Für ihre Organisation war ein völlig neuartiger von der Revolution zu schaffender Typ des Staates samt seinen Institutionen nötig geworden. Die Revolution muß also vorangehen und sich ihre eigenen Existenzbedingungen selbst schaffen.
-
Die Anmerkungen und Quellenangaben findet Ihr am Ende des Artikels! (d. Red.)
-
Die Führung der KPD ist unserer Bitte nach Veröffentlichung unseres Briefes in der inzwischen erschienenen November-Ausgabe der Roten Fahne nicht nachgekommen.
-
Die Redaktion der DKP-Internetseite www.kommunisten.eu hat zu diesem Zeitpunkt nämlich eine im Internet abrufbare „Broschüre“ mit den bisherigen Meinungsäußerungen zusammengestellt, die jetzt in den Parteigruppen vor Ort heruntergeladen und diskutiert werden sollen. Damit wird das Ganze langsam verebben und schließlich in der Versenkung verschwinden.
-
Alle Jacobs Zitate beziehen sich auf das Interview, das auf der Seite www.kominform.at unter der Adresse zu finden ist
-
Hier gilt das von Marx entwickelte, nur dass man sich die Wertform wegdenken muss: „Dass die Ware Gebrauchswert habe, also ein gesellschaftliches Bedürfnis befriedige, war die eine Voraussetzung des Verkaufs. Die andre war, dass das in der Ware enthaltne Quantum Arbeit gesellschaftlich notwendige Arbeit repräsentiere, der individuelle Wert (und was unter dieser Voraussetzung dasselbe, der Verkaufspreis) der Ware daher mit ihrem gesellschaftlichen Wert zusammenfalle.“ (Karl Marx, Das Kapital, Dritter Band, in: MEW 25, S. 191)
-
„Erst innerhalb ihres Austauschs erhalten die Arbeitsprodukte eine von ihrer sinnlich verschiednen Gebrauchsgegenständlichkeit getrennte, gesellschaftlich gleiche Wertgegenständlichkeit. Diese Spaltung des Arbeitsprodukts in nützliches Ding und Wertding betätigt sich nur praktisch, sobald der Austausch bereits hinreichende Ausdehnung und Wichtigkeit gewonnen hat, damit nützliche Dinge für den Austausch produziert werden, der Wertcharakter der Sachen also schon bei ihrer Produktion selbst in Betracht kommt. Von diesem Augenblick erhalten die Privatarbeiten der Produzenten tatsächlich einen doppelten gesellschaftlichen Charakter. Sie müssen einerseits als bestimmte nützliche Arbeiten ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen und sich so als Glieder der Gesamtarbeit, des naturwüchsigen Systems der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit, bewähren. Sie befriedigen andrerseits nur die mannigfache Bedürfnisse ihrer eignen Produzenten, sofern jedebesondre nützliche Privatarbeit mit jeder andren nützlichen Art Privatarbeit austauschbar ist, also ihr gleichgilt. Die Gleichheit toto coelo <völlig> verschiedner Arbeiten kann nur in einer Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehn, in der Reduktion auf den gemeinsamen Charakter, den sie als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, abstrakt menschliche Arbeit, besitzen.“ (Karl Marx, a.a.O. S. 87 f.)
-
Vgl. Herbert Meißner, Hrsg., Geschichte der politischen Ökonomie, Berlin 1985, S. 841 ff.
-
Vgl. Günter Krause, Wirtschaftstheorie in der DDR, Marburg 1998, S. 180
-
Die Preise bemessen sich auf Grundlage der Selbstkosten und des Reineinkommens, sie bleiben während einer Planperiode meist unverändert (sic!). Der „Wert“ des Produktes wurde bemessen in Arbeitszeit berechnet je Einheit ihres Gebrauchswertes. Steigt also die Arbeitsproduktivität, sinkt der „Wert“ je produziertem Gebrauchswert. Bleibt der Preis je Gebrauchswert unverändert, reflektiert also nicht diesen „Wertwechsel“, muss bei einer gewachsenen Gebrauchswertmasse, um sie umsetzen zu können, die Geldmenge gemäß der Produktivitätssteigerung wachsen. Langfristig wurde ein Sinken des Preisniveaus bei fallenden Selbstkosten angenommen. Der Festpreis bezieht sich also nur auf die geplante, betriebsindividuell aufgewandte Arbeit.
-
Horst Richter/Waldfried Schließer, Die Warenproduktion im Sozialismus, Berlin 1986, S. 116
-
Claus Krömke, Waren das „Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft“ in der DDR und die „Neue Ökonomische Politik“ in Sowjetrussland Wege in die Marktwirtschaft?, in: Ist sozialistische Marktwirtschaft möglich?, Leipzig 2001, S. 58
-
André Steiner, Von Plan zu Plan, Eine Wirtschaftsgeschichte der DDR, Berlin 2007, S. 153
-
Siegfried Wenzel, Was war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert geblieben? Versuch einer Abschlussbilanz, Berlin 2004, S. 208
-
Otto Reinhold, Ökonomische Gesetze des Sozialismus und Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswissenschaft, Heft 10, 1972, S. 1449 f.
-
Sollte jemand auf die Idee kommen zu fragen, wie sich nun der Tausch, also die Ware, in den Sozialismus eingeschlichen haben soll, so müsste man sagen: die Ware war ja schon da und mit ihr das Geld, aber aus anderen Gründen als um die Verteilung der Arbeit auf die Produktionszweige zu regulieren.
-
Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit wird reguliert durch die produzierte Warenmasse. Sie kann entweder bestimmt sein durch die unter mittleren, schlechteren oder besseren Bedingungen produzierte Warenmasse, abhängig von dem Umfang der jeweils produzierten Gebrauchswertmasse.
-
Wilfried Ettl et al., Grundgedanken einer Wirtschaftsreform in der DDR – Thesen zur Diskussion, Wirtschaftswissenschaft, Heft 2,1990, S. 165
-
In ihren „Thesen über den Sozialismus“, beschlossen auf dem 18. Parteitag im April 2009, hat die Kommunistische Partei Griechenlands nach jahrzehntelanger Abstinenz in der sozialistischen Wissenschaft wieder auf den Satz von Karl Marx im Band II des „Kapital“ hingewiesen, dass, würden Arbeitsnachweise im Sozialismus ausgestellt, sie kein Geld im Sinne der Warenproduktion wären, sie „zirkulierten nicht“. Das gilt auch für ein „Geld“, das nur vom Staat in den Betrieb oder in das Individuum, und von dort wieder zurück in den Staat wechselte.
-
Wolfgang Hoss: „Ein marxistisches Sozialismusmodell für das 21. Jahrhundert“, „offen-siv“ Heft 6; September-Oktober 2009
-
Weshalb es für die Betriebe auch nicht das Prinzip der zwei Phasen des Kommunismus gibt; für die Betriebe gilt immer der Plan, also das Prinzip eines ökonomischen Minimums, egal, ob sich die Individuen in einer ersten Phase – Verteilung nach der Leistung – oder einer zweiten Phase des Kommunismus befinden – Verteilung nach dem individuellen Bedürfnis. Darüber bitte ich auch mal nachzudenken.
-
Es wird wohl davon ausgegangen, dass am Ende der DDR bei der Bevölkerung ein Sparvolumen von rd. 160 Mrd. Mark der DDR entstanden war. Das könnte auf eine mehrjährige Diskrepanz von Plan und Planerfüllung zurückzuführen sein. Die letzten Jahre der DDR waren aber auch besondere Jahre – aufgrund der besonderen Zeit, die in der Sowjetunion angebrochen war. Von der Sowjetunion wiederum ist bekannt, dass es in den Gorbatschow-Jahren zu einer Welle ungedeckter Lohnerhöhungen kam. Die letzten fünf Jahre Sozialismus sind kein Maß mehr für Sozialismus und Planwirtschaft.